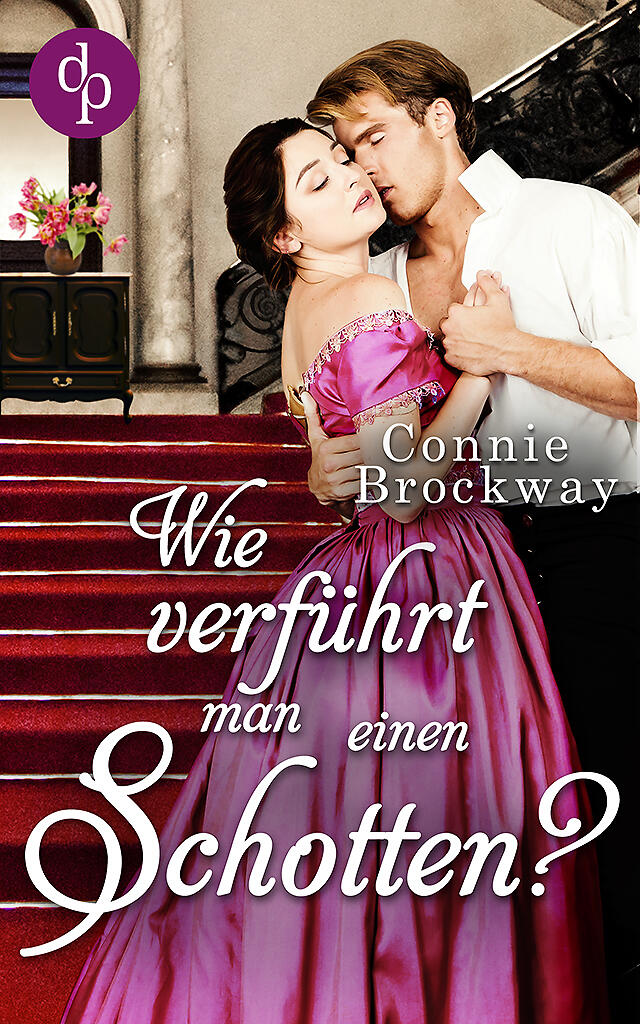Prolog
Abtei St. Bride’s, Januar 1804
Trauungsfeier von Christian MacNeill und Katherine Nash Blackburn
Charlotte verließ die Kapelle und ging zum Kreuzgang der Abtei St. Bride’s hinüber, wobei sie sich mit beiden Händen über die nackten Arme rieb. Der schottische Winter war entsetzlich kalt, und wenn das rostbraune Umhängetuch, das ihr ihre Schwester Helena den ganzen Nachmittag über hatte aufdrängen wollen, die Eleganz ihres neuen hellblauen Kleides nicht so hoffnungslos zunichtegemacht hätte, hätte sie es sich wohl tatsächlich um die Schultern gewickelt.
Sie wusste nicht genau, warum sie mit einem Mal das heftige Bedürfnis empfunden hatte, die Trauungsfeier zu verlassen. Ihre andere Schwester Katherine und deren großer, stattlicher Soldat waren so verflixt glücklich, ihre Zukunft leuchtete in rosigen Farben, die Vergangenheit war vergessen. Ende gut, alles gut. Und welch besseres Ende konnte es geben, als dass zwei schöne, kluge und anständige Menschen nach Jahren des Kampfes endlich zueinanderfanden?
Keins! Außer … außer, dass Charlotte sich fühlte, als erlebe sie das glückliche Ende eines Märchens. Katherine hatte ihren edlen Prinzen gefunden, und Charlotte gönnte ihrer Schwester dieses Glück von Herzen. Das Ende ihrer eigenen Geschichte jedoch, so fürchtete sie, würde ganz anders aussehen.
Ihr Vater war drei Jahre zuvor gestorben, und mit seinem Tod hatte auch das Familienleben ein jähes Ende gefunden, das sie bis dahin gekannt hatte. Ihre Mutter war ihm binnen Jahresfrist ins Grab gefolgt, und Charlottes Schwestern, eifrig, nein, verzweifelt bestrebt, dem damals sechzehnjährigen Nesthäkchen all die ‚Annehmlichkeiten’ zu sichern, an die sie als junge Damen aus adligem Hause gewöhnt waren, hatten sie auf der Stelle in einem der renommiertesten Internate für höhere Töchter untergebracht. Allerdings nicht, ohne ihr zuvor einzuschärfen, sie solle sich dort um ‚wertvolle Verbindungen’ bemühen. Schließlich hatte auch Charlotte begriffen, was jedem flüchtigen Beobachter sofort ins Auge gesprungen sein musste: Sie war eine Bürde. Ihre Schwestern liebten sie, gewiss, doch sie war ihnen gleichwohl ein Klotz am Bein. Sie glich einer riskanten Geldanlage – nein, wohl eher einem Fass ohne Boden, ohne jede Garantie, dass das in sie investierte Kapital eines Tages Gewinn abwerfen würde. Es sei denn, sie machte klugen Gebrauch von jenen ‚wertvollen Verbindungen’.
Sobald sie sich ihrer Lage bewusst geworden war, hatte Charlotte sich darin eingerichtet. Sie verschwendete wenig Zeit darauf, der Vergangenheit nachzutrauern, und bemühte sich stattdessen, den Erwartungen ihrer Schwestern gerecht zu werden, was ihr dank ihrer neu entdeckten Anpassungsfähigkeit auch gut gelang. Schon als Kind war sie sehr aufgeweckt und vernünftig gewesen, nun war eine kühle, unsentimentale junge Frau aus ihr geworden.
Sechs Monate nach dem Tod ihrer Mutter hatten alle drei Töchter der Familie Nash eine auskömmliche, wenn auch nicht immer glückliche Anstellung gefunden: die heitere, liebreizende Helena als Gesellschaftsdame einer abscheulichen alten Klatschbase, die geheimnisvolle, leidenschaftliche Katherine als Klavierlehrerin im Hause einer Kaufmannsfamilie und Charlotte als fröhliche Gefährtin von Margaret Welton, der einzigen Tochter des sehr reichen, sehr gütigen und unglaublich schusseligen Lord Welton und dessen ebenso nachlässiger Gemahlin.
Die Weltons verlangten lediglich von ihr, dass sie die zahllosen Geschenke und Kleider annahm, mit denen sie überhäuft wurde, und sich ansonsten auf eine Art und Weise verhielt, die ihre nichtsnutzige Tochter im Vergleich als Inbegriff der Wohlerzogenheit erscheinen ließ.
Eine angenehmere Arbeit dürfte schwer zu finden sein, dachte Charlotte bitter, während sie auf die Tür am Ende des Kreuzgangs zuging, die einen Spaltbreit geöffnet war. Amüsant und lustig sollte sie sein, und jeden noch so albernen Einfall ihrer Freundin Margaret mitmachen, mehr verlangte man nicht von ihr. Sie hatte sich in einen frechen Wildfang verwandelt, in ein kokettes junges Fräulein von einiger Berühmtheit. In letzter Zeit jedoch plagte sie immer öfter die Befürchtung, die Rolle einer vorwitzigen jungen Frau könne die einzige sein, welche die Welt – und allen voran die Weltons – von ihr zu sehen wünschte, und, schlimmer noch, dass sie sich eines Tages selbst mit dieser zufriedengeben würde.
Doch sie strebte nach Höherem. Was genau das war, vermochte sie nicht zu sagen. Sie wusste nur, dass es sich dabei um etwas anderes handelte als das, was ihre Schwestern vom Leben erwarteten. Kates beharrliches Bestreben, die verlorene Sicherheit ihrer Kindheit wiederzuerlangen, lag ihr fern, eine Sicherheit, die ihre Schwester nun an der Seite ihres stattlichen Highlanders gefunden hatte. Sie war auch keine romantische Seele wie Helena, die nur um ihres wahren Selbst willen geliebt werden wollte. Ein bitteres Lächeln huschte über Charlottes Gesicht. Im Grunde wusste sie nicht einmal, was ihr ‚wahres Selbst’ ausmachte. War sie ein ‚süßes Ding’? Ein ‚charmanter Nichtsnutz’? Ein ‚entzückendes Biest’? Vermutlich steckte etwas von all diesen Rollen in ihr, und sie war jeder von ihnen überdrüssig. Das Leben konnte doch nicht nur daraus bestehen, eine Rolle auszufüllen!
Am Ende des Kreuzgangs angekommen, spähte sie durch den Türspalt ins Innere und entdeckte eine Art Bibliothek. Zwei der Wände waren bis knapp unter die Zimmerdecke mit Regalen bestückt, die sich schier bogen unter der Last der zahllosen Bücher. Charlotte lächelte. Sie liebte Bücher, und eines der Dinge, die ihr an ihrer augenblicklichen Lage missfielen, war die Tatsache, dass Bücher oder irgendein anderer Lesestoff – mit Ausnahme der Verkaufsprospekte von Tattersall – im Hause der Weltons Mangelware waren. Neugierig schlüpfte sie ins Innere des Raumes und ließ den Blick begehrlich über die kunstvoll verzierten ledernen Buchrücken wandern, während sie auf den großen alten Tisch zuging, der quer in der Mitte der Bibliothek stand.
Ein Stuhl mit hoher Rückenlehne war darunter hervorgezogen und dann nicht zurückgestellt worden, als habe sein Benutzer es eilig gehabt, diesen Ort zu verlassen. Auf dem Tisch stapelten sich mit Tinte bekritzelte Papiere, über die eine frisch gedruckte Europakarte ausgebreitet lag. Eines der Dokumente lugte weit genug unter der Landkarte hervor, dass Charlotte erkennen konnte, dass es auf Französisch abgefasst war.
Wie vom Donner gerührt blieb sie stehen. Ein dunkler Verdacht keimte in ihr auf und erfüllte sie mit heller Empörung. Warum unterhielt Pater Tarkin, der Abt – denn in dessen Zimmer musste sie sich befinden, da kein anderer Mönch in St. Bride’s so bedeutend war, dass er über eine eigene Bibliothek verfügte – Briefkontakt mit jemandem in Frankreich? England lag im Krieg mit Frankreich! Charlotte trat näher.
Der Name ihres Vaters sprang ihr ins Auge: Roderick Nash. Sie schob die Landkarte beiseite, nahm den Brief in die Hand und versuchte, ihn zu entziffern.
„Miss Nash?“
Erschrocken wirbelte sie herum und blickte geradewegs in das Gesicht von Pater Tarkin. Zuerst zitterte die Hand, in der sie den Brief hielt, dann jedoch siegte Charlottes rechtschaffene Wut über die Verlegenheit, welche sie darüber empfand, beim Durchstöbern fremden Eigentums ertappt worden zu sein. Sie war nicht diejenige, die gemeinsame Sache mit dem Feind machte! Sie war nicht diejenige, in deren Besitz sich ein vermutlich belastendes Dokument befand!
„Warum steht der Name meines Vaters in diesem Brief?“, fragte sie in scharfem Ton.
Pater Tarkin kam zu ihr heran und neigte den Kopf, um zu sehen, was sie in den Händen hielt. Der Ausdruck milder Neugier auf seinem Gesicht wich dem der Trauer.
„Ah! Dieser Brief stammt aus der Feder eines Mannes, der tief in der Schuld Ihres Vaters steht. Er erinnert mich in seinem Schreiben an die Opfer, die Ihr Vater und andere erbracht haben, damit er seine derzeitige Mission fortsetzen kann. Sehen Sie?“ Er streckte die Hand aus und fuhr mit seinem langen knochigen Zeigefinger behutsam über einige der Zeilen.
„Voller Hochachtung möchte ich Ihnen ins Gedächtnis rufen, Pater Abt, was Sie selbst sehr wohl wissen“, übersetzte er mit leiser Stimme, „dass nämlich alle großen Unternehmungen große Tribute erforderlich machen. Jene, die von mir verlangt werden und die Ihr Gewissen in letzter Zeit so arg zu belasten scheinen, sind nichts im Vergleich zu jenen, die andere erbracht haben. Denken Sie nur an das Opfer, das Colonel Roderick Nash erbracht hat, oder an die vielen namenlosen Männer und Frauen, die ihr Leben dafür gegeben haben, damit ich mein Werk fortführen kann …“ Der Abt brach mitten im Satz ab und lächelte Charlotte wie um Verzeihung bittend an. „Der Rest ist nicht für Ihre Ohren bestimmt, mein Kind.“
Mein Werk fortführen. Drei Jahre zuvor hatte sich ihr Vater freiwillig in die Gewalt der Franzosen begeben, im Austausch gegen drei junge Schotten, die er nicht einmal gekannt hatte und die als angebliche Spione im Kerker von LeMons schmachteten. Am Abend desselben Tages war er hingerichtet worden. Charlotte hatte stets angenommen, dass die Rückkehr der drei Überlebenden nach Schottland auch das Ende ihrer geheimnisvollen Verschwörung bedeutet hatte.
Die Erkenntnis, dass jemand das Werk fortführte, das die Schotten Jahre zuvor in Frankreich begonnen hatten, traf sie mit nahezu fühlbarer Wucht. Und dieser ersten Erkenntnis folgte sogleich eine zweite. Es verwunderte Charlotte nicht, dass dieser scharfäugige Abt mit dem freundlichen Gesicht etwas damit zu tun hatte, denn schließlich stammten alle der damals beteiligten jungen Männer aus St. Bride’s.
„Ich bin kein Kind, Pater“, entgegnete sie mit einer Ernsthaftigkeit, die ihr kaum jemand, der sie kannte, zugetraut hätte. „Und wenn mein Vater sein Leben für ein Werk geopfert hat, wie der Verfasser dieses Briefes andeutet, dann muss ich Ihnen widersprechen. Das alles geht mich sehr wohl etwas an.“
Der Abt schüttelte den Kopf. „Nur im allerweitesten Sinn.“
Charlotte runzelte die Stirn, nicht sicher, ob sie sich mit der Antwort begnügen sollte. Doch aus den Zeilen, die Pater Tarkin für sie übersetzt hatte, hatte so viel Überzeugung gesprochen, so viel Entschlossenheit, dass sie Charlotte nicht mehr aus dem Kopf gingen. Auf schmerzliche Weise riefen sie ihr abermals die tragischen Umstände des Todes ihres Vaters ins Gedächtnis zurück.
Allem Anschein nach war seine Tat ein selbstloser Akt des Edelmuts gewesen, doch es hatte Charlotte stets betrübt, dass sein Opfer keine größere Bedeutung gehabt, dass er sein Leben für eine misslungene Verschwörung hingegeben hatte. Und hier war nun der Beweis, dass die Mission jener drei jungen Männer noch nicht beendet war, dass der Opfergang ihres Vaters es möglich gemacht hatte, ein wichtiges Werk fortzuführen. Das zumindest legte der Inhalt dieses Briefs nahe.
Mit einem Male verspürte Charlotte den brennenden Wunsch, selbst etwas dazu beitragen zu können, dass der Tod ihres Vaters nicht vergeblich gewesen war.
„Ich kann helfen.“ Die Worte hallten in der Stille der klösterlichen Bibliothek wider.
„Mein liebes Kind, ich weiß beim besten Willen nicht, worauf Sie hinaus wollen …“
„Ich könnte mich nützlich machen, wenn Sie es mir nur erlaubten.“ Ihre leisen Worte brachten den Abt zum Schweigen. Sie schaute ihm in die Augen. Der alte Mann runzelte die Stirn.
„Was glauben Sie zu wissen, Miss Nash?“, fragte er schließlich und bedeutete Charlotte mit ausnehmender Höflichkeit, auf dem Lehnstuhl Platz zu nehmen.
Sie war zu angespannt, um sich zu setzen. „Was auch immer die Mission dieser jungen Schotten in Frankreich gewesen sein mag, sie ist noch nicht beendet. Ich möchte dazu beitragen, sie zum Abschluss zu bringen. Ich muss helfen!“
Der Abt widersprach ihrer Vermutung nicht, sondern neigte den Kopf und betrachtete Charlotte prüfend. „Und warum müssen Sie helfen?“
„Um meinem Leben einen Sinn zu geben. Um dem Tod meines Vaters einen Sinn zu geben. Um dafür zu sorgen, dass sein Opfer nicht vergeblich war.“
Die Miene des Abtes verdüsterte sich. „Dass er das Leben dieser drei jungen Männer gerettet hat, ist in Ihren Augen nicht Sinn genug?“
„Nein.“
Pater Tarkin hob die silbergrauen Brauen. Verwunderung und Schmerz sprachen aus seinem Blick, während er Charlotte eindringlich betrachtete.
„Nein“, wiederholte sie entschlossen und dachte dabei an den Mann, der in so bewegenden Worten vom Opfertod ihres Vaters geschrieben hatte. Er würde sie gewiss verstehen. „Nicht, wenn es von so viel größerer Bedeutung sein könnte. Wenn jemand in Frankreich durch die edle Tat meines Vaters in die Lage versetzt worden ist, sein Werk fortzuführen, dann will ich ihn unterstützen, es zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Das bin ich dem Andenken meines Vaters schuldig. Und das bin ich meinem Land schuldig.“ Sie bemerkte den Zweifel in Pater Tarkins Blick und suchte nach Worten, die den Abt überzeugen würden. „Das bin ich mir selbst schuldig!“
Auge in Auge standen sie einander gegenüber, in stumme Zwiesprache versunken.
„Es könnte da etwas geben …“, sagte der Abt schließlich gedankenverloren, wobei er sacht mit den Fingern auf die Tischplatte trommelte.
„Ich bin zu allem bereit.“
„Von Zeit zu Zeit“, begann er zögernd, „treffen Boten in London ein, deren Nachrichten weitergeleitet werden müssen. Sie legen oft weite Reisen auf verschlungenen Pfaden zurück, und es ist bisweilen schwer einzuschätzen, wann sie ankommen oder wo. Gewisse Individuen, die in Erfahrung bringen wollen, welche Nachrichten diese Boten überbringen, und deren Ziele den unseren völlig zuwiderlaufen, durchkämmen die Stadt auf der Suche nach der Person, die besagte Nachrichten erhält. Sie werden dann an unsere Freunde in London weitergeleitet. Aus diesem Grund darf der Empfänger der Nachrichten nie zu lange an einem Ort verweilen, muss sein Domizil häufig wechseln und dabei jedes überflüssige Aufsehen vermeiden.“
Er hielt inne, und Charlotte deutete sein Schweigen als eine Art Prüfung, um herauszufinden, ob sie den tieferen Sinn seiner Worte begriffen hatte.
„Ich nehme an“, begann sie vorsichtig, „dass es durch den ständigen Wohnungswechsel des Empfängers und die Tatsache, dass er nie genau weiß, wann der Kurier eintrifft, schwierig ist, ein Treffen der beiden zu arrangieren.“
Der Abt nickte. Sie hatte die Prüfung bestanden. „Letztes Jahr ist es dem Kurier aus Frankreich nicht gelungen, seine Nachrichten weiterzugeben, obwohl er einzig zu diesem Zweck nach England gekommen war. Er hatte nur wenig Zeit, bis man ihn in Frankreich vermissen würde, und der Empfänger war gerade umgezogen.“
„Ein Mittelsmann“, fuhr Charlotte fort, „würde die Angelegenheit erleichtern. Eine Person, die beide Männer leicht ausfindig machen könnte. Besonders, wenn es sich bei dieser Person um jemanden handelte, den kein Mensch mit etwas Derartigem in Verbindung bringen würde“, ergänzte sie. „Ein junges, lebenslustiges Persönchen, ohne politische oder religiöse Bindungen, eine leicht zu treffende Person, die stets im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, sei es auf einem Ball, einer Gala, einem Empfang oder an sonst einem Ort, wo man sich ihr nähern kann, ohne Verdacht zu erregen.“
„Sie denken an eine weibliche Person?“
„Ja, an mich, um genau zu sein“, entgegnete Charlotte. „Ich wäre die ideale Besetzung für diese Funktion, Pater Abt. Ich genieße eine Freiheit, derer sich nur wenige junge Damen erfreuen. Ich bewege mich in den unterschiedlichsten Kreisen, und ich kann kommen und gehen, wann und wohin ich will, ohne damit Anlass zu Bemerkungen zu geben.“ Sie verzog die Lippen. „Nun, jedenfalls zu keinen, an die ich mich noch nicht gewöhnt hätte.“
Der Abt wandte sich von ihr ab, senkte nachdenklich den Kopf und ging, die schwieligen Hände hinter dem Rücken verschränkt, auf das Bücherregal am anderen Ende des Raumes zu. Charlotte wagte kaum zu atmen, während sie ihm mit den Augen folgte.
Erst jetzt, da sich ihr die Möglichkeit bot, etwas für das Andenken ihres Vaters zu tun, wurde ihr bewusst, wie wichtig ihr dies war. Der Abt durfte sie nicht abweisen! Die nächsten Minuten würden zeigen, ob er die lebenslustige junge Müßiggängerin in ihr sah, für die alle Welt sie hielt, oder die nüchterne, entschlossene junge Frau, als die sie selbst sich einschätzte.
„Es muss nicht besonders gefährlich sein“, murmelte er.
Charlotte wartete.
Er sah über die Schulter hinweg zu ihr herüber, einen sorgenvollen Ausdruck auf dem zerfurchten Gesicht. „Sie brauchen sich nur ein paar Anschriften einzuprägen und diese auf einem Ball oder einer ähnlichen Veranstaltung im Vorübergehen zu wiederholen.“
Sie nickte eifrig.
„Unsere Verschwörergruppe ist sehr klein. Man würde höchstens zwei- oder dreimal im Jahr an Sie herantreten.“
„Ich verstehe.“
Er wandte sich um und blickte ihr geradewegs in die Augen. „Nicht besonders gefährlich und nicht gefährlich ist allerdings keineswegs dasselbe. Ein gewisses Risiko wäre in jedem Fall dabei.“
„Ich bin bereit, es einzugehen.“
„Doch bin ich bereit, es Ihnen aufzubürden?“
Sie nahm ihm die Antwort ab. „Ja.“
Der Abt versank in nachdenkliches Schweigen, und Charlotte unterbrach seine Gedanken nicht, denn sie wusste, dass es ein Fehler wäre, ihn jetzt zu bedrängen. Schließlich stieß er einen tiefen Seufzer aus. „In Ordnung, Miss Nash. In Ordnung.“
Ein Lächeln erschien auf Charlottes Lippen. „Vielen Dank.“
„Nein, mein Kind. Danken Sie mir nicht. Ich wandle auf einem schmalen Grat, und mein Gewissen plagt mich unaufhörlich.“ Mit einem abermaligen Seufzer streckte er die Hand nach einem dicken, in Leder gebundenen Buch aus, das in einem Regal über seinem Kopf stand. „Aber da es nun beschlossene Sache ist, dass Sie die Rolle der Vermittlerin spielen werden, können Sie ebenso gut einen meiner Agenten kennenlernen: den Verfasser dieses Briefs.“
Er zog mit einem kräftigen Ruck an dem Buch, das er umschlossen hielt. Charlottes Augen weiteten sich vor Staunen, als sich ein Teil des Regals wie von Geisterhand öffnete und den Blick auf einen Geheimgang freigab, der von einer einzigen Laterne spärlich erhellt wurde.
„Kommen Sie“, rief der Abt.
Charlottes Herz pochte heftig. Sie war im Begriff, dem Mann zu begegnen, der so lange standgehalten hatte – und der die Mission fortsetzte, die vor so vielen Jahren begonnen worden war. Ein Mann von innerer Überzeugung und tiefer, unerschütterlicher Loyalität. Für Charlotte war er bereits ein edler Held, auch wenn die Jahre der Arbeit im Untergrund und in steter Gefahr ihn gewiss hart und misstrauisch hatten werden lassen …
„Kein Grund, so zu brüllen, Pater!“ Ein junger Mann trat aus dem Halbdunkel. Sein schmales, markantes Gesicht wurde von ungewöhnlich langem braunem Haar umrahmt, und die gefährlich aussehende Narbe auf seiner linken Wange verschwand beinahe unter einem dunklen Stoppelbart. Er trug ein schmutziges Hemd, sein weiter Mantel war an den Ärmelaufschlägen zerschlissen, und die Hosen, die sich um seine schmalen Hüften und den flachen Bauch schmiegten, wirkten auf seltsame Weise unanständig. In seinem sonnengebräunten Gesicht blitzte ein Lächeln auf.
„Das ist … Dand Ross“, sagte Pater Tarkin und blickte Charlotte erwartungsvoll an.
Sie hätte ihn nicht als einen der drei jungen Schotten wiedererkannt, die vor drei Jahren ins Haus ihrer Eltern nach York gekommen waren. Doch damals hatte sie nur Augen für Ramsey Munro gehabt, der ihr erschienen war wie ein dunkler Engel und der noch dazu gerade erst aus fast zweijähriger Gefangenschaft in einem französischen Kerker befreit worden war.
Dieser Mann hier wirkte geradliniger, hagerer, beunruhigender. Als ihre Blicke sich trafen, gefror das Lächeln auf seinen Lippen. Charlotte verspürte ein seltsames Flattern in der Herzgegend, so, als schlügen Flügelschwingen wie rasend gegen ihre Rippen. Sie trat unwillkürlich einen Schritt vor und öffnete den Mund. Um zu lächeln? Um ihn zu begrüßen?
In den rauchigen Tiefen seiner Augen flackerte etwas auf.
„Nun, was haben wir denn da?“, fragte er gedehnt. „Ich wusste gar nicht, dass Sie neuerdings auch weibliche Waisenkinder aufnehmen, Pater. Doch offenbar ist das der Fall, denn warum sonst würde dieses arme Ding ein Kleid tragen, das ihm mindestens zwei Nummern zu klein ist und so fadenscheinig, dass man hindurchsehen kann?“
So viel zum Thema edler Held, dachte Charlotte.
***
Frankreich, Spätherbst 1788
„Muss ich wirklich mit Mr. Johnstone gehen, Madame?“, fragte der Junge, den Blick auf seinen englischen Hauslehrer gerichtet. In seiner Stimme lag keine Furcht, doch auch keine echte Hoffnung darauf, seine Mutter von ihrem Vorhaben abbringen zu können. Jeremy Johnstone wusste den Versuch seines Zöglings dennoch zu würdigen.
„Ja. Es ist alles vorbereitet.“ In den Worten der Dame im Samtkleid schwang nicht der Hauch einer mütterlichen Regung mit. Sie legte die Hände auf die Schultern des Knaben und blickte über dessen Kopf hinweg in Jeremys Gesicht. „Er ist ein kluger Junge und sehr reif für sein Alter. Er wird Ihnen nicht zur Last fallen.“
Sie spähte unentwegt über die Schulter und verriet damit, dass sie es kaum erwarten konnte, den Handel zum Abschluss zu bringen und sich von dem Knaben zu verabschieden.
„Ich werde mit meinem Leben für seine Sicherheit einstehen, Madame. Ihr Vertrauen ehrt mich sehr.“ Jeremy verneigte sich tief über die ausgestreckte Hand der Dame. Nie zuvor war er seiner Dienstherrin so nahe gewesen. Seit er vor drei Jahren nach Frankreich gekommen war, um sich der Erziehung ihres kleinen, bescheiden wirkenden Sohnes anzunehmen, hatte ihre Kommunikation in dem großen Haushalt stets über Dritte stattgefunden.
Er betrachtete sie verstohlen und versuchte, Ähnlichkeiten zwischen Mutter und Sohn zu entdecken. Doch es gab nur wenige. Ihr Gesicht war rundlich und hübsch, aber in ihrem Ausdruck lag eine eiserne Entschlossenheit, die sich noch nicht in den kindlichen Zügen ihres Sohnes wiederfand.
Er war ein braver, aufgeweckter Junge und ein geborenes Sprachtalent. Bereits jetzt konnte er sich ohne jeden Akzent auf Englisch verständigen. Jeremy mochte ihn nicht nur, er bewunderte ihn auch ob seiner inneren Stärke. Die tapfere Gefasstheit, die sein Zögling angesichts derart großer Umwälzungen an den Tag legte, rührte ihn zutiefst.
Er vermutete, dass die Umwälzungen – nur wenige Wochen zuvor war Grenoble von Aufständen erschüttert worden – der Grund dafür waren, dass diese Dame aus dem Hochadel beschlossen hatte, ihren einzigen Sohn zu Freunden nach Schottland zu schicken, bis sich die Lage in Frankreich wieder beruhigt hatte. Jeremy wusste, dass der Junge klaglos tun würde, was seine Mutter verlangte. Der Kummer auf seinem Gesicht war jedoch nicht zu übersehen. Er würde alles zurücklassen müssen, was ihm lieb und vertraut war. Jeremy empfand Mitleid mit ihm. „Ähm.“
Die Dame löste den Blick von ihrem Sohn und schaute ihn kühl an. „Was gibt es, Master Johnstone?“
„Vielleicht ist dies gar nicht nötig, Mylady? Der König wird sicher …“
„Der König ist ein Narr, und seine Gemahlin übertrifft ihn noch an Torheit. Dies wird kein gutes Ende nehmen, und wenn Seine Majestät sich weigert, zur Kenntnis zu nehmen, was in meinen Augen offensichtlich ist, werde ich meinen Sohn nicht seiner Blindheit opfern. Nein! Der Junge geht nach Schottland.“
„Sehr wohl, Madame.“ Jeremy verbeugte sich erneut tief.
Seine adlige Dienstherrin vollführte eine ungeduldige Handbewegung, und sofort kam einer der im Hintergrund wartenden Lakaien mit einem prall gefüllten Geldbeutel herbeigeeilt. Sie nahm den kleinen Sack aus Samt in Empfang und reichte ihn an Jeremy weiter. „Das dürfte mehr als genug sein für meinen Sohn und Sie. Darin befindet sich außerdem ein Brief an meine Freunde, in dem ich sie bitte, sich meines Kindes anzunehmen. Ich vertraue Ihnen dieses Schreiben an mit dem ausdrücklichen Wunsch, es meinen Freunden in Schottland auszuhändigen, wenn Sie meinen Sohn zu ihnen bringen.“ Zum ersten Mal huschte ein Ausdruck der Besorgnis über ihre glatte Stirn. „Ich wünschte, ich hätte Zeit gehabt, sie von meinen Absichten zu unterrichten, doch … die Lage wird von Tag zu Tag heikler. Ich wage nicht, noch länger zu warten.“
Sie beugte sich hinab, bis ihr Gesicht auf gleicher Höhe mit dem ihres Sohnes war. Standhaft erwiderte der Junge ihren Blick. Sie berührte seine Schulter, und als der Knabe sich kaum merklich vorbeugte, erkannte Jeremy, wie gern sein Zögling sich in die Arme seiner Mutter geschmiegt hätte. Doch er tat es nicht und blieb stattdessen schweigend stehen.
„Vergiss nicht, wer du bist, mein Sohn. Vergiss niemals, wer du bist oder was von dir erwartet wird.“
„Nein, Madame“, versprach er feierlich. „Das werde ich nicht.“
1. Kapitel
Culholland Square, Mayfair
14. Juli 1806
„Nun, Mr. Robinson, wenn Sie Ihren Blick ausnahmsweise einmal von meinem Dekolleté lösen könnten, um mir ins Gesicht zu sehen, würde es Ihnen gewiss leichter fallen zu erraten, was ich bei unserem Spiel nachahme“, sagte Charlotte. Der rotschopfige junge Mann, Erbe eines riesigen, durch Handel erworbenen Vermögens und seit einer Woche stolzer Träger eines Adelstitels, den er allerdings, so munkelte man, auf nicht ganz einwandfreie Weise erworben hatte, errötete bis zu den Haarwurzeln.
Charlotte kannte kein Erbarmen. Der mehlgesichtige Emporkömmling hatte ihr auf den Busen gestarrt, seit er in Begleitung der jungen Leute eingetroffen war, die Charlotte zu Gesellschaftsspielen und Erfrischungen in ihr Stadthaus eingeladen hatte – ihr erstes ‚Zuhause’, seit sie sich im vornehmen Londoner Stadtteil Mayfair niedergelassen hatte. Ein skandalöser Schritt, denn sie war unverheiratet und lebte allein.
Da Lady Welton als Anstandsdame zugegen war, ging alles höchst sittsam und schicklich zu, auch wenn sie bereits vor Stunden an einem sonnigen Fleckchen eingedöst war. Wenigstens hatte es sittsam und schicklich zugehen sollen, verbesserte Charlotte sich im Stillen, nachdem ihr Gewissen sich zu Wort gemeldet hatte. Allerdings war offenbar nie etwas, das sie tat, so schicklich, wie man es angesichts ihrer Herkunft, ihrer reizenden Art und ihres vornehmen Umgangs hätte vermuten sollen, denn schließlich war sie die Schwägerin von Ramsey Munro, Marquis of Cottrell, und des berühmten Colonel Christian MacNeill. Und genau das machte einen Großteil ihrer Anziehungskraft aus, wie Charlotte völlig richtig erkannte. In ihrem charmanten Kreis konnten Dinge gesagt werden, die man anderswo nicht zu äußern wagte, die Kleider der Damen waren modischer und eine Spur gewagter als üblich. Bisweilen wurden ein paar Takte des berüchtigten Walzers vorgeführt, es wurde viel gelacht, und Charlotte brachte ihre Verehrer regelmäßig mit schlagfertigen Antworten in Verlegenheit, wozu den meisten anderen jungen Mädchen der Mut fehlte. Ihre Zurechtweisung des glotzäugigen Mr. Robinson entlockte den weiblichen Gästen ein glucksendes Kichern, während die männlichen Besucher in schallendes Gelächter ausbrachen.
„Verzeihung, ich weiß gar nicht, wo ich mit meinen Gedanken war“, stammelte Mr. Robinson.
„Denken ist in diesem Fall wohl nicht ganz der passende Ausdruck, finden Sie nicht?“, fragte Charlotte in zuckersüßem Ton, womit sie abermals für lautstarke Belustigung bei den Zuhörern sorgte. „Kommen Sie, mein Freund, lassen Sie uns einmal üben, wie man einer Dame ins Gesicht schaut. Nein, nein, nein, nicht nur auf meine Lippen, auf mein ganzes Gesicht! Sehen Sie? Zwei Brauen, ein Augenpaar von seltsamer Farbe, eine gewöhnliche Nase und ein etwas zu energisches Kinn. Ah, so ist es gut. Na also, es geht doch.“
Die Damen und Herren, die allesamt als die leichtlebigsten jungen Leute der feinen Gesellschaft galten, applaudierten wohlwollend. Und Mr. Robinson, ebenso fest dazu entschlossen, in ihren Kreis aufgenommen zu werden, wie dazu, Miss Nash zu gefallen, brachte genug Selbstbewusstsein auf, um über sich selbst zu lachen und sich vor Charlotte und den anderen zu verbeugen.
Nach diesem Intermezzo widmeten sich ihre Gäste wieder dem Scharadenspiel, und Charlotte, der aufgefallen war, dass die gläserne Schüssel mit der Punschbowle sich bedenklich geleert hatte, ging hinaus, um nach einem Dienstmädchen Ausschau zu halten. Sie war nicht weiter als bis zur Küchentür gekommen, als eine männliche Stimme in atemlosem Ton nach ihr rief.
Sie wandte sich um, nur allzu gut wissend, was sie erwartete. Doch es war nicht Mr. Robinson. Es war Lord LeFoy. Der hochgewachsene, rotblonde Lord LeFoy. Nun, das war in der Tat eine Überraschung! Sie hatte geglaubt, er hätte um ein Haar um die Hand der jungen Miss Henley angehalten.
„Miss Nash“, flüsterte er, während er mit ausgestreckten Armen auf sie zukam. Charlotte wartete höflich. Um nicht ins Leere zu greifen, ließ er die Hände sinken, da Charlotte keinerlei Anstalten machte, ihm die ihren zu reichen.
„Ja?“
„Ich muss einen Augenblick Ihrer Zeit in Anspruch nehmen.“
„Ja.“
„Allein.“
Sie ließ den Blick vielsagend durch den menschenleeren Flur wandern.
„Ja.“
Er runzelte die Stirn. Offenkundig nahmen die Dinge einen anderen Verlauf, als er es sich erhofft hatte. Armer Lord LeFoy! Doch wenn es um Charlotte und die Männer ging, nahmen die Dinge meistens einen anderen Verlauf als erhofft. Jedenfalls für die Männer.
„Sie wünschen, mir etwas vertraulicher Natur mitzuteilen?“, half sie ihm auf die Sprünge.
„Jawohl“, erwiderte er heftig nickend. „Jawohl. Ich … ich …“
„Ja?“
„Ich bete Sie an!“
„Ah.“
Er griff nach Charlottes Hand, hob sie an seine Lippen und drückte einen glühenden Kuss auf den zarten Stoff ihres Handschuhs. „Ich bin Ihr ergebener Diener. Verlangen Sie von mir, was Sie wollen, ich werde es tun. Ich stehe Ihnen mit Leib und Seele zur Verfügung. Ich bete Sie an, mein Engel, meine Teufelin.“
„Wie Luzifer?“, fragte Charlotte und ließ die Hand wie ein lebloses Stück Fleisch in der seinen ruhen. Ihn zu ermutigen, wäre wirklich zu grausam, und ihr haftete ohnehin bereits der Ruf an, herzlos zu sein. Außerdem mochte sie die Henleys. Die Heirat ihrer Tochter mit Lord LeFoy würde sie von vielen Sorgen befreien.
„Äh?“ Lord LeFoy blinzelte wie eine alte Eule.
„Engel und Teufel. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es nur ein Wesen, das beide in sich vereint, und das ist Luzifer.“
„Ah! Ja. Nein. Ich wollte sagen, dass Sie ein Engel sind, dass mich Ihre Engelsgleichheit jedoch verhext, teuflisch verwirrt.“ Er schien recht zufrieden mit seiner Erklärung. „Sie müssen die Meine werden!“
„Du liebe Güte. Machen Sie mir etwa einen Antrag, Lord LeFoy? Das wäre mir nämlich, mit Verlaub, gar nicht recht. Ich mag Sie, verstehen Sie? Und ich würde Ihnen arge Kopfschmerzen bereiten, wenn es zu einer Hochzeit kommen sollte.“ Als sie den verständnislosen Ausdruck auf seinem Gesicht sah, seufzte sie leise.
„Erlauben Sie, dass ich Ihnen meine Untugenden aufzähle“, bat sie freundlich. „Ich bin von Natur aus kein treuer Mensch. Eifersucht und Besitzdenken jeglicher Art sind mir ein Gräuel. Vermutlich würde ich heftig und auf skandalöse Weise reagieren, falls ich damit belästigt würde. Außerdem liebe ich den Luxus, und mein Unterhalt wäre zweifellos eine höchst kostspielige Angelegenheit. Und schließlich habe ich weder im Augenblick noch in absehbarer Zukunft den Wunsch, Nachkommen in die Welt zu setzen.“ Sie setzte ein entzückendes Lächeln auf.
Lord LeFoys ohnehin große Augen wurden noch größer. Charlotte konnte förmlich sehen, wie sein Verstand versuchte, die Oberhand über seine Gefühle zu gewinnen. Doch wenn es einen Mann heftig nach etwas oder jemandem verlangt, zieht die Vernunft meist den Kürzeren.
„Das ist mir gleich. Ich vergöttere Sie!“
„Natürlich tun Sie das“, entgegnete Charlotte und tätschelte seine Hand, die noch immer ihre Rechte umklammert hielt. „Doch es kommt nicht darauf an, was Sie fühlen, sondern darauf, was das Beste für Sie ist. Ich könnte es nicht ertragen, wenn Ihre Verehrung sich in Verdruss verwandelte. Verdrossene Menschen ermüden mich. Und sie würde sich in Verdruss verwandeln. Und Ihr Vater …?“ Die Vorstellung, der lüsterne alte Earl of Mallestrough könne ihr Schwiegervater werden, entlockte Charlotte ein Lachen. „Vermutlich müsste ich jedes Mal, wenn Sie aus dem Haus gingen, meine Schlafzimmertür vor ihm verriegeln. Keine guten Voraussetzungen für trautes Eheglück, finden Sie nicht auch?“
Bei der Erwähnung seines Vaters erstarrte Lord LeFoy. Doch er achtete Charlotte genug, um ihrer Einschätzung seines alten Herrn nicht zu widersprechen.
„Nein, nein“, fuhr sie fort. „So, wie es jetzt ist, ist es für uns beide am besten. Sie beten mich an, und ich sonne mich in Ihrer Verehrung. Sehr romantisch. Und viel zivilisierter, denn auf diese Weise braucht weder Ihre Zuneigung zu mir noch mein Genießen derselben Einfluss auf unser Leben zu nehmen. Sie werden Maura Henley heiraten, die eine reizende Braut und eine gute Mutter Ihrer Kinder sein wird. Sie wird niemals Ihre Siebensachen aus Ihrem Zimmer schleudern noch Ihnen eine Szene bei Almack′s machen. Sie werden sehr glücklich sein. Um meiner Eitelkeit willen bitte ich Sie jedoch, dann und wann sehnsuchtsvoll zu seufzen, wenn wir einander in der Öffentlichkeit begegnen, damit ich mich daran erfreuen kann.“
„Sie würden mir eine Szene bei Almack′s machen?“, flüsterte er entsetzt.
„Oh, das ließe sich früher oder später nicht vermeiden, glauben Sie nicht?“, fragte sie zuckersüß und neigte in gespielter Unschuld den Kopf.
Der junge Lord ließ ihre Hand los. „Bei Gott, ja. Das würden Sie tun. Das werden Sie tun!“
„Nun, bevor die anderen sich fragen, was Sie und ich wohl die ganze Zeit hier draußen treiben, sollten Sie besser wieder hineingehen, während ich mich um die Punschbowle kümmere“, sagte sie vergnügt.
Er schluckte, wandte sich ab, zögerte und drehte sich dann abermals zu ihr um. „Äh … danke, Miss Nash. Sie sind eine sehr … vernünftige Frau.“
Sie beugte sich zu ihm und flüsterte: „Erzählen Sie das bitte niemandem.“
Lord LeFoy nickte, ebenso begierig darauf, sich zu verabschieden, wie er einige Minuten zuvor gewesen war, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Die Augen gen Himmel gerichtet, murmelte sie ein Dankgebet, als ihr abgewiesener Verehrer mit hastigen Schritten im Empfangszimmer verschwand.
Charlotte wollte ihren Weg in die Küche soeben fortsetzen, als ihr Dienstmädchen erschien, eine kecke, gescheite junge Frau namens Lizette. „Ich bitte um Verzeihung, Miss Nash, doch da ist ein … Mann, der darauf besteht, Sie zu sehen.“
Ein Mann. Kein Gentleman. Und kein Hausierer, denn um den hätte Lizette sich selbst gekümmert. Charlottes Neugier war geweckt.
„Wer ist dieser Mann?“
„Er sagt, er sei ein Diebesfänger, Miss Nash, und bringe Nachrichten bezüglich einiger Schmuckstücke, die er wiederbeschafft habe.“ Lizette verzog bestürzt das hübsche runde Gesicht, während sie ihr Gedächtnis nach Erinnerungen an abhandengekommene Pretiosen durchforstete. Sie wurde nicht fündig, was zweifelsohne daran lag, dass ihre Dienstherrin kein einziges Geschmeide vermisste. Charlottes Herz pochte mit einem Male heftiger, und sie spürte, wie ihr ein Schauder den Rücken hinablief.
„Wo ist er?“
„Ich wusste nicht recht, wohin mit ihm, also habe ich ihn ins Damenzimmer gebeten, Miss.“
„Sehr gut“, entgegnete Charlotte. „Erklären Sie meinen Gästen bitte, dass ich eine Weile fort sein werde.“
Mit diesen Worten wandte sie sich ab und ging den Flur entlang, bis sie vor der Tür des Damenzimmers stand. Ein letzter tiefer Atemzug, dann drückte sie die Klinke hinunter und trat ein.
Ihr Herz klopfte noch immer wie rasend.
***
„Diebesfänger?“ Charlotte ging belustigt um ihren Lieblingssessel herum, auf dem Dand Ross sich ungeniert flegelte, die Beine von sich gestreckt, die schweren Stiefelabsätze auf die blitzblanke Oberfläche ihres mit Einlegearbeiten verzierten Lieblingstisches gelegt. Sein unerwarteter Besuch erfüllte sie mit freudiger Erregung, doch das würde sie ihm natürlich niemals sagen. Er würde sich etwas einbilden darauf oder, schlimmer noch, es amüsant finden. Dass sie so empfand, lag nur an jener Aura der Verwegenheit, die ihn stets umgab.
Charlotte hatte nicht geahnt, dass der Ruch der Verwegenheit so … anziehend auf sie wirken würde, als sie in Dand Ross′ Schattenwelt eingetaucht war. Doch sie konnte diesen Reiz weder leugnen noch ihm widerstehen. Niemals jedoch würde sie ihm zu erkennen geben, wie sehr sie sich auf seine unangemeldeten Besuche freute.
Sie legte nachdenklich einen ihrer tadellos manikürten Fingernägel an die Lippen, als brüte sie über einem Scherzrätsel, beugte sich dann vor und zog kaum merklich die Nase kraus. Eine plötzliche Eingebung ließ ihr Gesicht erstrahlen. „Ich hab’s! Lizette muss Sie missverstanden haben. Sie haben bestimmt Rattenfänger gesagt.“
Er hob die Lider mit den dichten braunen Wimpern und sah zu ihr auf. „Wissen Sie, Charlotte“, bemerkte er versonnen, „heutzutage trägt man tatsächlich Mieder in Paris, statt lediglich eine solche Möglichkeit gutzuheißen.“
Sein Blick wanderte zu ihrem gewagten Dekolleté hinab, dann hob er den Kopf und schaute ihr geradewegs in die Augen. Sie erwiderte seinen Blick mit vollendetem Gleichmut. Falls er erwartet hatte, sie in Verlegenheit zu bringen, hatte er sich getäuscht. Mehr Männer, als Charlotte zählen konnte, hatten ihr auf den nicht einmal besonders üppigen Ausschnitt gestarrt, ohne dass ihr auch nur die zarteste Röte in die Wangen gestiegen war.
Außerdem hatte Dand Ross sie seit ihrer ersten Begegnung und den Dutzenden von Treffen danach des Öfteren mit gespieltem Verlangen geneckt, seinen kühnen Worten jedoch nie Taten folgen lassen. Er war ein vollendeter Profi: unnahbar, spöttisch, unverbindlich.
Sie betrachtete ihn aufmerksam, während er ein Glas Rotwein leerte. Die Jahre hatten auch ihn stattlicher, kräftiger und härter werden lassen, doch er besaß noch immer diese lockere, lässig-geschmeidige Anmut, die man bei mancher Katze beobachten konnte.
Schwarzbraunes Haar, verwegen blickende braune Augen, ein schmales Gesicht mit breitem Mund und wohlgeformten Lippen sowie ein kantiges Kinn, das zurzeit unter einem dichten Bart verborgen war, ebenso seine Narbe – all das erinnerte an einen Piraten. Auch wenn Dand mit Nachdruck behauptete, diese Narbe sei die Folge eines Sturzes von der Leiter beim Äpfel Stehlen und nicht etwa die eines Duells, wie Charlotte zunächst vermutet hatte.
Sollte sie ihm das abnehmen? Charlotte war nicht sicher, was sie tatsächlich über Dand wusste und was er lediglich versuchte, sie glauben zu machen. Seine eigenen Ansichten und Gefühle – falls er welche hatte – hielt er sorgsam verborgen.
„Tatsächlich?“, entgegnete sie in zuckersüßem Ton. „Nun, wir befinden uns im Krieg und sind durch Napoleons Seeblockade von unseren Handelspartnern in Übersee abgeschnitten. Ich betrachte es daher als meine patriotische Pflicht, dafür zu sorgen, dass mein Schneider unsere Wirtschaft nicht über Gebühr durch verschwenderischen Gebrauch von Stoff belastet.“
„Welch beeindruckende Vaterlandsliebe, Charlotte“, entgegnete Dand trocken. „Ihre Opfer machen mich sprachlos. Oder sollte ich ‚Opfer‘ besser in der Einzahl benutzen? Es hat nicht den Anschein, als ob Sie auf allzu viele Annehmlichkeiten verzichten würden.“
Sein spöttischer Blick schweifte durch den geschmackvoll eingerichteten Salon, wanderte über die schieferblauen Wände und das kostbare Mobiliar: die zierlichen, mit blauer Seide bezogenen Polstersofas mit ihren schönen kannelierten Beinen, die eleganten Sessel, die mit edlem, jonquillefarbenem Brokat bezogenen Kissen. Schließlich fesselte ein üppiger Strauß gelber Rosen und weißer Gardenien, der in einer riesigen chinesischen Vase auf einem mit Japanlack überzogenen Beistelltisch stand, seine Aufmerksamkeit.
„Gelbe Rosen?“
„Sie erkennen sie wieder.“
„Oh ja.“ Seine Stimme klang leise. „Ich habe sie mit meinem Blut genährt. Woher haben Sie sie?“
„Sie stammen aus dem Rosenstock, den Sie und Ihre Gefährten uns vor so vielen Jahren mitbrachten. Ich habe Ableger davon aus York mit nach London genommen, damit sie mich an die guten alten Tage erinnern. Zuerst ins Stadthaus der Weltons und nun hierher“, erklärte Charlotte. „Sie sollten einmal sehen, welches Aufsehen ich errege, wenn ich sie im Haar trage oder jenes Kleidungsstück mit ihnen schmücke, das ich – offenbar zu Unrecht – für mein Mieder halte.“ Sie lächelte schelmisch. „Ich mag es, auf diese Weise Aufmerksamkeit zu erregen. Außerdem passen sie zur Dekoration“, fügte sie hinzu und ließ den Blick zufrieden durchs Zimmer schweifen.
„Neue Anschrift, neue Wandfarbe, neue Möbel“, murmelte Dand, während er ihrem Blick folgte. „Man muss sich allerdings fragen, ob sich das schickt: eine junge Frau, die allein lebt …“
„Oh, vermutlich nicht“, entgegnete Charlotte schlagfertig. „Doch was kümmern mich Schicklichkeit und Anstand, wenn sie mich nur einschränken und daran hindern, Ihnen und Ihren Verbündeten so nützlich zu sein, wie ich es jetzt bin, nämlich allein?“
„Was für ein praktisch denkendes Mädchen Sie doch sind, Charlotte. Aus Ihnen ist eine ziemlich resolute junge Dame geworden, nicht wahr?“
„Ich hoffe es.“
„Und wie viele Herzen haben Sie diese Woche gebrochen, grausame kleine Miss Nash?“, entgegnete er mit einem Grinsen.
„Herzen?“ Sie überlegte. „Keines. Stolz? Den des einen oder anderen Verehrers gewiss.“
„Arme Kerle.“ Dand stellte das Weinglas zu seinen Füßen ab, lehnte sich zurück und wippte auf den hinteren Stuhlbeinen, die Hände über dem flachen, muskulösen Bauch verschränkt.
Nach all diesen Monaten kam Charlotte noch immer nicht über die erstaunliche Tatsache hinweg, dass er einer von Englands besten Geheimagenten war. Es erschien ihr so unwahrscheinlich. Verrufen, gewissenlos und gefährlich – sie konnte nicht glauben, dass der erste Eindruck, den sie damals in Pater Tarkins Bibliothek von ihm gewonnen hatte, so falsch gewesen war.
Damals hatte es einen Moment gegeben, noch ehe ein Wort zwischen ihnen gefallen war, da ihre Blicke einander begegnet waren, einen Augenblick, der ihr Herz und ihren Atem hatte stocken lassen. Die Zeit war stehen geblieben, und sie hatte das Gefühl gehabt, sich niemals mehr aus dem Bann seines strahlenden, wilden Blickes lösen zu können. Dann jedoch hatte er das Wort an sie gerichtet, sie zurückgewiesen und jenen Moment inniger Verbundenheit zerstört. Ach ja … Es war ohnehin alles nur Einbildung gewesen. Es gab keine geheimen Bande zwischen ihnen, keine tiefere Beziehung. Es gab ein Ziel und eine Verpflichtung, und das war mehr als genug, um dem Leben Halt zu geben.
„Dennoch, etwas muss Sie zu Ihrem Umzug bewogen haben“, hakte Dand nach. „Was ist geschehen, Charlotte? Haben Sie schließlich doch noch einen gesellschaftlichen Fauxpas begangen, über den nicht einmal Lord und Lady Welton hinwegsehen konnten? Haben Sie bereits am Vormittag Diamanten getragen? In einem Monat zweimal dasselbe Kleid angezogen?“, fragte er spöttisch. „Sagen Sie’s mir! Was haben Sie angestellt, dass die Weltons den Haustürschlüssel vor Ihnen versteckt haben?“
„Gar nichts. Maggie Welton hat einfach nur die Dreistigkeit besessen zu heiraten“, entgegnete sie leichthin. „Und ihr Ehemann, dieser unglückselige Wicht, hat sich geweigert, mich weiterhin bei ihnen wohnen zu lassen. Stellen Sie sich diese Frechheit vor.“
Dand grinste. „Wie taktlos von ihm.“
„Genau“, bekräftigte sie in spitzem Ton. „Doch dank des Feingefühls, das andere …“, sie schielte zu ihm hinüber, „nur vom Hörensagen kennen, kam ich zu dem Schluss, dass dies der geeignete Zeitpunkt sei, meinen lieben Freunden, den Weltons, Lebewohl zu sagen und mich in meinen eigenen vier Wänden einzurichten. Zum Glück bin ich dank der Mittel, die Kate und Christian mir überlassen haben, sehr gut in der Lage dazu.“
Dands Blick glitt über ihr neues Kleid und verweilte auf dem feinen Kaschmirtuch, das sie um die Schultern trug, und den matt schimmernden Perlenohrringen. „Die Summe war offenbar großzügiger bemessen, als ich dachte.“
Sie lächelte unverbindlich. Er hatte keine Ahnung.
„Wenn wir schon von Ihrem Erbe sprechen, welche Neuigkeiten haben Sie von Colonel und Mrs. MacNeill?“, wollte Dand wissen. „Und der schönen Helena und dem ebenso schönen Ramsey, natürlich.“
Als er den Namen ihrer ältesten Schwester erwähnte, der neuen Marquise of Cottrell, zögerte Charlotte. Helenas letzter Brief war recht kurz gewesen, und aus jeder Zeile hatte das angestrengte Bemühen gesprochen, das extravagante Benehmen der Jüngsten weder zu tadeln noch infrage zu stellen. Charlotte konnte von Glück sagen, dass ihre andere Schwester Kate mit dem Regiment ihres Ehemanns in fernen Ländern weilte und wenig von dem Klatsch und Tratsch hörte, der Helena zu Ohren kam.
„Es gibt keine besonderen Neuigkeiten“, entgegnete sie. „Helena und Ramsey bereiten sich auf ihre Abreise aus Jamaika vor, wo Ram eine der Pflanzungen des alten Marquis’ aufgelöst hat. Sie müssten noch diesen Monat in London eintreffen. Kate und Christian sind auf dem Festland.“
„Und glauben sie noch immer alle, ich sei ein Mörder?“
Auf diese Frage war Charlotte nicht vorbereitet. Ihr war nicht bewusst gewesen, dass Dand etwas daran lag, was seine ehemaligen Gefährten von ihm dachten. Etwas auf die Meinung anderer Menschen zu geben, bereitete nur schlaflose Nächte und trübte das klare Denkvermögen. Diese Lektion hatte sie von Dand gelernt. Zu viele Nächte hatte sie wach gelegen und sich mit den Gedanken daran gequält, welchen Gefahren er sich bei seiner Rückkehr nach Frankreich aussetzte oder welchen er jüngst entronnen war, wenn er an ihrer Tür klopfte. Damit die entsetzlichen Bilder, die ihre Vorstellungskraft heraufbeschwor, sie nicht um den Verstand brachten, hatte sie sich schließlich gezwungen, gar nicht mehr an ihn zu denken.
Doch nun war er hier und erkundigte sich nach der Meinung der anderen Rose Hunters. Es war unerwartet. Es zeigte, dass auch er nur ein Mensch war und sein Herz nicht gefeit gegen Schwächen aller Art. Sie hatte Dand Ross stets für völlig unempfindlich in Gefühlsdingen gehalten. Nun wusste sie es besser.
„Das kann ich nicht sagen. Sie vertrauen sich mir nicht an. Vergessen Sie bitte nicht, dass ich mich als vergnügungssüchtige Müßiggängerin viel zu sehr für meine eigenen Angelegenheiten interessiere, um auch nur einen Gedanken an andere Menschen zu verschwenden.“
„Sie klingen ein wenig verbittert“, bemerkte er.
Tat sie das? Hoffentlich nicht. Der Gedanke, sie könne es ihren Schwestern insgeheim verübeln, dass diese sie tatsächlich für so oberflächlich hielten, wie sie sich gab, missfiel ihr zutiefst. Dennoch … Bisweilen wünschte sie wider jede Vernunft, ihre Schwestern würden an ihren guten Charakter glauben, aller gegenteiligen Beweise zum Trotz. „Aber nein“, entgegnete sie nicht ganz aufrichtig. „Ich versuche nur, es Ihnen gleichzutun, Dand.“
Er hob herausfordernd den Kopf. „Und wie bin ich?“
„Weltgewandt, mit allen Wassern gewaschen …“ Sie zählte seine Eigenschaften auf. „Ohne Reue, ohne lästige Gewissensbisse, ohne jegliche Bindung und folglich auch ohne jede Verpflichtung, irgendjemandem gegenüber Rechenschaft ablegen zu müssen.“
„Und was veranlasst Sie zu dieser recht unschmeichelhaften Einschätzung meines Charakters?“, fragte er belustigt.
„Ich finde sie ganz und gar nicht unschmeichelhaft“, erwiderte sie ehrlich überrascht. „Mir scheint, dies sind höchst vorteilhafte Eigenschaften.“
„Wirklich?“, fragte er und kniff halb amüsiert, halb nachdenklich die Augen zusammen. „Doch Sie haben mir noch immer nicht gesagt, warum Sie so von mir denken.“
„Nun, Ihre beiden besten Freunde, die zufällig meine Schwäger sind, dachten, Sie hätten sie an die Franzosen verraten, den Wärter getötet, der Ihren schändlichen Verrat hätte bezeugen können, und vorgehabt, auch sie umzubringen. Was Ihnen nur deshalb nicht gelungen ist, weil meine Schwester Helena Ihnen einen Degen zwischen die Rippen stoßen konnte, bevor Sie, als Vikar verkleidet, dazu kamen, sie mit dem Ihren zu durchbohren.“
„Was für eine lebhafte Schilderung, Charlotte. Vielleicht sollten Sie einen jener schwülstigen Schauerromane schreiben, die im Augenblick so en vogue sind?“
Sie überhörte seine Bemerkung. „Und doch sitzen Sie hier, ungerührt und seelenruhig, als gingen Sie all die hässlichen Verdächtigungen nichts an. Wie schaffen Sie das nur?“
„Ich tröste mich mit dem Wissen, dass ich keine jener Schandtaten begangen habe. Ich besitze tatsächlich ein Gewissen, Charlotte. Es ist zwar alles andere als rein, doch dass ich versucht hätte, meine einstigen Gefährten zu ermorden, muss ich mir jedenfalls nicht vorwerfen. Außerdem würde Pater Tarkin sich für meine Unschuld verbürgen.“
„Sie leben allerdings schon lange nicht mehr in der Abtei St. Bride’s. Menschen ändern sich mit den Jahren.“ Sie trat hinter seinen Stuhl und blickte auf sein zerzaustes, von hellbraunen Strähnen durchzogenes Haar hinab. „Woher soll ich wissen, dass Sie unschuldig sind?“
Er sah argwöhnisch zu ihr auf.
„Ich habe den Mann nie gesehen, der behauptete, Vikar Tawster zu sein“, fuhr sie fort. „Nur Helena kann ihn identifizieren. Alles, was ich weiß, ist, dass Sie nach wie vor entschlossen sind, sich Ihren ehemaligen Gefährten nicht zu erkennen zu geben. Und auch meinen Schwestern nicht. Womöglich gibt es einen Grund dafür?“
Er verzichtete auf eine Antwort. Sein kragenloses Hemd war geöffnet und ein wenig verrutscht, sodass Charlotte seine kräftige, sonnengebräunte Schulter sehen konnte. Ein paar Zentimeter weiter, und die berüchtigte Rosentätowierung wäre zum Vorschein gekommen. Zwar hatte Charlotte sie nie gesehen, doch ihre Schwestern hatten ihr von dem schmerzhaften Souvenir erzählt, das der Folterknecht ihren Ehemännern und deren Mitverschwörer Dand Ross im Burgverlies von LeMons in die Haut eingebrannt hatte.
Sie beugte sich hinab, bis ihre Lippen beinahe sein Ohr berührten. Ein leichter Duft nach Seife und Kampfer umgab ihn. Er hielt es nicht einmal für nötig, sich umzudrehen. Keine Frage, er nahm allzu vieles als selbstverständlich hin. Kein Mann der feinen Gesellschaft hatte ihre Aufmerksamkeit je als Selbstverständlichkeit betrachtet. Dand Ross jedoch tat es. Ein Anflug von Boshaftigkeit überkam sie.
„Hinzu kommt noch“, flüsterte sie ihm ins Ohr, „dass Sie sich nach dem Zwischenfall mit Helena und dem Degen monatelang nicht in London haben blicken lassen. Vielleicht zogen Sie sich nach Frankreich zurück, um Ihre Verletzung auszukurieren? Vielleicht“, sie beugte sich über seine Schulter, „tragen Sie die Narbe … hier!“
Charlotte streckte blitzschnell die Hand aus und drückte sie flach gegen seine Rippen. Ehe sie wusste, wie ihr geschah, hatte Dand sie am Handgelenk gepackt und sie mit einem derart kräftigen Ruck über seine Schulter gezogen, dass sie auf seinem Schoß landete. Verwirrt blickte sie in sein finsteres Gesicht, das ihr mit einem Male völlig fremd vorkam. Dand hielt ihre Hand mit eisernem Griff von seinem Körper fort.
Ein Schauder der Furcht durchrieselte sie. Sie hatte nicht gewusst, dass er so stark war und sich so pfeilschnell bewegen konnte … und dass er sie mit derart finsterer Miene anstarren konnte.
Plötzlich begann sie, sich heftig zu wehren, doch Dand vereitelte ihre Befreiungsversuche mit beschämender Leichtigkeit. Während sie miteinander rangen, spürte Charlotte die Hitze seines Körpers an jeder unpassenden Stelle, spürte, wie ihre Haut erglühte und ihre vergessen geglaubte Fähigkeit zum Erröten wiedererwachte. Er bemerkte es nicht einmal.
„Halten Sie mich tatsächlich für einen Mörder?“ In seiner tiefen Stimme lag keine Spur von Belustigung mehr. „Und wenn Sie es tun, wollen Sie dieses Spiel dann wirklich mit mir spielen?“