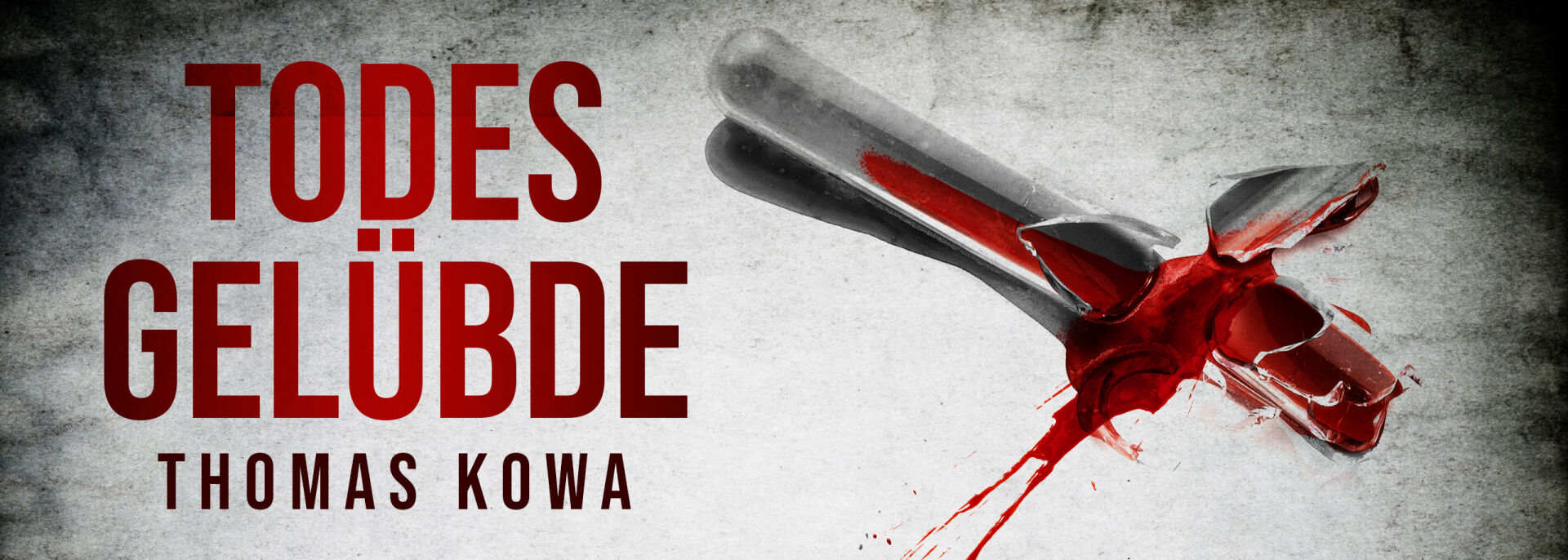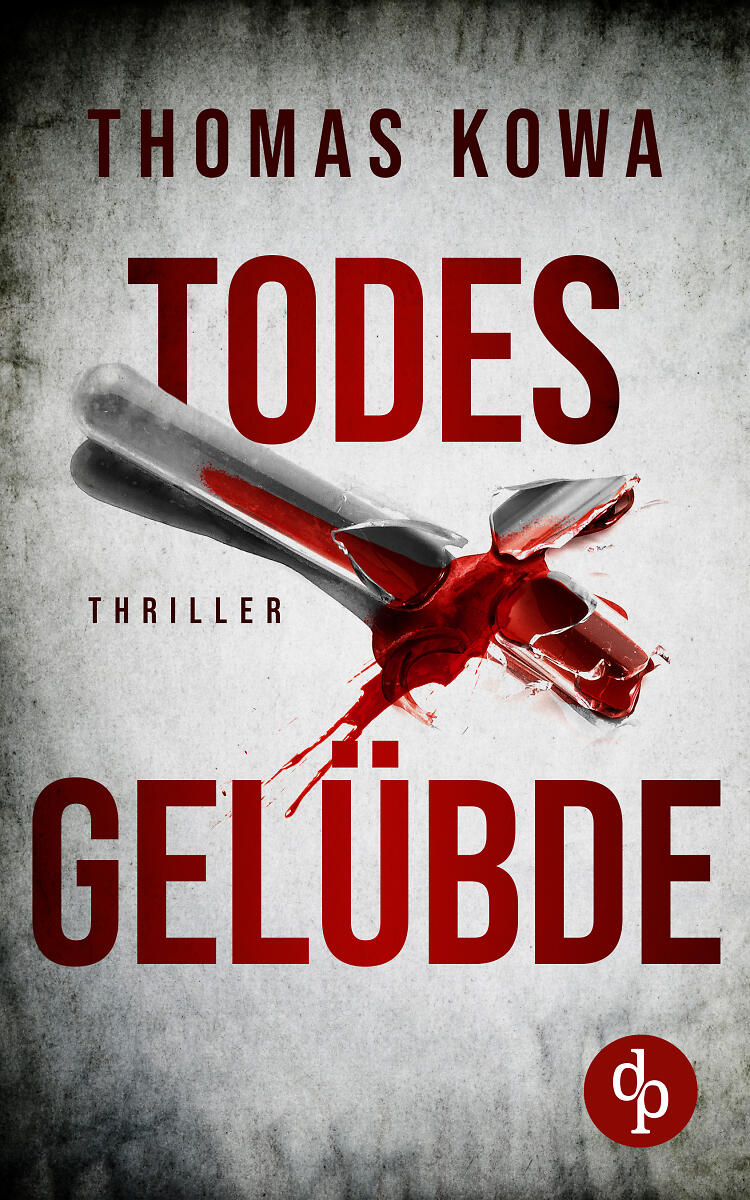1
»Das Leben geht weiter«, flüsterte er und tötete ihn. »Immer weiter, weiter, endlos weiter.«
Er zog das Messer aus der Brust des Mannes, hielt ein paar Sekunden inne und biss sich auf die Lippen. Er hatte den Rubikon überschritten.
Der rote Saft des Lebens floss aus der Wunde, als stammte er aus einer jungfräulichen Quelle. So durchdrungen von ewiger Vitalität, so rein, so geheimnisvoll und doch Träger exakter Informationen. Selbst in Tausenden von Jahren konnte daraus immer noch Leben entstehen.
Roland Obrist zuckte ein letztes Mal, dann sackte sein Kopf zur Seite. Blut färbte Obrists Arbeitskittel tiefrot. Die Furchen in seinem Gesicht ließen ihn älter aussehen als die sechzig Jahre, die sein Gott ihm zugestanden hatte.
Die heruntergelassenen Jalousien vor dem gekippten Fenster flatterten im Wind. Die Deckenleuchten warfen kaltes Licht in den Raum. Er war vollgestellt mit drei Stahlschränken, mehreren Arbeitstischen mit eingelassenen Spülbecken und ein paar Analyseautomaten. Von der Decke hingen zwei Abzugshauben. Über dem mit säureresistentem Kunststoff bezogenen Arbeitstisch waren Regale mit Ordnern und Fachbüchern angebracht. In jeder freien Ecke stapelten sich Autoklaven und Zentrifugen, umrahmt von zahllosen Reagenzgläsern und Erlenmeyerkolben. Der gekachelte Gang zwischen den Labortischen war der einzige freie Platz.
Gewesen.
Denn dort lag nun Roland Obrist.
Als es zu Ende ging, hatte Obrist versucht, ein letztes Gebet gen Himmel zu schicken.
Er war nicht bis zum Amen gekommen.
Aber was spielte das jetzt noch für eine Rolle? Den letzten Atem hatte Roland Obrist schon lange vor seinem Tod ausgestoßen. Obrist war nur noch eine Hülle gewesen, ein Befehlsempfänger, ein blind Glaubender.
Bis zur Kommunion war auch er ein blind Glaubender gewesen. Hatte an das Gute im Menschen und in der Kirche geglaubt. Du sollst glauben wie ein Kind. Das hatte er wahrlich getan. Ein Kind kann sich nicht wehren.
Inzwischen konnte er es.
Nie hatte er erzählt, was vorgefallen war. Er wollte nicht sein wie diejenigen, die nur ihr Leid beklagten. Seine Kindheit hatte ihn gelehrt, dass es einen Unterschied gab zwischen Schein und Wirklichkeit.
Die Seele von Roland Obrist müsste eigentlich gerade im Himmel angekommen sein, dachte er. Also dort, wo der Mann zeit seines Lebens hingestrebt hatte. Dafür sieht er nicht gerade glücklich aus.
Lag es daran, dass gar keine Seele existierte? Nur der vergängliche Körper, bestehend aus Millionen von Genen? War die Wiederauferstehung kein seelischer, sondern ein körperlicher Prozess? Nicht mehr als die Geburt eines Zwillings? Nur zu einem anderen, frei wählbaren Zeitpunkt?
Oder war der Himmel eine Erfindung des Teufels, um den Menschen schon auf Erden das Leben zur Hölle zu machen?
Er hatte das tausendfach durchdacht und seine Wahrheit gefunden.
Jede Wahrheit ist schwach, wenn niemand sie kennt.
Wenn niemand sie kennen will.
Es war an der Zeit, das zu ändern. Ein Opfer musste gebracht werden, um Millionen die Freiheit zu schenken. War das nicht wahre Humanität?
War das nicht die Quintessenz des Christentums?
Bei dem Gedanken musste er lachen. Er richtete sich auf und wischte die Klinge mit einem feuchten Lappen ab. Das Messer packte er in ein Lederetui und beseitigte gewissenhaft alle Spuren. Dann nahm er drei Ordner aus dem Regal über dem Arbeitstisch und verstaute sie in seine Tasche. Am Schluss ging er durch das Labor und vergewisserte sich, dass er nichts vergessen hatte.
Ein Opfer, um Millionen die Freiheit zu schenken.
Er würde sie mit ihren eigenen Waffen schlagen!
2
Es war mitten in der Nacht. Alex Pandera nahm eine Flasche San Miguel, Alpkäse und eine Packung Rindsmöckli aus dem Kühlschrank.
Dann hielt er inne.
Hilft diese Kombination wirklich gegen Schlaflosigkeit?
Was für eine blöde Idee.
Alex Pandera stellte die Sachen zurück in den Kühlschrank und öffnete eine Dose Katzenfutter. Skater hatte sich schnell daran gewöhnt, dass es neuerdings mitten in der Nacht eine Kleinigkeit zu essen gab.
»Na, schmeckt’s?« Pandera streichelte über Skaters Nacken.
»Kannst du wieder nicht schlafen?«
Pandera drehte sich um. Jackie stand in der Küchentür. Sie sah so müde aus, wie er sich fühlte. Ihre Augen waren klein, ihre dunkelbraunen Locken zerzaust. Sie gähnte.
Er zuckte mit den Schultern. »Skater hatte Hunger.«
»Wenigstens bist du diesmal nicht über den Kühlschrank hergefallen.« Sie kam zu ihm, zwickte ihn an der Stelle, von der sie hartnäckig behauptete, dort habe sich ein Rettungsring eingenistet, und küsste ihn.
Er strich durch ihre Locken und kräuselte sie sanft um seine Finger. Er sog den Duft von Rosen ein, der auf ihren Haaren lag. Das beruhigte ihn ein wenig.
»Geht es um Kurt?«, fragte sie.
Pandera nickte. »Ich weiß nicht, wie ich das ohne ihn schaffen soll.«
»Vielleicht überlegt Edeling es sich ja …«
»Der? Nie im Leben«, sagte Pandera. »Kurt hat ihm die Nase gebrochen! Dem Polizeichef! Vor fünf Kollegen. Edeling kann sich gar nicht leisten nachzugeben.«
»Gestern hast du deinen Chef nicht verteidigt.«
Pandera seufzte. »Mir liegt es auch fern, diesen Idioten zu verteidigen. Aber Kurt hat seine Entlassungspapiere erhalten, was soll ich da machen? Er war der einzige Kollege, zu dem ich Vertrauen hatte, der mich akzeptiert hat. Für die anderen bin ich nur der spanische Latin Lover.«
»Latin Lover?« Jackie zwinkerte ihm zu. »Davon hab ich bisher gar nichts mitbekommen.«
Pandera winkte ab. »Bei der Kriminalpolizei ist das kein Lob.«
»Du bist genauso Schweizer wie die«, sagte sie. »Und das nicht nur, weil es in deinem Pass steht.« Sie nahm seine Hand und strich darüber. »Das gibt sich noch. Schließlich bist du der Neue, und die anderen sind ewig dabei. Außerdem ist jetzt Wochenende.«
Er versuchte ein Lächeln. Es misslang.
»Wollen wir wieder schlafen gehen?«
Pandera nickte, hob sie hoch und trug sie ins Bett. Wie jeden Abend seit ihrer Hochzeitsnacht. Sie hatten einfach nicht damit aufhören können. Es war ihr kleines Geheimnis. Niemand wusste davon, nicht einmal Lara und Ben. Es war ein Ritual geworden, das zum Schlafengehen dazugehörte. Ihre Locken in seinem Gesicht, der Duft nach Rosen, ihre zarte Haut. Das war Glück.
Normalerweise.
»Mach dir nicht so viele Gedanken«, flüsterte sie, nachdem er sie aufs Bett gelegt hatte. Wie auf Knopfdruck schlief sie ein.
Pandera legte sich neben sie und versuchte, an nichts zu denken.
Vergeblich.
Kurt Sanders Entlassung ging ihm nicht aus dem Kopf. War Sanders Vorgehen mutig gewesen? Oder einfach nur unendlich dumm?
Mutig, beschloss Pandera, auch wenn er darunter zu leiden hatte.
Gerade als der Schlaf ihn endlich holen wollte, klingelte sein Mobiltelefon laut und schrill. Pandera griff blind danach und drückte die Taste für die Rufannahme.
»Wir haben einen Vorfall im Science Park«, hörte er eine weibliche Stimme. Die Frau aus der Zentrale war schlecht zu verstehen.
Er stand auf und ging zur Schlafzimmertür, dort war der Empfang am besten. »Was ist passiert?«
Die Antwort bestand aus einem Rauschen, unterbrochen von den Worten »Science Park«, »tot« und »noch nicht identifiziert«.
»Wie lautet die Adresse?«
»Hochbergerstrasse 60, Basel-Kleinh…« Der Rest ging im Rauschen unter.
»Wer ist noch informiert?«
Wieder nur Rauschen. »Krr … krrch … unterwegs …«
»Ich komme sofort.« Pandera legte auf.
»Was ist?« Jackie blickte ihn aus verschlafenen Augen an.
»Tut mir leid, ich muss los. Ein Mordfall.«
»Also wieder ein Sonntag ohne dich.« Sie seufzte. »Die Kinder haben sich so auf dich gefreut. Und ich auch.«
Er ging zu ihr, beugte sich über sie und küsste sie auf die Stirn. »Ich weiß. Ich mache es wieder gut.«
Pandera ließ die Jeans liegen und nahm stattdessen den schwarzen Anzug, den er am Freitag aus der Näherei geholt hatte. So eine Runderneuerung täte mir auch gut, dachte er, wird ja auch Zeit nach vierzig Jahren. Er ignorierte sein Spiegelbild im Badezimmerspiegel so gut es ging, warf sich kaltes Wasser ins Gesicht und fuhr sich mit der nassen Handfläche über die Bartstoppeln. Das musste reichen. Dann zog er sich an.
Er ging zu seinem alten Seat, öffnete mit der Fernbedienung das Garagentor, setzte sich hinters Steuer und startete den Motor. Langsam fuhr er auf die Straße und gab Gas.
Es dämmerte, die Vögel zwitscherten, und ein alter Mann trug Zeitungen aus. Pandera achtete nicht darauf, denn er hatte nur einen einzigen Gedanken.
Wie soll ich das ohne Kurt nur schaffen?
3
Bereits von Weitem entdeckte Pandera den lang gezogenen Quader des Basler Science Park. Jedes der sechs Stockwerke war in der unteren Hälfte mit einer Welle aus Beton verkleidet, in der oberen mit einer aus spiegelndem Glas. In einigen Büros brannte Licht.
Der Science Park war die Heimat erfolgversprechender Start-up-Unternehmen und einiger geplatzter Träume. Manche Firmen hatten den Absprung indes geschafft, insbesondere im Pharmabereich, dem in Basel dominierenden Wirtschaftszweig. Vor dem Gebäude standen zwei Streifen und ein Krankenwagen. Pandera erkannte keines der Autos. Er parkte und lief zu dem blau beleuchteten Eingang des Science Park. Ein älterer Streifenpolizist hielt dort Wache.
Pandera spürte, wie sich sein Magen zusammenkrampfte. Er hasste Tatorte. Der Tod, das Blut, der Gestank. Und doch gehörte all das zu seinem Job.
»Wo muss ich hin?«, fragte er.
Der Polizist wies nach oben. »Vierter Stock, hinten links.«
»Ist schon jemand da?«
»Irgend so eine Neue.« Der Polizist zog die Mundwinkel nach unten. »Konnte gar nicht glauben, dass die bei uns ist.«
Pandera ging in das Gebäude und stieg die Treppe hoch. Im vierten Stock öffnete sich ein mit Linoleum ausgelegter Gang. Die Türen auf beiden Seiten standen offen. Laborräume reihten sich aneinander, die mit irgendwelchen Apparaturen so vollgestellt waren, dass dort kaum Platz für Mitarbeiter blieb. Es war seltsam still im Gebäude, nur vereinzelt ratterte irgendwo eine Maschine.
Überall prangte der Schriftzug SEQUENZA46. Er war in dieser eckigen Computerschrift gestaltet, die in den Achtzigern des letzten Jahrhunderts als futuristisch gegolten hatte. Heute wirkte sie beinahe altbacken.
Vor einer Labortür war ein Streifenpolizist postiert. Pandera nickte kurz, atmete tief durch und blickte in den Raum. Eine Frau beugte sich über eine Person am Boden.
Pandera betrat das Labor. Es roch nach Schwefel. Und nach Parfüm. Irgendetwas mit Lavendel.
Er räusperte sich. Sofort richtete sich die Frau auf und drehte sich um. Sie sah sehr jung aus, war schlank, fast burschikos und hatte einen schwarzen Teint. Dunkle Rastalocken umgaben ihr hübsches Gesicht.
»Ich glaube, wir kennen uns noch nicht.« Sie hielt Pandera die Hand hin. Als sie bemerkte, dass sie noch Einweghandschuhe trug, zog die Frau sie schnell ab. »Ich bin Tamara Aerni.«
»Alex Pandera.« Er ergriff ihre Hand und schüttelte sie. »Ich leite die Ermittlungen. Und was tun Sie hier?«
»Ich bin wohl Ihre neue Partnerin.«
»Schön, Sie kennenzulernen«, sagte Pandera, doch es war nicht mehr als eine Floskel.
Er hatte gehofft, Edeling würde ihm einen der erfahrenen Kollegen zur Seite stellen. Es war sein erster großer Fall ohne Kurt Sander, und der Chef ließ ihn nicht nur im Stich, nein, Edeling fiel nichts Besseres ein, als ihm eine blutjunge Anfängerin zuzuteilen.
»Wissen wir schon, wer das Opfer ist?« Pandera richtete seinen Blick auf den Toten. Er lag auf dem Rücken, Arme und Beine weit ausgestreckt. Eine Blutlache hatte sich unter seinem Oberkörper gebildet.
»Er heißt Roland Obrist«, erklärte Tamara Aerni. »Der Name steht jedenfalls auf seinem Firmenausweis. Er war hier als wissenschaftlicher Assistent angestellt. Ein Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst hat ihn um fünf Uhr dreißig gefunden und die Polizei informiert.«
Pandera ging in die Knie. In der Brust, direkt über dem Herzen, klaffte eine tiefe Stichwunde.
Selbst nach zehn Jahren als Kriminalkommissär tat sich Pandera schwer, dem Tod ins Gesicht zu sehen. Viele seiner Kollegen hatten sich angewöhnt, am Tatort ein paar lockere Sprüche von sich zu geben. Wer Mitglied im Club der coolen Cops bleiben wollte, durfte keine Gefühle zeigen. Und so gab es bei der Basler Kriminalpolizei fast ausschließlich coole Cops, und es war ein offenes Geheimnis, dass nicht wenige der vermeintlich Abgehärteten ihre Ängste im Alkohol ertränkten.
Pandera zählte sich nicht dazu. Er hatte sich stattdessen angewöhnt, nur das Nötigste zu sagen.
»Erstochen also?«, sagte er fast unbeteiligt. Sein Schutz funktionierte.
»Sieht so aus«, antwortete Tamara Aerni auf dieselbe nüchterne Art. »Wo bleibt eigentlich die Spurensicherung?«
»Deckert kommt immer zu spät.« Pandera schaute sich im Labor um. Es schien penibel aufgeräumt, nichts lag herum, nichts war durchwühlt. »Tatwaffe?«
»Hab ich noch nicht gefunden. Bin selbst erst vor zehn Minuten gekommen.« Tamara Aerni blickte suchend über den Fußboden. Plötzlich stand sie auf, lief zu einem Mülleimer und öffnete ihn. »Leer. Entweder der Täter hat den Müll weggebracht, oder die sind hier sehr pingelig.«
Dann wandte sie sich dem Computer zu, der auf einem mit Ordnern beladenen Schreibtisch stand, und schaltete ihn an. Der Rechner ratterte kurz und verlangte eine Passworteingabe. Tamara Aerni hob die Tastatur hoch. Nur ein paar Staubkrümel lagen darunter.
»Wäre auch zu schön gewesen«, sagte sie.
»Warten wir damit auf Deckert«, sagte Pandera. Die Neue war ihm viel zu hektisch. Er ließ den Tatort lieber auf sich wirken, anstatt sich in Details zu verlieren. Dafür war ohnehin die Spurensicherung zuständig. »Sind Sie schon länger bei uns?« Er konnte sich nicht an die Kollegin erinnern.
»Vier Wochen«, antwortete sie. »Die meiste Zeit war ich auf irgendwelchen Seminaren. Das hätte so weitergehen sollen, aber dann ist ja diese Geschichte mit Herrn Sander passiert.«
Pandera nickte nur.
»Wie ich gehört habe, hat er sich ziemlich danebenbenommen.«
Pandera atmete tief durch. Er hasste Klatsch. Vor allem dann, wenn es einen Kollegen betraf. »Vielleicht war er nicht der Einzige.«
Tamara Aerni biss sich auf die Unterlippe und schaute einen Moment zu Boden. »Sie sind auch noch nicht so lange hier, oder?«
»Drei Monate.« Obwohl er mit dem Gespräch begonnen hatte, verspürte er nicht die geringste Lust, es fortzusetzen. »Wo ist der Wachmann, der den Toten gefunden hat?«
»Er wartet nebenan.«
»Hat er irgendwas gesehen oder gehört?«
Tamara Aerni schüttelte den Kopf. »Der Mörder hatte den Tatort wohl bereits verlassen, als der Wachmann das Gebäude betrat.«
»Ich liebe ruhige Sonntagmorgen«, brummelte eine tiefe Stimme von hinten.
Pandera drehte sich um.
Beat Deckert, der Leiter der Kriminaltechnik, stand in der Tür. Er grinste, als wäre gerade ein guter Zeitpunkt, um Scherze zu machen. Wie immer hatte er sein Resthaar über die Glatze gekämmt und seinen unförmigen Körper in einen karierten Anzug gesteckt. Darüber trug er einen transparenten Plastikoverall, der mindestens zwei Nummern zu groß war und von dem die Kollegen hinter vorgehaltener Hand tuschelten, dass es sich um ein Partyzelt handele. »Ist ja ’ne Stimmung hier wie auf dem Friedhof.«
Tamara Aerni sah Deckert mit großen Augen an.
An den Humor wirst du dich gewöhnen müssen, dachte Pandera. Und an einiges andere auch.
»Das ist Tamara Aerni«, sagte er zu Deckert. »Sie ist neu im Team.«
Tamara Aerni nickte freundlich, diesmal verzichtete sie darauf, dem Kollegen die Hand zu reichen.
»Beat Deckert«, antwortete der Kriminaltechniker. »Willkommen bei der besten Polizei der Welt.« Er lächelte die Neue an, dann sah er auf den Toten hinunter und seufzte. »Keine Tatwaffe?« Er zog die Einweghandschuhe an und beugte sich über die Leiche.
Pandera schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Wär ja auch zu schön gewesen.« Deckert nahm einen kleinen Metallstab und betrachtete die Wunde. »Nur ein Stich. Mitten ins Herz. Das war entweder ein Profi oder ein Glückstreffer.«
Tamara Aerni kräuselte die Stirn. »Es deutet nichts auf einen Einbruch hin. Entweder Obrist hat seinen Mörder gekannt, oder der Kerl arbeitet hier. Vielleicht hat er auch einen Komplizen im Labor.«
»Wir werden uns das Schließsystem genauer anschauen«, sagte Deckert und untersuchte den Kopf des Toten. »Ein ziemlich großes Hämatom am Hinterkopf«, stellte er fest. »Und das hier könnten Würgemale sein.« Er zeigte auf den Hals des Toten. »Sieht nach einem Kampf aus … Nicht gerade das, was man in einem Labor erwartet.«
»Wie lange ist er schon tot?«, fragte Pandera.
»Ich würde sagen, zwischen vier und acht Stunden«, antwortete Deckert. »Genaueres wissen wir nach der Obduktion.« Er räusperte sich. »Übrigens, der Inhaber des Labors ist da. Hab ich unten mitbekommen.«
»Ich habe ihn holen lassen«, sagte Tamara Aerni.
Pandera nickte und ging zur Tür. »Dann wollen wir uns mal mit ihm unterhalten.«
Tamara Aerni folgte ihm. Im Vorbeigehen öffnete sie eine Schublade und warf einen Blick hinein.
»Das überlassen wir mal schön den Profis.« Deckert schaute sie tadelnd an.
Ich bin auch Profi, schien sie sagen zu wollen, doch sie beschränkte sich auf ein »Okay«. Sie schob die Schublade wieder zu. »Was analysieren die hier eigentlich?«
Pandera hielt ihr die Tür auf. »Das werden wir sicher gleich herausfinden.«
4
»Was wissen wir über den Laborleiter?«, fragte Pandera auf dem Weg zum Aufzug.
»Er heißt Doktor Jürg Plattner und ist Inhaber sowie Geschäftsführer des Instituts«, antwortete Tamara Aerni. »Das steht zumindest auf dem Briefpapier.« Sie fuhr sich mit den Fingern über die rechte Braue. Erst jetzt fiel Pandera das Piercing daran auf.
Die Aufzugtür öffnete sich. Der Mann, der heraustrat, trug einen knittrigen braunen Anzug und darunter ein auberginefarbenes Hemd. Seine Schuhe sahen alt aus und schlecht gepflegt. Die wenigen Haare auf seiner Halbglatze standen wirr in alle Richtungen ab.
»Doktor Jürg Plattner?«, fragte Pandera.
Der Mann nickte. »Man hat mich gebeten zu kommen.« Er knöpfte sein Jackett auf. »Man wollte mir aber nicht sagen, weswegen. Ich hoffe, Sie können das aufklären.« Er blickte Pandera stirnrunzelnd an.
»Ein Mitarbeiter von Ihnen ist ermordet worden.« Pandera beobachtete Plattners Reaktion.
Der zuckte regelrecht zusammen. Fast ein wenig übertrieben.
»Ein Mitarbeiter? Ermordet?« Plattner schluckte.
»Sieht so aus.«
»Wer ist es?«, fragte Plattner.
»Ich denke, das können Sie uns sagen.«
Zu dritt gingen sie zurück zum Labor. Pandera öffnete die Tür.
Plattner blieb im Türrahmen stehen, blickte auf die Leiche am Boden und stürzte zu ihr. »Mein Gott, Roland!«
»Nichts anfassen!«, brüllte Deckert und hielt den Laborleiter zurück. »Oder wollen Sie, dass Ihre Spuren auf der Leiche sind?«
Plattner wich einen Schritt zurück und schüttelte benommen den Kopf.
»Ein … ein … so guter Mann.« Tränen traten ihm in die Augen. »Warum?«
»Ist das Roland Obrist?«, fragte Pandera.
Plattner nickte.
Pandera überlegte, wie er Plattners Reaktion einschätzen sollte. Entweder er war ein verdammt guter Schauspieler, oder er war tatsächlich betroffen vom Tod seines Mitarbeiters.
»Können wir Ihnen in Ihrem Büro ein paar Fragen stellen?« Pandera führte Plattner aus dem Labor.
»Geben Sie mir fünf Minuten«, bat Plattner. Auf seiner Stirn standen Schweißperlen, sein Gesicht war blass, seine Augen flackerten.
Pandera nickte. »Wir warten hier auf Sie.«
Wie in Trance schlurfte der Laborleiter über den Flur. Vor einer der Türen verharrte er, und es schien, als könnte er nicht die Kraft aufbringen, sie zu öffnen. Schließlich schüttelte er den Kopf und trat ein.
Tamara Aerni lief zu einem Wasserspender, füllte zwei Becher, trank einen leer und goss noch einmal nach. Den anderen reichte sie Pandera.
»Danke.«
»Auf eine gute Zusammenarbeit.« Sie hielt ihren Becher hoch und prostete ihm zu.
»Hoffen wir, dass sie erfolgreich wird«, sagte Pandera ausweichend. Er fühlte sich unwohl, nicht nur wegen des Mordfalls, sondern auch wegen der neuen Kollegin. Das ging ihm alles zu schnell. Er brauchte Zeit, bis er mit jemandem warm wurde. Oder war es, weil sie am Tatort herumgerannt war wie ein Duracell-Häschen? Trotzdem wollte er nicht unhöflich wirken. »Sind Sie hier geboren?«, fragte er deshalb.
»Nein, in Haiti«, antwortete sie, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt.
»Und wie sind Sie nach Basel gekommen?«
»Ich hab mit fünfzehn auf einem Schiff angeheuert, um meinen Daddy zu suchen.«
»Und? Haben Sie ihn gefunden?«
Tamara Aerni nickte. »Allerdings ist er vor ein paar Jahren gestorben. Immerhin hat er noch die Vaterschaft anerkannt. Sonst hätte ich wohl kaum meinen coolen Namen, oder?« Sie lächelte und zeigte dabei ihre blendend weißen Zähne. »Und Sie? Alejandro Javier Pandera Alvarez ist auch nicht gerade ein urschweizerischer Name, oder?«
Pandera blickte sie irritiert an. Woher kennt sie meinen vollen Namen? »Meine Eltern stammen aus der Extremadura. Ich bin aber in Basel geboren.«
»Haben Sie immer hier gelebt?«
»Überall und nirgendwo«, antwortete er. »Und jetzt wieder Basel.«
Sie schien zu merken, dass er nicht länger darüber reden wollte, also wandte sie sich um und zeigte auf ein Plakat an der Wand. »Haben Sie das gesehen?« Das Plakat war ganz in Schwarz gehalten, mit einem Text in der Computerschrift des Firmenlogos. »Klingt irgendwie beängstigend.«
Eine Stechmücke verfügt über 6 Chromosomen, das Opossum über 18 und der Mensch über 46. Der Schimpanse hat hingegen 48, eine Weinbergschnecke 54, und die Süßkirche nennt je nach Gattung bis zu 144 Chromosomen ihr Eigen. Nicht die Zahl der Chromosomen ist entscheidend, sondern was man damit macht. SEQUENZA46.
»Solange sie dem Menschen nicht ein paar zusätzliche Chromosomen verpassen, finde ich es nicht so beängstigend«, sagte Pandera.
»Das klingt aber ganz danach«, erwiderte Tamara. »Ich hab da gar kein gutes Gefühl.«
5
Bevor Pandera reagieren konnte, kehrte Plattner zurück. Seine Augen waren gerötet.
Wortlos führte er Pandera und Tamara Aerni in sein Büro.
Regale, die bis zum Bersten mit Büchern vollgestopft waren, zogen sich an den Wänden entlang, durch die Fensterfront fiel trübes Morgenlicht. Sie setzten sich auf zwei Besucherstühle aus Metallgitter, die sich für Pandera kalt und unbequem anfühlten.
»Seit wann hat Roland Obrist für Sie gearbeitet?«, fragte er.
»Er war seit gut drei Jahren bei uns«, erklärte der Laborleiter. »Wir kannten ihn von einem Projekt, an dem wir zusammengearbeitet haben. Er war ein sehr zuverlässiger Mitarbeiter.«
»War er alleinstehend?«, fragte Pandera.
»Das nehme ich an.« Plattner fuhr sich über die Stoppelhaare. »Roland hat oft am Wochenende im Labor gearbeitet.«
»Das heißt, es war nicht ungewöhnlich, dass er in der Nacht von Samstag auf Sonntag hier war?«, fragte Tamara Aerni. »Immerhin war erster August.«
»Er … er hat sich nicht viel aus dem Nationalfeiertag gemacht«, sagte Plattner. »Er hat gerne allein gearbeitet und konnte kommen und gehen, wann er wollte.«
»Hatte er Feinde?«, fragte sie.
Plattner zögerte. Nur wenige Augenblicke, doch Pandera entging es nicht.
»Das glaube ich nicht«, antwortete Plattner schließlich. »Die Kollegen hatten Respekt vor ihm …« Er ließ den Satz in der Schwebe.
»Aber?«
»Sie kennen die Vorgeschichte von Roland Obrist nicht, oder?«
Pandera schüttelte den Kopf.
»Nun, Sie müssen wissen, Roland Obrist hat viele Jahre als Mönch gelebt.« Plattner zuckte mit den Schultern, als könnte er das nicht verstehen. »Erst kurz bevor er bei uns anfing, hat er den Orden verlassen. Er war immer noch sehr, sehr gläubig. Er hatte in manchen Dingen seine eigenen Ansichten, und nicht alle Mitarbeiter haben die geteilt.«
»Wer, zum Beispiel?«, fragte Pandera.
»So genau weiß ich das nicht.«
»Hatte er mit Mitarbeitern Streit?«
»Nein … nein, wirklich nicht«, sagte Plattner schnell. »Aber mit einem Wissenschaftler kann man wohl kaum über die Heilige Dreifaltigkeit diskutieren.«
»Was wissen Sie über Obrists Privatleben?«, fragte Tamara Aerni.
Warum wechselt sie das Thema? Pandera legte die Stirn in Falten.
»Er hat nie darüber gesprochen«, antwortete Plattner.
Pandera trank einen Schluck Wasser. Ein ehemaliger Mönch in einem Gentechniklabor, das passte überhaupt nicht zusammen. »Wissen Sie, weshalb er den Orden verlassen hat?«
Plattner holte ein Briefchen weißen Snus aus einer Dose und steckte es in den Mund. »Die Wissenschaft hat ihn immer fasziniert. Doch sein Orden ließ eine tiefergehende Beschäftigung damit nicht zu. Roland Obrist war überzeugt davon, dass Gott uns die Wissenschaft gegeben hat, um die Welt zu ergründen. Das konnte die Ordensleitung nicht tolerieren.«
»Er hat den Orden demnach nicht im Frieden verlassen?«, fragte Pandera.
Der Doktor kratzte sich an der Stirn. »Wissen Sie, die Kirche verliert ungern eines ihrer Schäfchen.«
»Aber er war nach wie vor gläubig, oder?«
»Das war er.« Plattner nickte.
»Was untersuchen Sie eigentlich?«, fragte Tamara Aerni.
Schon wieder wechselt sie einfach das Thema, dachte Pandera. Das scheint ihr Markenzeichen zu sein.
»Wir analysieren Blutproben, detektieren genetische Defekte, führen radiologische Altersbestimmungen durch oder begleiten forensische Untersuchungen.« Es klang, als hätte Plattner seinen eigenen Werbeprospekt vorgelesen.
»Das heißt, Sie entscheiden darüber, ob jemand in einem Gerichtsprozess schuldig ist oder nicht?«, fragte Tamara Aerni.
»Wir unterstützen forensische Gutachter bei ihrer Arbeit«, sagte Plattner reserviert.
Pandera rutschte in dem unbequemen Stuhl hin und her. »Kann es sein, dass jemand diese Proben stehlen wollte?«
»Wir bekommen niemals die komplette Probe, das wäre viel zu riskant. Ergo würde der Diebstahl nichts nützen.«
»Machen Sie auch Dopingtests?« Pandera erinnerte sich an einen Fall, bei dem ein Sportler, der des Dopings verdächtigt wurde, ein Labor ausgeraubt hatte.
»Solche Tests darf nur ein zertifiziertes Dopinglabor durchführen. Wir haben uns auf genetische Untersuchungen spezialisiert.«
»Die von Roland Obrist durchgeführt wurden?«, fragte Pandera.
»Beispielsweise. Er war einer unserer Fachleute.«
Pandera rieb sich die Stirn. Plattner schien nur das Nötigste erzählen zu wollen, meist ein Hinweis, dass jemand etwas zu verbergen hatte. »Woran hat er zuletzt gearbeitet?«
»Gensequenzierung, diverse Auftragsarbeiten.«
Pandera atmete tief aus. »Können Sie das konkretisieren?«
»Diese Themen sind sehr komplex … Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, ich befürchte, das würden Sie nicht verstehen, Herr Kommissär.«
»Wir sollten es auf einen Versuch ankommen lassen«, entgegnete Pandera.
»Also gut.« Plattner seufzte. »Roland Obrist hat sich mit Chromosomenaberrationen befasst.«
»Können Sie mir ein Beispiel geben?« Pandera versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, dass er tatsächlich nichts verstand.
»Die bekannteste Chromosomenaberration ist das Downsyndrom, auch Trisomie 21 genannt, weil das 21. Chromosom dreifach vorliegt«, erklärte Plattner.
»Obrist hat sich folglich mit Genmutationen befasst.«
»So könnte man es sagen.«
»Was war das Ziel dieser Untersuchungen?«, fragte Pandera.
»Diese Krankheiten zu verstehen und zu verhindern.«
»Auch am lebenden Objekt?« Tamara Aerni setzte sich leicht auf.
Diese Frage hätte ich auch gestellt, dachte Pandera.
»Stammzeilen, Eizellen, Embryonen. Selbstverständlich nur, was erlaubt ist«, antwortete Plattner.
Pandera fixierte den Laborleiter. Wie nebenbei sagte er: »Obrist wurde also vom Paulus zum Saulus, oder?«
»Ich sagte ja schon, dass er den Orden nicht im Guten verlassen hat.« Plattner zog entnervt die Brauen hoch und schob die Snus-Dose auf der Schreibtischunterlage hin und her.
»Hatte er noch Kontakt zu den Mitgliedern des Ordens?«, fragte Pandera.
»Das ließ sich wohl kaum verhindern.«
»Weshalb?«
»Er war der Bruder des früheren Abtprimas der Jesuiten Johann Obrist.«
»Früherer Abtprimas?«, wiederholte Pandera. Er hatte keine Ahnung, wovon Plattner sprach.
»Der Abtprimas ist der Vertreter des Ordens beim Heiligen Stuhl in Rom«, sagte Plattner.
»Und was macht dieser Bruder heute?«, fragte Pandera.
»Das wissen Sie nicht?« Plattner runzelte die Stirn. »Johann Obrist ist seit drei Jahren aus Rom zurück. Er hat ganz schön Karriere gemacht.«
»Was für eine Karriere?«, fragte Pandera.
Plattner faltete demonstrativ die Hände. »Nun, Johann Obrist ist der katholische Bischof von Basel.«
6
Alex Pandera blickte am Fuß der breiten Steintreppe nach oben. Die pompöse Pforte, die strengen Säulen, der helle, an Marmor erinnernde Stein und die ausladende Treppe mit den zwei statuengeschmückten Brunnen ließen die Kathedrale wirken, als stünde sie mitten in Rom.
Die Gebäude ringsum, vor allem das Basler Tor mit seinen zwei steinernen Wehrtürmen, die aussahen wie riesige Bierfässer, machten jedoch jedem Besucher klar, dass er sich nicht in der Ewigen Stadt befand, sondern in der beschaulichen Schweiz.
Die Kathedrale war in der Grundform eines Kreuzes erbaut, über dem Schnittpunkt von Langhaus und Querschiffen thronte eine Kuppel. Links neben dem Chor erhob sich ein Turm, der ursprünglich geplante zweite war nie gebaut worden.
Pandera erinnerte sich, dass sein Schwiegervater ihm einmal erzählt hatte, der Untergrund an dieser Stelle sei für einen zweiten Turm nicht geeignet.
Spötter behaupteten hingegen, das Gottvertrauen sei an diesem Ort nicht groß genug. Schon beim Vorgängerbau, dem St.-Ursen-Münster, das an derselben Stelle errichtet worden war, hatte man aus statischen Gründen auf den geplanten zweiten Turm verzichtet. Was nicht viel brachte, denn der erste Turm stürzte trotzdem ein. Kurz darauf baute man die heutige Kathedrale und sah, als wäre nichts geschehen, wieder zwei Türme vor.
Doch der Glaube war nicht stark genug gewesen. So war es bis heute bei einem geblieben.
Die Geschichte des Bistums war nicht nur reich an baulichen Kuriositäten. Pandera hatte bei seinen Recherchen überrascht festgestellt, dass sich der Bischofssitz des Bistums Basel gar nicht in Basel befand, sondern in Solothurn. Im 16. Jahrhundert war im Zuge der Reformation fast die halbe Schweiz zum protestantischen Glauben konvertiert, darunter die Baseler Bevölkerung. Der nächstgrößere Ort, der in der Hand der Katholiken geblieben war, hieß Solothurn. Und so hatte der katholische Bischof vor ein paar Jahrhunderten seine Zelte in eben dieser Stadt aufgeschlagen. Weil ein Zelt für einen Bischof ein wenig karg ist, hatte er sich eine Kathedrale bauen lassen. Jene, vor der Alex Pandera nun stand.
Nachdem sich Tamara Aerni bei der Befragung des Wachmanns ebenso sprunghaft verhalten hatte wie bei dem Gespräch mit Plattner, hatte Pandera beschlossen, allein nach Solothurn zu fahren. Er würde sie nicht auf den Bischof loslassen. Tamara Aerni hatte geschluckt, aber seine Entscheidung akzeptiert.
Der Wachmann selbst hatte nicht viel zu erzählen gehabt. Er habe die Leiche auf seiner üblichen Runde gefunden und vorher wie nachher nichts Auffälliges beobachtet. Davor sei er in anderen Objekten unterwegs gewesen. Pandera hatte Tamara Aerni aufgetragen, die Angaben des Wachmanns zu überprüfen und erste Recherchen über die Mitarbeiter von SEQUENZA46 in die Wege zu leiten. So war sie eine Weile beschäftigt. Das war seine Art, sich an sie zu gewöhnen.
Während Pandera die Steintreppe hochging, hörte er leise Orgelmusik, offensichtlich lief der Gottesdienst noch.
Er öffnete die hölzerne Eingangstür und warf einen Blick in die Kirche. Erstaunt bemerkte er, wie viele Gläubige den Weg in die Kathedrale gefunden hatten. Das Hauptschiff war einer Bischofskirche würdig, groß und mächtig, ganz in Weiß gehalten und mit goldenen Ornamenten verziert. Pandera setzte sich leise auf eine der hinteren Bänke.
Die Orgel verstummte. Der Geistliche am Hochaltar trug ein kostbares, reich verziertes Gewand. Mit leiser und gleichzeitig fester Stimme wandte er sich an seine Gemeinde. Er mahnte sie, mehr Nächstenliebe und Menschlichkeit zu üben, doch er tat es nicht anklagend, sondern auf eine Art, die an einen gutmütigen Großvater erinnerte.
Pandera dachte an die katholische Kirche, in die er als Kind ab und an gegangen war. Dort war häufig von Sünde und Fegefeuer die Rede gewesen, und jedes Mal hatte er Angst davor bekommen. Der Geistliche hier schien einen friedlicheren Zugang zu Gott gefunden zu haben.
Der Gottesdienst endete mit einem Schlussgesang. Pandera wartete, bis die Gläubigen die Kathedrale verlassen hatten, dann ging er nach vorn zum Chor.
Er stand schon eine ganze Weile allein in der Kirche, als ein noch recht jung aussehender Geistlicher aus einer Seitentür trat und auf ihn zukam. Trotz der schwarzen Robe konnte Pandera die athletische Statur darunter erkennen. Sein Schädel war kahl rasiert, Kinn und Oberlippe bedeckte ein gestutzter dunkler Bart.
»Mein Name ist Alex Pandera. Ich habe einen Termin bei Bischof Obrist.«
Der Priester schüttelte ihm die Hand. Er drückte dabei so kräftig zu, dass Pandera leicht zusammenzuckte.
»Wir haben telefoniert«, sagte der Geistliche. »Ich bin Simon Kunen, Generalvikar und Stellvertreter seiner Exzellenz.«
»Ist der Bischof informiert?«, fragte Pandera.
Kunen nickte. »Wir können kaum glauben, was geschehen ist.«
Er führte Pandera aus der Kathedrale hinaus und in ein Gebäude hinter dem Chor.
Dort angekommen, betraten sie ein Büro im Erdgeschoss. An einem großen Eichenschreibtisch saß der Priester, der den Gottesdienst gehalten hatte. Seine Augen, die unter buschigen Brauen hervorschauten, verrieten Trauer.
»Eure Exzellenz«, begann der Vikar und verbeugte sich, »darf ich vorstellen? Leutnant Pandera von der Kantonspolizei.«
Pandera schluckte. Mierda, Solothurn ist ein eigener Kanton, andere Dienstgrade, andere Zuständigkeiten. Das hatte er glatt vergessen. Das kommt davon, wenn man zu lange im Ausland gelebt hat. Ich darf gar nicht hier sein.
Um sich nichts anmerken zu lassen, verbeugte sich auch Pandera. Plötzlich fiel ihm ein, dass er nicht einmal wusste, wie man einen Bischof korrekt anredete. Der Vikar wird es schon richtig gemacht haben, dachte er und setzte sich auf den altertümlichen Holzstuhl vor dem Schreibtisch. »Eure Exzellenz, es tut mir leid, dass ich so kurzfristig um ein Treffen gebeten habe, aber Sie sind der nächste Angehörige des Opfers.«
»Sie haben richtig gehandelt«, sagte der Bischof mit sanfter Stimme und strich sich durch den langen grauen Vollbart. »Mein Sekretariat ist manchmal ein wenig zu sehr auf meinen Schutz bedacht. Selbstverständlich müssen wir uns unterhalten.«
»Möchten Sie das Gespräch unter vier Augen führen?« Pandera schaute zu Vikar Kunen, der sich einen Stuhl herangezogen und sich neben den Bischof gesetzt hatte, als wäre er sein Wachhund.
Der Bischof wies zu seinem Stellvertreter. »Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Außerdem ist Vikar Kunen als Abt des Jesuitenordens genauso von Rolands Tod betroffen wie ich.«
»Ihr Bruder war doch nicht mehr Mitglied des Ordens, oder?«
Der Bischof seufzte. Er schien zu überlegen, was er antworten sollte.
Der Vikar kam ihm zuvor. »Den Jesuitenorden verlässt man nicht einfach«, sagte er steif. »Im Herzen bleibt man immer Jesuit.«
»Roland Obrist hat ein weltliches Leben geführt und in einem Labor gearbeitet«, widersprach Pandera.
»Uns Jesuiten als Regularklerikern ist das weltliche Leben nicht fremd«, erwiderte der Vikar. »Wir kennen keine einheitliche Ordenstracht und lehren an Universitäten und Schulen. Wir schließen uns nicht ein, wir sind Teil der Gesellschaft. Wussten Sie, dass Descartes und Voltaire Schüler von Jesuiten waren?«
»Das heißt, Roland Obrist hat mit Billigung des Ordens in dem Labor gearbeitet?«, fragte Pandera.
Bischof Obrist räusperte sich. »Wir haben darüber einen langen Disput geführt. Rolands Ziele waren fraglos die richtigen. Nur über den Weg dahin, über den waren wir uns nicht einig.«
»Hatten Sie noch Kontakt zu Ihrem Bruder?«
Der Bischof rieb sich über die Stirn. »Roland hat gewusst, dass er jederzeit zurückkehren kann.«
»Was er nicht getan hat«, erwiderte Pandera. »Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen?«
Wieder ergriff Vikar Kunen das Wort. »Was spielt das für eine Rolle?« Er funkelte Pandera aus stahlblauen Augen an.
»Das hier ist kein Verhör«, sagte Pandera ruhig. »Wenn ich allerdings den Eindruck gewinne, dass Sie kein Interesse daran haben, den Mörder von Roland Obrist zu finden, können wir das gerne offiziell machen.«
»So war das nicht gemeint«, beeilte sich der Bischof zu versichern. »Ich habe Roland das letzte Mal vor gut zwei Jahren gesehen, hier in der Kathedrale. Er hatte Zweifel, was seine Tätigkeit in dem Labor anging, und wir haben darüber diskutiert.«
»Vor zwei Jahren?«, wiederholte Pandera. »Eine lange Zeit, nicht wahr?«
Bischof Obrist reagierte nicht.
»Die Aufgaben eines Bischofs sind vielfältig und sehr zeitaufwendig …«, warf Vikar Kunen ein.
»Ich habe den Bischof gefragt und nicht Sie«, unterbrach Pandera ihn. Der Verlauf des Gesprächs gefiel ihm überhaupt nicht. Kunen sah nicht nur aus wie ein Wachhund, er benahm sich auch so.
Mit einem eindringlichen Blick bedeutete der Bischof dem Vikar sich zurückzuhalten. »Wir waren auf besondere Weise miteinander verbunden. Diese Verbundenheit war unabhängig von Ort und Zeit. Man kann tiefe Liebe zueinander empfinden, auch wenn man sich nicht sieht. Jesus selbst lehrt uns das.«
»Und Sie?«, fragte Pandera den Vikar. »Wann haben Sie Roland Obrist das letzte Mal gesehen?«
»Das ist auch schon länger her«, antwortete Kunen ausweichend.
»Können Sie das präzisieren?«
»Ungefähr ein Jahr. Wir haben uns auf einer kirchlichen Veranstaltung zufällig getroffen und miteinander gesprochen.«
Pandera wandte sich wieder an den Bischof. »Der Vorgesetzte von Roland Obrist, Doktor Plattner, hat angedeutet, dass es zwischen Ihrem Bruder und der Ordensleitung Konflikte gegeben habe.«
»Doktor Plattner ist ein unverantwortlicher Scharfmacher.« Der Vikar ballte eine Hand zur Faust, als hälfe ihm das sich zu beherrschen. »Er sollte besser auf sein Labor aufpassen, als uns einen Konflikt mit Bruder Obrist anzudichten!«
Der Bischof räusperte sich. »Vikar Kunen möchte damit sagen, dass mein Bruder das Opfer einer weltlichen Verschwörung ist und nicht einer kirchlichen.«
»Einer weltlichen Verschwörung?«, echote Pandera.
Bischof Obrist fuhr sich mit der Hand über den Mund, als bereute er, was er gerade gesagt hatte. »Wie soll ich es ausdrücken?« Er seufzte. »Mein Bruder stand in Konflikt mit heidnischen Kräften.«
»Wie meinen Sie das?«
»Er war den Agnostikern, den Fehlgeleiteten, die an nichts glauben, ein Dorn im Auge.«
»Weshalb?«, fragte Pandera irritiert. »Ich denke, er war Wissenschaftler?«
»Mein Bruder war mit einer Untersuchung beschäftigt, die nicht in das Weltbild der Agnostiker passt.«
Pandera verstand kein Wort mehr. »Würden Sie mir bitte erklären, wovon Sie sprechen?«
Der Bischof schloss die Augen und atmete tief durch. »Mein Bruder war früher wissenschaftlicher Sekretär des Jesuitenordens. Vor seinem Umzug nach Basel hat er an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom gearbeitet. Er kam dann im Rahmen einer Forschungsarbeit nach Basel.«
Vikar Kunen räusperte sich, als wollte er den Bischof stoppen.
Doch der redete weiter. »Die Forschungen und deren Ergebnisse sollten geheim gehalten werden und in absolut neutraler Umgebung stattfinden, hier in der Schweiz, in einem unabhängigen Labor. Mein Bruder hat diese Forschungen im Auftrag des Papstes begleitet. So ist er zu diesem Labor gestoßen, in dem er jetzt tot aufgefunden wurde.«
»Und weswegen wurde er angefeindet?«, fragte Pandera. »Ich denke, die Untersuchungen waren geheim?«
»Die Resultate der Untersuchungen sind nie veröffentlicht worden«, antwortete Bischof Obrist. »Aber es gab Gerüchte. Manche glauben, die Kirche hielte unliebsame Forschungsergebnisse zurück.«
»Das ist nicht gerade überraschend, wenn die Ergebnisse nicht veröffentlicht werden.«
»Das ist noch nicht alles«, fuhr der Bischof fort. »Mein Bruder hat mir erzählt, dass es Wissenschaftler gab, die versucht haben, an Proben des Forschungsobjekts zu gelangen.«
»Kennen Sie diese Wissenschaftler?«
Der Bischof schüttelte den Kopf. »Mein Bruder hat keine Namen genannt.«
»Könnte Doktor Plattner diese Wissenschaftler kennen?«
Der Bischof zuckte mit den Schultern. Kunen schaute zu Boden. Der Mann wusste etwas.
»Was war das für ein Forschungsobjekt?«, fragte Pandera.
Vikar Kunen räusperte sich. »Eure Exzellenz, ich glaube nicht, dass Leutnant Pandera Untersuchungen interessieren, die seit drei Jahren abgeschlossen sind …«
»Es geht um den Mord an meinem Bruder!«, unterbrach der Bischof ihn. »Herr Pandera soll alles wissen, was von Bedeutung sein könnte.«
Pandera nickte. »Also, worum ging es bei den Untersuchungen?«
»Es gibt eine Reliquie, die beweist, dass Jesus Christus gelebt hat, dass er gekreuzigt wurde und wiederauferstanden ist«, sagte der Bischof.
Pandera sah ihn fragend an.
»Ich spreche von der größten Reliquie der Menschheit.« Die Stimme des Bischofs klang verschwörerisch.
»Die größte Reliquie der Menschheit?« Pandera kam sich vor wie ein dummer Schuljunge.
Der Bischof seufzte. »Haben Sie noch nie etwas vom Leichentuch Jesu gehört?«
»Sie meinen das Turiner Grabtuch?«
Die beiden Geistlichen schwiegen. Doch ihr Nicken verriet Pandera, dass er recht hatte.
7
»Du bist die Zukunft«, sagte er. »Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft.«
Der Zweijährige sah ihn mit großen Augen an. »Su-kunft«, wiederholte er und lachte.
Er saß neben dem Kind auf dem Parkettboden und blätterte in einer Bibel mit ledernem Einband.
Eine Weile suchte er darin, dann legte er sie zur Seite.
»Wir werden bald an die Öffentlichkeit gehen.« Er strich dem Jungen durch das schwarze Haar. »Die Zeit ist reif, der Welt zurückzugeben, worauf sie zweitausend Jahre lang gewartet hat.«
Der Junge spielte mit einem Kreisel. Das war sein Lieblingsspielzeug. Durch die schnellen Drehungen leuchteten die Dioden im Inneren auf und blinkten wie Sterne. Der Junge klatschte freudig in die Hände. Für ihn war das Leben noch ein Spiel. Er wusste, dass der Kleine bald zum Spielball werden würde. Es war unvermeidlich.
Er nahm eine Videokamera und filmte den Jungen. Doch er tat es nicht mit der Euphorie eines begeisterten Vaters, er tat es vielmehr nüchtern und besonnen wie ein Dokumentarfilmer.
Nach wenigen Minuten legte er die Kamera wieder zur Seite. Die Aufnahmen, die er vorgestern gemacht hatte, waren besser. Sie hatten etwas Königliches, etwas Entrücktes, die würde er verwenden.
So überwältigend seine Botschaft auch war, ohne Bilder würde sie nicht funktionieren. Die Bibel war ebenfalls voller Bilder, allerdings keine, die gezeichnet oder gar fotografiert waren. Es waren die Worte, die darin malten.
Er stand auf, ging zum Fenster, öffnete den Vorhang und blickte auf die nachtdunkle Stadt. Das glitzernde Wasser des Tibers schlängelte sich unter dem Ponte Sant’Angelo hindurch. Die Engelsbrücke war fast zweitausend Jahre alt, ein stummer Zeitzeuge der römischen Geschichte.
Heutzutage zeigten Verliebte einander ihre ewige Treue, indem sie kleine Vorhängeschlösser an die metallenen Ornamente der Engelsbrücke hängten. Es war ein schönes Bild, wenngleich manche mit Zahlenschlössern Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihres Versprechens aufkommen ließen.
Ahnte überhaupt irgendjemand von diesen Unwissenden, welche Funktion die Brücke nur fünfhundert Jahre zuvor innegehabt hatte?
Damals war sie kein Ort der Liebe gewesen. Wahrlich nicht. Sie war Verkehrsweg gewesen, aber auch Hinrichtungsstätte. Einige Päpste hatten auf dieser Brücke die aufgespießten Köpfe ihrer Gegner zur Schau gestellt. An manchen Tagen, so hieß es in den alten Schriften, seien dort mehr Köpfe zu sehen gewesen als Melonen auf den römischen Märkten.
Das war finsterstes Mittelalter, hörte er seine Gegner rufen. Nur warum hatte der Vatikan dann noch bis 1870 Menschen hingerichtet und die Todesstrafe erst 1969 abgeschafft?
Doch das war Geschichte. Die Kirche hatte sich gewandelt. Und sie würde sich weiter wandeln, über Grenzen hinaus. Niemand konnte sich das heute vorstellen, dennoch würde es geschehen.
Der Professor zog den Vorhang wieder zu, nahm den Jungen auf den Arm und strich ihm durch die schwarzen Haare. Es war schon merkwürdig. Als Molekularbiologe konnte er so viel verändern, er hatte so viele Gene identifiziert und ihnen bestimmte Funktionen zugeordnet, seine eigenen Haare mussten jedoch grau bleiben.
Wenn er sie nicht färbte. Was er getan hatte, denn wer wollte mit fünfundvierzig aussehen wie Caesar?
Ein blonder Vater und ein schwarzhaariger Junge. Das fiel heute gar nicht mehr auf. Zum Glück, denn bald mussten sie an die Öffentlichkeit, ins grelle Scheinwerferlicht der Fernsehkameras. Dieser kurze Moment würde ausreichen, um alles ins Rollen zu bringen. Das Schneeflöckchen namens Wahrheit würde zu einer Lawine anwachsen und mit sich reißen, was nicht auf seinen Grundfesten erbaut worden war.
Der Mann, der ihnen dabei helfen würde, hieß Roger Simovic. Ein Reporter, ehrgeizig, mutig und wahnsinnig genug, um sich auf die Story einzulassen. Und er arbeitete bei Biggest News, dem weltweit operierenden Nachrichtensender mit über zwei Milliarden potenziellen Zuschauern. Bald war es so weit.
Dann würde das Spiel beginnen.
Er setzte den Jungen auf den Boden. Dann nahm er noch einmal die Bibel und blätterte darin.
Schnell hatte er gefunden, was er gesucht hatte.
»Du wirst in Gefahr geraten«, sagte er zu dem Jungen. »Unsere Gegner sind stark, und sie schrecken nicht vor Gewalt zurück.«
Er setzte sich an den Tisch vor seinen Laptop und tippte die Worte, die er soeben gefunden hatte.
Danach klappte er das Buch zu und stellte es zurück ins Bücherregal. Er sah auf den Bildschirm und las die Verse stumm.
Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zornig, und er ließ in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte.
Matthäus 2,16