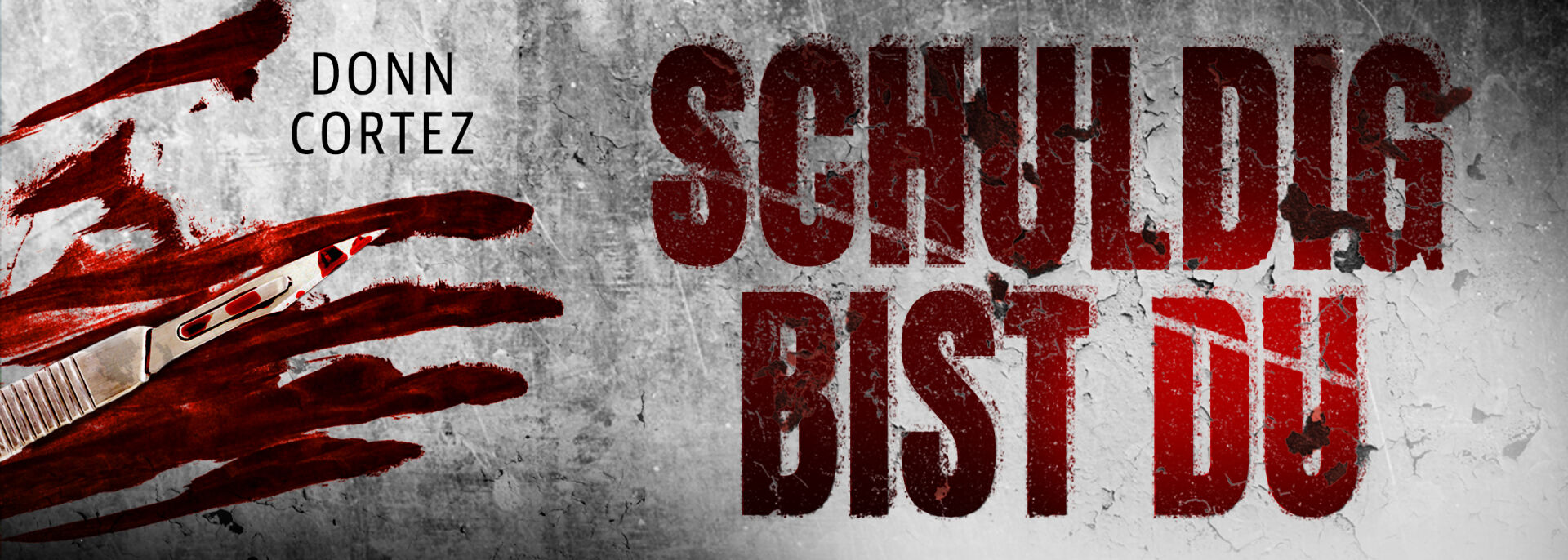1
Das Geschäft lief nicht besonders, und Susanna grinste unwillkürlich, als der neue Ford Taurus bei ihr anhielt. Ein Mietauto – das sah man schon am Nummernschild. Also ein reisender Geschäftsmann mit einem einsamen Hotelzimmer, den seine Kreditkarte juckte. Das brachte hundert schnelle Dollar, vielleicht hundertzwanzig mit Trinkgeld. Dazu ein paar Minuten ohne diese mörderischen Pumps, und ohne dass der eisige Wind weiter in ihre wunden Brustwarzen biss.
Sie lehnte sich vor und steckte ihren Kopf ins Beifahrerfenster. Der Fahrer war jünger als erwartet, hatte einen rasierten Schädel, ein verlottertes Ziegenbärtchen und silberfarbene Ringe in Augenbrauen und Unterlippe.
Sie checkte ihn instinktiv ab, noch während sich ihre Mundwinkel zu einem Lächeln hoben. Vor gar nicht langer Zeit hatten Typen wie er todsicher Ärger bedeutet, aber inzwischen hatte so gut wie jeder unter dreißig irgendwas gepierct.
Auch Susanna trug einen Ring im Bauchnabel.
Was soll’s, zum Teufel. Vielleicht hat er ja sogar ein bisschen Koks.
„Hey“, sagte sie. „Wie wär’s mit uns beiden?“
„Nee“, grinste er zurück. „Ich wollte bloß ein paar Modetipps.“
Sie konnte sich das Lachen nicht verkneifen. Ihre Kluft war nagelneu – das schwarze Minikleid aus Latex und die passenden hochhackigen Pumps brachten ihre langen Beine und ihr hüftlanges, schwarzes Haar bestens zur Geltung.
Den meisten Freiern bedeutete das allerdings kaum mehr als eine glitzernde Bonbonverpackung.
„Mal sehen“, sagte sie. „Ich wüsste schon, was dir gut stehen würde.“
„Und das wäre?“
„Das wirst du gleich merken.“
Er kicherte und nickte. Seine Piercings blitzten im Schein der Wagenarmaturen grün auf. „Einverstanden. Ich bin dabei.“
„Wart’s ab“, hauchte sie, „gleich sind wir beide dabei.“
Sie stieg auf den Beifahrersitz. Er fuhr langsam los.
„Ich bin Todd“, sagte der Fahrer.
„Susanna.“
„Ich dachte schon, du schickst mich zum Teufel“, sagte Todd.
„Was, sehe ich etwa nicht nach einer Gold Card aus?“
„Musste dich doch abchecken. Als Mädchen kann man nicht vorsichtig genug sein.“
„Klar, das versteh ich. Sind ja auch eine Menge Verrückte unterwegs …“
Hinterher lag er im Motelbett und rauchte.
Mann, das war echt schön. Es war natürlich nur ein Ersatz für das Wahre, aber es kam schon recht nah.
Er legte die Hände hinter den Kopf und reckte sich behaglich in die Länge. Und die dumme Pute hat nicht die leiseste Ahnung. Denkt, ich wäre einfach irgendwer. Ha.
Die Badezimmertür ging auf, und Susanna kam heraus, im Minikleid, aber barfuß. Sie bückte sich und hob die Schuhe mit den Pfennigabsätzen vom Boden auf.
„War wirklich toll, Todd“, sagte sie. „Ich warte dann unten auf mein Taxi, okay?“
„Ist recht“, antwortete Todd und lächelte müde. „Hey, ich bin noch ein paar Tage hier in der Stadt – kann ich dich irgendwie erreichen?“
„Neben dem Waschbecken liegt meine Karte. Da ist die Nummer von meinem Piepser drauf“, sagte sie und quälte sich mit einer Grimasse in die Stilettos. „Ruf mich an, wann immer du ein bisschen Abwechslung brauchst.“
Sie war schon halb zur Tür hinaus, als er hinterherrief: „Hey, einen Moment!“
Sie wandte sich um. Er deutete auf den Tisch neben der Tür.
„Du solltest wenigstens austrinken …“
Sie griff sich ihren halbvollen Scotch mit Wasser und kippte ihn hinunter. „Danke“, sagte sie. „Damit geht’s noch eine Weile.“
„Und den anderen kommt’s“, grinste er.
Die Tür schloss sich wieder, und er rief noch hinterher: „Und hey – sei bloß vorsichtig! Da draußen sind jede Menge Verrückte unterwegs!“
Klick.
Er stieg nackt aus dem Bett und tappte zur Tür hinüber. Mit einem Papiertaschentuch aus einer Box auf dem Tisch hob er vorsichtig das Glas hoch, aus dem sie getrunken hatte.
Er hielt es vor die Nachttischlampe und kniff seine Augen zusammen. Mehrere brauchbare Fingerabdrücke.
„Oh ja“, murmelte er. „Da gibt’s jede Menge Verrückte …“
Sie hieß Nikki. War Anfang dreißig, hübsch, und hatte zurzeit langes blondes Haar. Die Falten verbarg das Make-up.
Den Teint frischte sie regelmäßig in einem Bräunungsstudio auf, das Lächeln hatte sie jahrelang geübt; ihr Blick war so stechend blau wie bei einer missmutigen Siamkatze. Zwischen den hautengen, weißen Hosen und dem schwarzen Spaghetti-Top spannte sich ihr flacher Bauch – die Athletik eines Menschen, der seinen Körper gebraucht wie ein Soldat seine Waffe.
Ihre Füße steckten in schicken, weißen Turnschuhen mit enormen Plateausohlen. Außer einer schweren Armkette voller Anhänger trug sie keinen Schmuck. Sie kaute ständig Kaugummi und blies aus rosafarbenen Lippen große Blasen von exakt dem gleichen Farbton.
Nikki ging auf den Strich, seit sie siebzehn war. Als sie ankam, hatte sie schnell den rund um die Uhr geöffneten Coffee Shop ausfindig gemacht, in dem sich die Nutten trafen.
Irgendwo am Strich war immer so ein Laden, und sie hatte sich dort ein wenig umgehört. Sie war nicht zum ersten Mal in Seattle, aber der Markt war ständig in Bewegung; besser erst einmal die Verhältnisse checken. Revierkämpfen ging sie lieber aus dem Weg.
Ein schwarzer Wagen hielt an. Nikki verhandelte durchs offene Beifahrerfenster. Dann stieg sie ein, und der Wagen fuhr los.
Gleich darauf schob sich ein weißer Lieferwagen aus einer Seitenstraße, bog hinter dem schwarzen Wagen ein und folgte mit einigem Abstand.
Nikki wandte sich zum Fahrer und betrachtete ihn gelassen.
Ein typischer Weißer mittleren Alters mit Stirnglatze. Sein zerknitterter Anzug war vielleicht vor Jahren mal modern gewesen, und der Wagen roch nach kaltem Tabakrauch.
„Nun, Stanley“, sagte sie. „Wie magst du’s denn?“
„Ich, äh – ganz normal, eigentlich. Und du kannst Stan zu mir sagen.“
„Also gut, Stan – und was ist normal?“
„Äh, ja – weißt du, ich will auf keinen Fall Schwierigkeiten kriegen. Du bist doch – du bist doch keine Polizistin, oder? Die sollen sich doch manchmal verkleiden …“
„Ach, wenn das dein Problem ist … okay.“
Sie lehnte sich zu ihm hinüber und schob die Hand in seinen Schritt. Er sog scharf die Luft ein, aber sie ließ die Hand dort liegen.
„Würde ich das tun, wenn ich eine Polizistin wäre?“
„N … nein, wahrscheinlich nicht.“
Er lächelte sie verlegen an. Sie erwiderte das Lächeln und blies eine große, rosafarbene Kaugummiblase.
Ah, dachte Todd und ließ seine Reisetasche auf den Boden plumpsen. Schön, wieder zu Hause zu sein.
Viel war ja nicht dran an diesem ‚Zuhause‘. Ein Apartment mit Klappbett, Schreibtisch, Kommode und einer Küchennische, in die sich zwei Personen hineinzwängen konnten – wenn es denn unbedingt sein musste. Er hatte sich nicht die Mühe gemacht, etwas an die kahlen Wände zu hängen, und an der für den Esstisch gedachten Stelle stand sein Mountainbike. Er aß entweder außer Haus oder über der Spüle.
Eigentlich brauchte er die Wohnung nur zum Schlafen – und zur Aufbewahrung seines wertvollsten Besitzes, dem er sich auch jetzt sofort widmete. Seiner Nabelschnur, der Verbindung zu dem, was für ihn die wirkliche Welt war.
Er setzte sich an den Computer, loggte sich ein und entspannte sich sofort. Er dehnte sich und gähnte. Es war ein langer Flug gewesen – aber das gehörte eben dazu. Und außerdem war dieser Job nicht ohne Reize. Mit einem Grinsen dachte er daran, wie sich die Beine der Nutte um seine Taille gelegt hatten.
Er tauchte mit wilder Lust in die Datenströme des Webs, gerade wie ein Snowboarder das Matterhorn angehen würde. Die Bilder huschten über den Monitor, und er sprang von Website zu Website, checkte Nachrichten, Tratsch und Gerüchte. Die Seiten hießen ‚Serial Killer Hall of Farne‘, ‚Wahres Blutbad‘ oder ‚Monster des 20. Jahrhunderts‘; sie waren ihm so vertraut wie das Einkaufszentrum um die Ecke – und letztendlich auch genauso harmlos.
Es wurde Zeit für die richtigen Seiten.
Der Chatroom hieß ‚Das Jagdrevier‘. Er hatte ihn selbst eingerichtet. Der Chat lief über einen eigenen Server und war nur über ein aufwendiges System verschlüsselter und vielfach umadressierter Nachrichten erreichbar. Er loggte sich ein – natürlich nicht unter dem Namen Todd, der ungefähr so echt war wie der Name der Nutte. Hier trat er unter dem Namen auf, den er für sich gewählt hatte, seinem wahren Namen: Djinn-X.
Der Bildschirm teilte sich quer in drei Felder, ein schwarzes, ein rotes und ein weißes. Ganz oben stand in verschnörkelter Schrift ‚Discussion‘. Im oberen, schwarzen Feld stand ganz rechts der Name ‚Djinn-X‘. Links am Rand war eine schreiende Frau mit verbundenen Augen zu sehen; wenn er tippte, bewegte sie ihre Lippen, und es erschienen bluttriefende Buchstaben.
DJINN-X: Hey, Jagdgenossen – sieht aus, als bekämen wir schon bald ein neues Mitglied für das Rudel!
Das mittlere Feld auf dem Bildschirm wogte in Scharlachrot; rechts war der Name ‚Der Gourmet‘ zu lesen, auf dem Ikon links spaltete ein Fleischerbeil immer wieder einen Schädel und legte ein kleines graues Gehirn frei. Neu geschriebener Text fand hier allmählich zu kräftigen schwarzen Buchstaben zusammen, als würden sie aus dem roten Gewaber auftauchen.
GOURMET: Hat er die Initiation bestanden?
DJINN-X: Noch nicht, aber das Opferlamm liegt schon auf dem Altar – heute Nacht hat er ihre Daten geschickt.
Das dritte Feld auf dem Bildschirm war strahlend weiß.
Am Rand stand der Name ‚Road Rage‘ in geschwungener Schrift, die auch in den Textzeilen verwendet wurde – beinahe kalligrafisch, aber gut zu lesen.
ROAD RAGE: Hat jemand schon die neue Meldung des Patrons gesehen?
„Okay.“ Djinn-X grinste. „Der Herr des Schreckens kommt zurück …“
GOURMET: Noch nicht. Wie viele Leichen sind’s denn diesmal?
ROAD RAGE: Nur fünf.
DJINN-X: Beim Patron spielt die Zahl keine Rolle, das weißt du genau. Bei ihm kommt es darauf an, wie er sie fertiggemacht hat. Bleib dran, ich sehe mal nach.
Er klickte sich in einen anderen Bereich der Website und überflog die Seite, dabei blickte er zuerst gespannt, dann schockiert und zuletzt voller Bewunderung auf den Bildschirm. „Leck mich am Arsch …“, flüsterte er. Hastig scrollte er die Seite herunter und wechselte dann zurück zum Chat.
DJINN-X: Nicht zu glauben. „Ertrank im Blut des jüngsten Kindes.“
Verdammt noch mal!
GOURMET: Er ist ein Genie.
ROAD RAGE: Er ist ein Monster. Selbst nach unseren Maßstäben.
Djinn-X schüttelte den Kopf und lehnte sich zurück. „Er ist beides, Jungs“, sagte er sanft. „Er ist beides.“
Stans Haus war zweigeschossig und sah den anderen Häusern in dieser Vorstadtsackgasse zum Verwechseln ähnlich: weiß gestrichen, mit roten Dachziegeln, einem Zaun aus kurzen Eisengeländern zwischen gemauerten Pfosten, auf denen billige Löwen aus Gips thronten.
Als der Wagen heranfuhr, öffnete sich das Garagentor automatisch. Der Lieferwagen hielt einen Block entfernt.
Von der Garage kam man direkt in die Küche. Stan ging voraus. Beigefarbener Linoleumboden, senfgelbe Küchengeräte.
Das Blassgelb der Resopal-Arbeitsplatte passte weder zum Kühlschrank noch zum Herd. Die Spüle war sauber, aber voll mit schmutzigem Geschirr. Ihre nassen Turnschuhe quietschten auf dem Linoleum.
„Dort ist das Schlafzimmer“, sagte Stan. Er war jetzt etwas lockerer. Das wurden sie alle, sobald sie in heimischen Gefilden waren. Sie gingen einen kurzen Flur entlang.
Das Zimmer war etwa so, wie sie es erwartet hatte: farblos, ein ungemachtes Ehebett, ein Haufen schmutziger Wäsche
auf einem Stuhl am Fenster. Die dunklen Vorhänge waren zugezogen. Ein Mief nach Moschus, ungewaschenen Laken und verbrauchter Luft.
„Könntest du, äh, deine Hände waschen?“, fragte Stan. „Bevor wir anfangen? Hier geht’s zum Bad.“
Er wies mit der Hand die Richtung. Das Bad lag gleich neben dem Schlafzimmer, die Tür öffnete sich nach innen.
„Klar. Du kannst es dir ja schon mal bequem machen.“
Er umrundete geräuschlos das Haus. Alle Türen waren abgeschlossen, aber von der Veranda führte eine Glasschiebetür hinein. Er zog einen Glasschneider aus der Reisetasche, die er über die Schulter gehängt hatte. In weniger als einer Minute hatte er einen Kreis ins Glas geritzt, die Scheibe herausgelöst und von innen die Tür entriegelt.
Er schob den Glasschneider wieder in die Tasche und zog etwas heraus, dessen Form und Größe an einen Rasierapparat erinnerte. Er schaltete es zur Probe ein; dort, wo normalerweise die rotierenden Scherköpfe lagen, sprang zwischen zwei Elektroden ein blauer Blitz über. Er hielt den Elektroschocker bereit und trat über die Schwelle.
Nikki ging ins Badezimmer und ließ die Tür hinter sich offen.
Es war schmal und bedrückend. Fußboden und Wände waren weiß gekachelt. Sie sah weder Handtuchstange noch Handtücher, keinen Spiegel und kein Fenster. Von der Decke spendete eine Einbaulampe Licht, und über der Toilette war ein Ventilator eingebaut. Es gab eine Badewanne mit einer Duscharmatur, aber ohne Duschvorhang. Außer einer fast leeren Rolle Klopapier an der Wand sah sie keinerlei Toilettenartikel.
Das Waschbecken lag an der gegenüberliegenden Wand, und Nikki musste zum Händewaschen ganz hineingehen.
Sie rümpfte die Nase; hier roch es wie im Keller eines Parkhauses.
Sie ging vorsichtig hinein und drehte am Waschbecken den Wasserhahn auf. Es kam kein Wasser.
„Hey, dein Waschbecken ist kaputt …“
Hinter ihr schlug die Tür zu. Auf der Rückseite war jetzt ein Plakat zu sehen. Ein Kätzchen lag auf einem Ast, darunter stand ‚Einfach mal abhängen!‘.
„Stan?“
Sie zog an der Tür. Abgeschlossen. Sie schaute sich um, zog dann ihr Handy aus der Handtasche und drückte eine Taste.
Im Display erschien die Meldung Kein Netz.
Hinter der Tür gab es einen lauten, dumpfen Schlag. Nikki steckte das Handy zurück in ihre Handtasche – und zog stattdessen einen .38er heraus.
„Ich habe eine Knarre, Stanley. Mach die verdammte Tür auf, oder ich blas dir den Türgriff weg!“
Auf der anderen Seite hörte sie eine krächzende Stimme. Es klang, als wisperte jemand in eine Flüstertüte, die auf volle Lautstärke aufgedreht war.
„Stanley ist im Moment nicht zu sprechen. Er ist … beschäftigt.“
Nikki drückte ab. Der Türgriff war ein massives Industriemodell; die Kugel prallte an ihm ab und zerschlug eine Fliese neben dem Duschkopf.
„Probier’s noch mal, schieß auf die Tür“, flüsterte die Stimme. „Wie viel Schuss bleiben dir noch?“
Nikki zögerte, dann schlug sie mit dem Revolvergriff gegen die Tür. Es klang wie Metall. Sie befühlte einige Kerben, die offenbar erst kürzlich überstrichen worden waren, und nickte langsam.
„Schau hinter das Plakat“, flüsterte es von draußen.
Sie zog das Poster weg. Dahinter waren sechs Fotos mit Tesa an die Tür geklebt; drei davon stammten offenbar aus einer Schwarzweiß-Überwachungskamera über der Badezimmertür. Sie zeigten drei verschiedene Frauen, zweifellos Prostituierte, und alle drei mit langen blonden Haaren. Die erste starrte verwirrt auf ihr Handy, die zweite schlug mit einem Pistolenknauf wütend auf die Tür ein, die dritte war nackt und flehte mit gefalteten Händen, während sich ihre Wimperntusche in Tränen auflöste.
Die anderen drei Fotos waren Polaroids in Farbe. Auf ihnen waren dieselben drei Frauen zu sehen, alle mit aufgeschlitzter Kehle.
Sie sah nach oben. Wenn man es wusste, konnte man die Spion-Kamera über der Tür erkennen. Sie klaubte den Kaugummi aus ihrem Mund und klebte ihn über die Öffnung.
Mit einem Zischen strömte Gas aus dem Duschkopf.
„Was für ein Typ bist du?“, säuselte die Stimme.
„Das sag ich dir, wenn du das Gas abdrehst“, entgegnete sie kühl.
„Eine, die verhandelt. Gut. Die sind mir lieber, wirklich. Die Hinterhältigen mag ich nicht besonders. Mach die Kamera wieder frei, dann werden wir uns schon einig.“
Sie gehorchte. Das Zischen verstummte, aber der stechende Geruch hing weiter im Raum. Es brannte in der Nase, obwohl sie nur ganz flach atmete.
„Siehst du. Mit mir kann man reden. Schieß los.“
„Schieß los mit was?“
„Mach ein Angebot.“
„Dir einen zu blasen reicht vermutlich nicht, nehme ich an.“
Krächzendes Gelächter. „Da musst du schon mehr bieten. Mir haben Frauen schon angeboten, meine Sklavin zu sein, sich von Hunden ficken zu lassen oder ihre eigene Scheiße zu essen. Eine hat mir sogar ihre beste Freundin an ihrer Stelle angeboten.“
„Was ist mit denen, die nichts anbieten?“
„Oh, die mir drohen? Immer die gleichen Geschichten – mein Freund ist bei der Mafia, ich bin bei der Polizei, ich habe Aids. Eine belegte mich sogar mit einem Voodoo-Fluch – das war lustig. Aus denen, die mir drohen, werden früher oder später welche, die flehen.“
„Hast du schon mal eine laufenlassen?“, fragte Nikki.
„Na, was glaubst du?“
„Ich glaube, ich werde dir einen Fingernagel ausreißen“, meinte Nikki nachdenklich. „Oder besser, zwei.“
„Das ist aber ganz schön fies …“
„Ich weiß, ich weiß. Sonst macht er ja die ganze Arbeit – manchmal bring ich’s nicht mal fertig, im selben Zimmer zu bleiben. Aber bei dir, mein Süßer, da mache ich mal eine Ausnahme.“
„Und wer soll das sein? Dein großer, böser Zuhälter, der mit seinem dicken Cadillac angerauscht kommt und dich rettet?“
„Nicht doch. Aber er macht das Gleiche wie du.“
„Und was soll das sein?“
„Er bringt Leute um. Und zwar langsam.“
„Klar tut er das …“
Plötzlich war ein kurzes, elektrisches Knistern zu hören, dann schlug etwas Schweres gegen die Tür. Sie schwang langsam zur Seite. Ihr Partner stand mit einem Elektroschocker in der Tür. Stanley lag bewusstlos vor seinen Füßen.
Nikki zündete sich eine Zigarette an und schaute auf Stanley herunter. „Das ist der Closer, du armseliger Bastard. Und jetzt tust du mir schon fast ein bisschen leid.“
Sie trat ihm hart gegen den Kopf.
„Fast“, zischte sie.
Als Stanley aufwachte, war er in seiner eigenen Küche nackt an einen Stuhl gefesselt. Unter dem Stuhl lag eine Gummimatte. Seine Hände waren vor dem Bauch zusammengebunden und mit den Knien verschnürt. Sein Mund war mit breitem Klebeband verschlossen.
Der Closer kam mit einer schwarzen Tasche herein, setzte sie auf einem Stuhl ab und packte aus. Der Mann war etwa dreißig und hatte mittellanges, braunes Haar, das offenbar schon länger nicht mehr mit einem Kamm in Berührung gekommen war. Er trug einen Trenchcoat aus schwarzem Leder. Sorgfältig breitete er den Inhalt der Tasche auf dem Tisch aus.
Eine Schachtel Einmalhandschuhe aus Latex.
Einen kleinen Schraubstock, ein Beil und eine Zange.
Eine Gartenschere.
Eine Bügelsäge und einen Karosseriehammer.
Eine Packung Rasierklingen, eine Klarsichthülle voller Angelhaken und eine Packung Tafelsalz.
Ein Fläschchen Feuerzeugbenzin, eine Flasche Abflussreiniger und eine große Kanüle.
Ein elektrisches Messer.
Eine Propangas-Lötlampe.
Als Letztes zog er einen kleinen Kassettenrekorder und ein halbes Dutzend Leerkassetten heraus.
„Also gut“, sagte er ruhig und zog sich ein Paar Wegwerfhandschuhe an. Er legte eine Kassette ein und drückte den Aufnahmeknopf.
„Wir wollen ganz vorne anfangen …“
Er streckte die Hand vor und riss Stanley das Klebeband vom Mund.
Mit der anderen Hand griff er die Säge.
In einem Schuhkarton im Kleiderschrank wurde sie fündig: Acht weiße Stoffservietten, jede sorgfältig zu einem Dreieck gefaltet und einzeln in Klarsichthüllen verpackt. Jedes Tuch trug in der Mitte einen scharlachroten Lippenabdruck – einen konservierten Kuss.
Nikki untersuchte den Fund. Auf jede der Plastikhüllen war hinten mit Filzschreiber ein Buchstabe geschrieben. Sie stieß auf eine mit einem G, und in ihr krampfte sich etwas zusammen.
„G … Genevieve? Bist du das?“
Sie setzte sich aufs Bett, zog sich die blonde Perücke vom Kopf und warf sie zur Seite. Sie starrte durch die Klarsichtfolie auf den Kussmund und fuhr mit dem Finger seine Kontur nach. Mit einem Mal fühlte sie sich unendlich erschöpft, als sei ihr Körper tonnenschwer.
„Oh, Genny. Ich hoffe bloß, dass du es dort, wo du jetzt bist, besser hast, Süße. Vielleicht hilft dies ja.“
Aus der Küche war ein gedämpfter, schmerzerfüllter Schrei zu hören.
Nikki drückte ihre Zigarette in einen großen, leeren Aschenbecher neben dem Bett. Sie ließ die Hülle auf den Boden fallen und vergrub ihr Gesicht in den Händen.
„Ich weiß, dass du lügst.“
„Nein! Nein! Ich schwör’s bei Gott!“
„Du bist genauso leicht zu durchschauen wie deine Opfer. Zuerst behauptest du, es sei gar nichts passiert, alles sei nur ein Spiel gewesen. Dann kehrst du den harten Kerl raus und sagst, ich könne dir nichts nachweisen und drohst, mich zu verklagen. Wenn das nicht fruchtet, versuchst du mich zu bestechen, und zum Schluss kommt das Flehen.“
„Ich sag die Wahrheit, bitte, Jesus Christus …“
„Das bringt uns zur nächsten Phase.“ Der Closer drehte sich zum Tisch und wählte eine Rasierklinge. Dann beugte er sich gespannt nach vorn. „So machen wir’s, wenn du lügst. Du erzählst mir jetzt etwas, das ich nachprüfen muss, denn dir bleibt jetzt nur noch eine Möglichkeit: Verzögerung.“
Er stopfte Stanley einen Lappen in den Mund, um seine Schreie zu dämpfen, und begann mit schnellen, präzisen Schnitten. Die Haut ließ sich leicht abschälen. Mit Angelhaken steckte er die losen Streifen oben an den Ohrmuscheln fest.
„Wir sind jetzt in der Phase, in der du anfängst, die Wahrheit zu sagen.“
Stanley nickte. Aus seinen Augen rannen Tränen. Er gab ein gedämpftes Jaulen von sich, als die salzigen Tropfen über das freigelegte Fleisch seiner Wangen rannen.
„Nimm das als einen Vorgeschmack“, sagte der Closer. Er nahm die Packung Salz vom Tisch.
Er griff nach Stanleys Knebel, hielt dann inne. Die beiden Hautlappen waren zu den Seiten gespannt. Ihr Muster roter und blauer Äderchen hatte eine ganz eigene, groteske Ästhetik – wie die Flügel eines fleischigen Schmetterlings, mit Stanleys Nase als Körper.
Der Closer schüttelte den Kopf und zog den Knebel heraus.
„Schau im Gefrierschrank nach“, japste Stanley. „Schau in den Gefrierschrank, ich hab’s für die Initiation gemacht. Ich sag dir alles, was ich über sie weiß, nur bitte, bring mich nicht um …“
Und dann erzählte Stanley ihm einige äußerst interessante Dinge.
Sieben Stunden später
Der Closer hob eine Hand mit einem blutverschmierten Handschuh und schob die Schlafzimmervorhänge einen Spalt auseinander. Die Morgensonne strahlte herein. Draußen trug ein Junge Zeitungen aus. Vor dem Haus gegenüber küsste eine Frau ihren Mann, bevor er die Kinder zur Schule fuhr. Der Closer starrte sie mit zusammengekniffenen Augen an.
In der Küche saß Nikki am Esstisch. Blutige Geräte lagen darüber verstreut.
„Weißt du, was sie an ihren freien Tagen gemacht hat?“, fragte sie Stanley. „Sie hat sich gemütliche Klamotten angezogen, eine Baseballmütze, und ist ungeschminkt losgezogen, um sich einen Typen anzulachen. Ohne Scheiß. In Bars ist sie nicht gegangen, aber sonst überallhin: in den Park, die Stadtbücherei, den Tante-Emma-Laden. Sie wollte jemanden kennenlernen, der nicht bloß ficken will. Ich hab ihr gesagt, die Kerle wollen alle bloß ficken – der Unterschied ist nur, dass manche bereit sind, dafür zu bezahlen. Das ist unser Glück.“ Sie machte eine Pause und kramte nach einer Zigarette.
„Außer es kommt so ein Arsch wie du daher, Stanley, und dann ist alles plötzlich ganz beschissen.“ Sie zündete sich mit zitternden Händen die Zigarette an.
„Ich hab mir immer wieder vorgestellt, was ich dir sagen würde, du Scheißkerl. Was ich sagen würde, wenn wir dich endlich hätten. Und jetzt kommt es mir vor, als würde das gar keine Rolle mehr spielen.“ Sie schüttelte den Kopf und lachte bitter.
„Aber da sind ein paar Dinge, die du wissen sollst. Sie hieß in Wirklichkeit Janet, nicht Genevieve, und … und alle mochten sie gern. Sie war ein herzensguter Mensch. Sie liebte diese furchtbare Discomusik und ging gern in die Shoppingmalls. Sie mochte alte Autos aus den Fünfzigerjahren und trank gern Bier, und sie war keine verdammte Trophäe, die man einfach so in einen Schuhkarton steckt, nachdem man sie umgebracht hat, du krankes Arschloch!“
Eines von Stanleys Augen hing aus der Augenhöhle. Wenn er zuckte, baumelte es vor seinem Gesicht.
„Töte mich …“, flüsterte Stanley.
„Sonst nichts? Das kannst du haben, du Arsch.“
Sie griff nach dem Beil und hob es über ihren Kopf. Bevor sie durchziehen konnte, hielt es der Closer von hinten fest.
„Nein.“
Wütend wirbelte Nikki herum. Sie ließ das Beil nicht los.
„Zum Teufel, warum nicht? Du hast gesagt, du seist fertig mit ihm!“
„Das bin ich auch. Aber ich kann nicht zulassen, dass du ihn tötest.“
Tränen aus Wut und Trauer liefen über Nikkis Gesicht. „Er hat meine Freundin umgebracht, gottverdammt!“
„Das weiß ich. Aber wir haben nun mal diese Abmachung getroffen, als wir beschlossen, zusammenzuarbeiten. Du übernimmst das eine Risiko, ich das andere.“
Sie starrte ihn wütend an. Dann ließ sie das Beil los.
„Du sollst kein Blut an deinen Händen haben, Nikki. Noch nicht mal seines.“
„Okay, okay.“ Sie sah ihm fest in die Augen. „Aber diesmal – werde ich zusehen.“
Er erwiderte ihren Blick ohne jede Regung.
„Also gut.“
Er drehte sich ohne Vorwarnung um und hieb das Beil in Stanleys Schädel.
Dymund und Fimby erreichten Stanleys Haus gegen viertel nach drei. Am Ende der Sackgasse drängten sich bereits drei Streifenwagen, der Kombi des Coroners und ein Übertragungswagen. Auf der anderen Straßenseite standen Nachbarn verschreckt in einem Grüppchen zusammen.
Dymund war der Leiter des Morddezernats. Er stand kurz vor seiner Pensionierung, war groß und massig und hatte dünnes, weißes Haar, das er mit Frisiercreme nach hinten kämmte.
Fimby hatte eine birnenförmige Figur und ein ebensolches Gesicht mit einem gewaltigen, melierten Schnurrbart, der seine fleischigen Hängebacken nur teilweise verdeckte. Beide Kriminalbeamte trugen beige Trenchcoats und Filzhüte – weniger aus Eitelkeit, sondern weil es in Seattle selten zu regnen aufhörte.
„Das war er todsicher“, sagte Dymund, als sie ins Haus gingen und dem uniformierten Beamten ihre Plaketten zeigten.
„Glaub ich nicht“, gab Fimby zurück.
„Er muss es einfach gewesen sein.“
„Völlig ausgeschlossen.“
Sie traten in die Küche und blieben mit weit aufgerissenen Augen stehen.
„Okay“, sagte Fimby kleinlaut. „Er war es doch.“
„Das will ich meinen.“
Dymund beugte sich vor, um die Leiche besser sehen zu können, während Fimby ein Paar Gummihandschuhe anzog.
„Keine Frage, hier war der Closer am Werk“, seufzte Dymund. Fimby nahm eine der ordentlich aufgestapelten Kassettenschachteln vom Tisch.
„Vier Kassetten“, bemerkte er, „mit je neunzig Minuten, macht sechs Stunden.“
„Gründlich ist er, das muss man ihm lassen.“
Ein Streifenbeamter kam herein. Sein Gesicht war aschfahl, und er vermied es, auf Stanleys Überreste zu blicken.
„Detective? Da ist noch eine Leiche.“
Er ging voran in ein Hinterzimmer. Ein Polizeifotograf machte gerade Bilder von einem geöffneten Kühlschrank.
Dymund und Fimby äugten dem Fotografen über die Schulter.
Eine junge Frau, nackt. Ihre Kehle war aufgeschlitzt.
„Rechte Hand fehlt“, bemerkte Fimby.
„Sieht mir nicht nach dem Closer aus, oder? Hat wahrscheinlich der Typ in der Küche verbrochen – werden wir wohl erfahren, wenn wir die Bänder anhören.“
„Detective?“, meldete sich noch einmal der Streifenpolizist, ein pickeliger Junge mit blondem Bürstenhaarschnitt.
„Warum nennen Sie ihn den Closer?“
„Lesen Sie keine Zeitung?“, fragte Dymund.
SERIENMÖRDER-KILLER SCHLÄGT WIEDER ZU!
WEEKLY WORLD NEWS, 4. Juni 1999 – Seattle, Washington
‚Der Closer‘ hat wieder zugeschlagen. Er wird so genannt, weil er in Vigilantenmanier im Alleingang ungeklärte Mordfälle abschließt. Auch diesmal machte er dem Treiben eines geistesgestörten Mörders ein Ende: Stanley Dupreiss wurde von der Polizei im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod von mindestens acht Prostituierten gesucht. Von den Ermittlungsbehörden waren keine Einzelheiten über die Umstände von Dupreiss' Tod zu erfahren – es wird indes vermutet, dass er ebenso verstümmelt aufgefunden wurde wie die anderen Opfer des Closers.
Dies ist mittlerweile der vierte Fall, in dem ein Serienmörder der grausigen Selbstjustiz des Closers anheimfiel, und noch immer tappen die Ermittlungsbehörden auf beiden Seiten der US-kanadischen Grenze im Hinblick auf seine Identität völlig im Dunkeln – oder?
Hinter vorgehaltener Hand ist zu hören, die Polizei betreibe die Fahndung nach dem Closer nur mit mäßigem Eifer.
„Warum zum Teufel sollten wir das auch?“, äußerte ein Polizist, der es vorzog, ungenannt zu bleiben. „Er erledigt doch die Arbeit für uns. Warum sollen wir Steuergelder für eine Sonderkommission verschwenden, die ihm das Handwerk legt, wenn er doch genau das tut, was die meisten von uns am liebsten selbst täten? Es würde doch Millionen kosten, diese Verrückten aufzuspüren, zu verurteilen und einzusperren. Und hier ist ein Typ, der ihnen im Alleingang das verpasst, was sie verdienen.“
Aber wie stellt er es an? Ist die Polizei mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tatsächlich so unfähig, dass sie sich von einem entschlossenen Einzelkämpfer nicht ein-, sondern gleich viermal die Butter vom Brot nehmen lässt? Oder steckt eine noch dunklere Wahrheit dahinter? Ist der Closer vielleicht einer von ihnen, ein abtrünniger Polizist, der beschlossen hat, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen?
Dies wäre nach Ansicht vieler eine Erklärung nicht nur für die Zurückhaltung der Polizei bei der Jagd auf den Closer, sondern auch für dessen frappierende Fähigkeit, seine Opfer aufzuspüren. Falls er tatsächlich Zugang zu Polizeiakten hätte, dann bräuchte er sich die Verdächtigen ja nur herauszupicken.
Bislang waren die Opfer des Closers allesamt selbst Mörder, die eine Bestrafung für ihre Verbrechen verdienten. Doch selbst der Polizei unterlaufen Fehler – was geschieht, wenn sich der Closer einmal irrt?
Bleibt nur zu hoffen, dass man nicht auf seiner Liste steht.
Charlie Holloway lehnte sich im Stuhl zurück und gähnte; es war ein langer Tag gewesen. Sein Blick fiel auf sein eigenes Porträt an der gegenüberliegenden Wand, und er fragte sich, wie lange es wohl dauern würde, bis er seinem Abbild in Öl nicht mehr gleichsah. Die gewaltige Kartoffelnase würde ihm natürlich bleiben, aber das volle, schwarze Haar auf dem Bild war inzwischen größtenteils verschwunden und schon längst nicht mehr schwarz. Mit den Lebensjahren waren auch Pfunde hinzugekommen, die sein Gesicht merklich gerundet hatten, und seine blauen Augen – nach Ansicht seiner Mutter sein bestes Merkmal – waren hinter den Brillengläsern kaum zu sehen.
Ach, wäre doch Dorian Gray einer meiner Kunden, dachte Charlie wehmütig. Trotzdem wird das Bild eines Tages ein Vermögen wert sein …
Das Telefon riss ihn aus seinen Gedanken.
„Hallo, Holloway am Apparat.“
„Charlie.“
„Jack? Mann, gerade habe ich an dich gedacht.“ Charlies Stimme, eben noch freundlich, bekam nun einen besorgten Unterton. „Wie geht’s dir?“
„Ich … ich weiß nicht. Geht so, denke ich.“
„Hab schon eine Weile nichts mehr von dir gehört. Warst wohl beschäftigt?“
„Ja, schon.“
„Gearbeitet, hoffe ich.“
„Eigentlich nicht.“
„Das hör ich aber nicht gern“, sagte Charlie und schüttelte den Kopf. „Ich will dich ja nicht drängen, Jack, aber …“
„Aber es ist jetzt drei Jahre her, und ich sollte langsam drüber hinweg sein.“
Charlie seufzte und rieb sich die Nasenwurzel. „Nein, so meine ich das doch nicht. Was passiert ist, ist grauenhaft, und es ist nicht nur ihnen passiert, sondern auch dir. Ich will das gar nicht kleinreden, und ich erspar dir auch das New-Age-Gefasel über inneren Frieden und so …“
Falmi kam mit einem Klemmbrett herein. Charlies Assistent war ein Goth – fast zum Skelett abgemagert, mit einer rabenschwarzen Igelfrisur und der Hautfarbe von Vanille-Eiscreme. Seine Lider waren mit Kajal nachgezogen, und keltische Tattoos rankten sich an den Seiten seines Halses hinauf.
Charlie hatte ihn nie etwas tragen sehen, das nicht entweder schwarz oder chromfarben war. Heute waren schwarze Jeans dran, dazu ein schwarzes T-Shirt und nietenbesetzte, schwarze Lederhandschuhe. „Charlie?“, fragte er mit hoher, näselnder Stimme.
„Einen Moment, Jack. Was gibt’s?“
„Sie müssen das Manifest hier unterschreiben.“
Charlie grunzte, griff das Klemmbrett und signierte.
Für einen Goth war Falmi außerordentlich kleinlich, aber Charlie schätzte an ihm gerade diese Genauigkeit. Er reichte das Dokument zurück, und Falmi verschwand.
„Entschuldigung, Jack. Ich meine ja bloß, dieser Schmerz, den du mit dir herumträgst – der ist ja völlig real. Er hat Gewicht, Tiefe, und außerdem ist er hochgiftig. Wenn du ihn nicht irgendwie aus dir herausbringst, dann wird er dich noch von innen auffressen.“
„Du hättest Schriftsteller werden sollen, Charlie.“
Charlie grinste. „Das mit der Kreativität überlasse ich lieber wirklichen Künstlern wie dir, besten Dank. Mir genügt es völlig, dein Zeug zu verreißen und dabei meinen Schnitt zu machen.“
„Dann bist du wohl gerade nicht besonders zufrieden, was? Da ist ja im Augenblick nicht viel von mir zu verreißen …“
„Schau, so hab ich’s doch nicht gemeint – ich denke doch bloß, dass es dir besser ginge, wenn du arbeiten würdest, das ist alles. Das Wirtschaftliche lassen wir mal schön außen vor. Tu’s für dich.“
„Kunst als Therapie.“
„Ja, mein Gott, warum auch nicht. Probier’s doch wenigstens.“
„Besten Dank, Charlie – aber ich bin ja schon in Behandlung. Ziemlich radikaler Ansatz, wenn du mich fragst, aber es scheint zu helfen.“
„Ach ja? Na, wenn es hilft … Das ist das Wichtigste.“
„Ich dachte, ich komme mal vorbei.“
„Großartige Idee, Jack. Wann immer du willst.“
„Mein Terminplan ist noch etwas … unklar im Augenblick.
Ich melde mich, wenn sich das geklärt hat.“
„Tu das.“
„Dann bis bald, Charlie.“
„Je eher, desto lieber.“
Jack legte auf. Auch Charlie legte den Hörer ab und sah auf zu dem Porträt, das Jack von ihm gemalt hatte. Er runzelte nachdenklich die Stirn.
„Können wir?“, fragte Nikki.
„Yeah“, sagte der Closer und legte das Telefon weg. „Ich bin fertig.“
Kunst als Therapie. Das war nicht das Problem.
Aber Therapie als Kunst …
Zwischenspiel
Liebes Tagebuch: Ich, Fiona Stedman, bin mir jetzt darüber im Klaren: Ich bin verliebt in meinen Onkel Rick.
Also gut, vielleicht nicht verliebt – aber ich habe mich ganz schön in ihn verguckt. Er ist vierundzwanzig, zehn Jahre älter als ich, aber mein Dad ist auch zehn Jahre älter als meine Mom, also ist der Unterschied gar nicht so groß. Und niemand versteht mich so gut wie er.
Von den anderen macht niemand auch nur den Versuch.
Dad arbeitet immer bis spät in die Nacht, und Mom ist von ihren Wohltätigkeitsveranstaltungen immer so gestresst, dass sie ständig schlechte Laune hat. Und meine sogenannten Freunde kann man komplett vergessen; die lästern schon, ich könne es „kaum erwarten, meinem Onkel an die Wäsche zu gehen“ – wenn die wüssten, wie es wirklich um mich steht, hätte ich überhaupt keine Ruhe mehr.
So bleibt mir zum Ausheulen nur eine elektronische Schulter mit dem lächerlichen Namen ‚Liebes Tagebuch‘. Nimm’s mir nicht übel, aber das ist mir dann doch zu abgedroschen – wie wär’s also mit einem anderen Namen?
Hmmm. Wie findest du Elektra? Na? Also gut, dann noch mal von vorn … Liebe Elektra: Heute war’s echt beschissen. Ich hab Mom gefragt, ob ich zum Konzert der Undulating Fools gehen könne, und sie hat gesagt, ausgeschlossen. Ich hab ihr erzählt, dass meine Freunde auch hingehen, aber das machte es nur schlimmer, als wäre ich in einer Straßengang oder so was.
Weißt du übrigens, Elektra, dass du deine Existenz meinem Onkel Rick verdankst? Bezahlt haben dich schon meine Eltern, aber Onkel Rick hat dich ausgepackt und hat geholfen, dich zum Laufen zu bringen. Ohne ihn wärst du wahrscheinlich noch immer im Karton.
Seufz. Onkel Rick. Es ist wirklich nicht fair, dass wir miteinander verwandt sind. Elektra, er sieht so gut aus.
Groß, dunkle Locken, große braune Augen, ein strahlendes Lächeln … und außerdem ein ganz ansehnlicher Körper. Letzten Sommer war er mit uns am Strand, und ich musste mich richtig beherrschen, ihn nicht immerzu anzustarren. Er ist ja kein Bodybuilder oder so was, aber Muskeln hat er trotzdem – und behaart wie ein Affe ist er auch nicht, nur ein kleines Lockenpolster mitten auf der Brust.
Mein Gott, was ist bloß los mit mir? Ich hab ja noch nicht mal einen Jungen geküsst, und trotzdem fantasiere ich schon, mein Onkel wäre mein Geliebter oder so was. Das ist ganz schön merkwürdig.
Hab ich erzählt, dass er Motorrad fährt? Manchmal nimmt er mich mit, und ich lege die Arme um seine Taille und mein Gesicht ganz nah an seinen Hals. Er riecht nach Leder und Zigaretten und nach irgendwas Süßem.
Es ist einfach nicht fair.
2
Jack kannte sich mit Computern aus. Vielleicht war er nicht ganz so versiert wie Stanley, aber es reichte, um die richtigen Fragen zu stellen. Und deshalb hatte er, als Stanley zu reden angefangen hatte, eine neue Kassette in den Rekorder eingelegt – und diese nicht für die Polizei liegen lassen.
Zwei Dinge nahm er aus Dupreiss’ Haus mit: Stanleys Laptop – und die rechte Hand der Toten im Eisschrank. Er kannte inzwischen Stanleys sämtliche Passwörter. Er wusste, wie man die Fußangeln entschärfte, die Stanley für den Fall seiner Verhaftung in sein System eingebaut hatte, um gewisse Dateien zu löschen. Er wusste auch, was mit der abgetrennten Hand der Prostituierten zu geschehen hatte.
Er wusste nun über das ‚Jagdrevier‘ Bescheid.
Im Motelzimmer, das er mit Nikki bewohnte, schloss er den Computer an. Das Motel lag gleich beim Flughafen von Seattle und wurde daher besonders von Geschäftsreisenden frequentiert; jedes Zimmer besaß einen eigenen Internetzugang. Der Laptop war ein Topmodell mit allen möglichen Extras – für die Verbindung zum Web brauchte man es nur einzustöpseln.
Nikki war unterwegs, um sich etwas zu essen zu besorgen.
Jacks Hunger ging in eine andere Richtung.
Er fand die Website sofort. Das Wallpaper der Seite war ein schimmerndes Beige, darauf in Schwarzbraun die Worte ‚Das Jagdrevier‘; es dauerte einen Moment, bis er begriff, dass die Buchstaben in die Haut eines Menschen eingebrannt waren.
Er loggte sich ein unter dem Namen, den er in Stanleys Dateien gefunden hatte: Deathkiss. Er wurde zur Eingabe eines Passworts aufgefordert und tippte Dachau.
Es lag eine Nachricht für ihn bereit. Der Bildschirm war nun schwarz. Oben war das Foto einer Frau zu sehen, die mit verbundenen Augen an einen Stuhl gefesselt war. Ihre Lippen bewegten sich; dann tropften blutrote Buchstaben auf den Bildschirm.
Deine Trophäe ist heute eingetroffen. Die Fingerabdrücke passen. Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Vollstreckung, Deathkiss – und willkommen im Rudel.
„Danke“, flüsterte Jack. „Ich bin sicher, wir beide werden uns noch richtig nahekommen …“
Jack war der Meinung, Pablo Picasso habe es auf den Punkt gebracht: „Computer sind nutzlos. Sie können dir nur Antworten geben.“
Jacks Gebiet war das Stellen von Fragen. Im Verlauf der letzten beiden Jahre hatte er diese Gabe perfektioniert – allerdings fragte er auch auf ganz spezielle Art. Bei seinen Verhören hatte er eine Menge gelernt; jetzt musste sich zeigen, was dieses Wissen wert war.
Er surfte durch die verschiedenen Bereiche des Jagdreviers.
Die Website funktionierte nach dem Prinzip von Geben und Nehmen. Alle Menüs und Unterverzeichnisse waren frei zugänglich; wer jedoch genauere Informationen wollte, musste dafür auch etwas von sich selbst preisgeben.
Er klickte auf einen Bereich namens Territorien. Es erschien eine Karte von Nordamerika, dazu ein Pop-up-Fenster mit Text.
Dort stand:
Also gut, du willst jetzt wissen, wer genau wo jagt. Falls sich dein Jagdrevier mit einem anderen überschneidet, solltest du dir nicht allzu große Sorgen machen – du siehst, das kommt häufig vor. Aber es ist ja reichlich Jagdwild für alle da, nicht wahr? Wichtig ist, dass du deine Jagdgenossen respektierst. Wenn du vorhast, im Revier eines anderen Jägers aktiv zu werden, solltest du ihn das wissen lassen, zu deinem eigenen Vorteil – er kennt das Terrain sehr viel besser und kann dich auf mögliche Schwierigkeiten aufmerksam machen. Vergiss nie: Wir stehen gegen alle anderen. Das Rudel jagt gemeinsam.
Unter dem Text war eine Schaltfläche mit der Aufschrift ‚Revier markieren‘. Er klickte den Knopf, und der Cursor wurde zu einem kleinen, bösartig grinsenden Wolf. Wenn er die Maus bewegte, hob der Wolf das Hinterbein und hinterließ eine gelbe Linie.
Jack zog einen Kreis um Seattle, erweiterte dann den Bereich nach Norden bis Vancouver in Kanada. Dann klickte er auf ‚Beenden‘.
Auf der Karte erschien nun ein Durcheinander von Farbmustern; jedes stand für das Jagdrevier eines Mörders. Jack klickte auf Nevada. Es gehörte einem gewissen Gourmet, der elf Morde auf seinem Konto hatte. Mit einem Klick auf den Link-Knopf erfuhr er, dass er erst sein eigenes Profil erstellen musste, bevor er zu den anderen Verbindung aufnehmen konnte.
Damit verbrachte er die folgende Stunde, wobei er das meiste frei erfand. Er benutzte die Daten der von Stanley genannten Opfer nur, wo aus Dupreiss’ Aufzeichnungen hervorging, dass er diesen speziellen Mord schon erwähnt hatte. Die Identität von Deathkiss sollte sich so stark wie möglich von der Leiche unterscheiden, die er für die Polizei zurückgelassen hatte. Dies wurde auf der Website sogar empfohlen und vor der Angabe von Details gewarnt, die auf seine wahre Identität schließen ließen. Stattdessen wurde nach den genauen Lokalitäten der Leichen gefragt.
Erinnerst du dich an den Fall von Richard Olsen in Kanada?, wurde in einem eingeblendeten Textfenster gefragt. Der Fundort der Leichen brachte ihm hundert Riesen in bar für seine Familie. Wissen ist Macht. Wenn du festgenommen wirst, kannst du dieses Wissen zu deinem Vorteil verwenden.
Und das funktioniert so: Benutze die Lokalitäten der Leichen als Trümpfe bei der Verhandlung. Biete sie als Gegenleistung für Strafminderung, oder für Auslieferung in einen Bundesstaat ohne Todesstrafe. Nenne der Polizei aber nicht die Orte, an denen deine Opfer liegen, sondern die eines anderen. Behaupte, dass es deine Opfer sind. Das wird die Bullen völlig durcheinanderbringen. Wenn du später dann ein Alibi lieferst, das deiner ersten Aussage widerspricht, könntest du sogar ungestraft davonkommen!
Jack klickte auf eine Schaltfläche namens Grabstellen. Das Formular war aufgemacht wie eine Baseball-Sammelkarte, mit freien Flächen für ein Foto und die Lebensdaten des Opfers. Am oberen Rand der Karte stand ‚Sammle sie alle!‘
Tauschkarten.
Jack starrte einige Augenblicke lang auf den Bildschirm und öffnete und schloss dabei seine Fäuste. „Du mieses, krankes Aas“, zischte er. „Du bist das also. Hast diese Website entworfen. Und hast all die anderen hier zusammengebracht.“
Er streckte die Hand aus und drückte sie an den Bildschirm, als könne er hineingreifen und dem Schöpfer der Seite die Finger um den Hals legen.
Von Stanley wusste er seinen Namen. Djinn-X.
„Du bist das also“, sagte der Closer leise. „Ich werde dich töten, und zwar zuerst.“
„Marketing-Manager und Aktienhändler“, sagte Djinn-X.
„Ich kann dir nicht sagen, welche von beiden ich mehr hasse.“
Djinn-X saß mit angezogenen Beinen auf einem Skateboard.
Sein Gesprächspartner war mit billiger Paketschnur an einen Gartenstuhl gefesselt und hatte ein Stück weißes Klebeband über dem Mund. Der Stuhl stand in der Mitte eines sechzig Meter langen Korridors. Raue Spanplatten bildeten den Boden, an den Seiten lagen Verschläge aus Holzlatten, jedes Lagerabteil drei mal drei Meter groß, in drei Etagen. In zehn Metern Höhe summten Neonröhren wie ein ganzes Gefängnis voller Bienen. Es war kurz nach drei Uhr morgens.
Djinn-X zog die Schuhbänder an beiden Inline-Skates seines Gefangenen stramm. Dann wickelte er um ein Fußgelenk weißes Klebeband. „Beide sind Parasiten. Blutsauger. Der Werbemann lässt sich raffinierte Lügen einfallen, damit die Leute die Produkte seines Kunden kaufen, und der Aktienhändler schiebt auf raffinierte Weise kleine Zettel hin und her, damit die Reichen reicher und die Armen ärmer werden. Keiner von beiden schafft irgendetwas von Wert, beide saugen nur eine unanständige Menge Geld aus der Wirtschaft.“
Der Gefangene zwinkerte, da ihm der Schweiß in die Augen rann. Er war etwa Mitte vierzig, gut aussehend, hatte den sehnigen Körper eines Läufers und gepflegtes, kurzes, schwarzes Haar. Sein Name war Michael Fitzpatrick. Außer den Inlinern hatte ihm Djinn-X einen weißen Papieroverall angezogen, wie ihn Maler verwenden.
„Als Marketing-Manager siehst du das möglicherweise anders“, fuhr Djinn-X fort. Beide Schuhbänder waren nun bis zur Schienbeinmitte unter einer dicken Schicht von Klebeband verborgen.
Djinn-X stand auf und schob das Skateboard mit dem Fuß zur Seite. Auf dem Brett waren Aufkleber mit Logos von Musikgruppen, deren Namen Fitzpatrick noch nie gehört hatte. Sein Entführer trug ein schwarzes T-Shirt mit einem grünen Totenschädel auf der Brust, dazu zerrissene Jeans und ramponierte Armeestiefel.
„Aber soll ich dir was sagen? Ich glaube, ihr Werbefritzen seid doch die Schlimmeren. Die Geldverschieber haben zwar diesen Abort zu verantworten, den wir Gesellschaft nennen, aber Typen wie du sorgen dafür, dass er bis zum Rand mit Scheiße gefüllt bleibt. Die quillt einfach so heraus, aus dem Fernsehen und dem Radio, aus Zeitschriften und von Plakatwänden, rund um die Uhr, Tag für Tag, Woche für Woche. Neulich ging ich zum Pissen, und da hing über der Schüssel doch tatsächlich Werbung für Gap. Selbst wenn ich die Hand an meinem Schwanz habe, pinkelt ihr mir noch ins Gesicht.“
Er bückte sich und hob seine Waffe auf. Er hatte eine Maschinenpistole mit Klebeband am Lauf einer Schrotflinte befestigt und obenauf noch einen Camcorder; das Ganze sah aus wie aus einem Science-Fiction-Film.
Djinn-X steckte dem Gefangenen den Flintenlauf zwischen die Beine und amüsierte sich darüber, wie dieser scharf die Luft einzog. Dann zog er ein Klappmesser aus der Tasche und schnitt die Paketschnur an Fitzpatricks Armen und Beinen durch.
Er trat zurück und ließ den Mann selbst das Klebeband von seinem Mund reißen.
„Was wollen Sie?“, fragte Fitzpatrick. Seine Stimme zitterte.
„Weißt du, was ich wirklich hasse? Videospiele. Nicht das Spielen selbst, Scheiße noch mal, vom Spielen kann ich nicht genug kriegen. Aber die Idee, die dahintersteckt. Doom, Quake – Mann, das sind richtige Drogen. Da drückst du einem Kind eine Knarre in die Hand und schickst es los – knall so viele Leute ab wie möglich! –, und dann wundern sich alle, wenn er mit Daddys Jagdgewehr in der Schule auftaucht, und der Finger juckt ihn am Abzug. Aber dafür bist du natürlich nicht verantwortlich. Du sorgst nur dafür, dass die Leute bekommen, was sie wollen.“
„Meine Firma hat mit Videospielen überhaupt nichts zu tun“, sagte Fitzpatrick vorsichtig. „Wir werben für Ladenketten …“
„Halt’s Maul“, unterbrach Djinn-X ihn freundlich. „Wir diskutieren das jetzt nicht. Leute wie du haben Leute wie mich geschaffen, meine ganze Generation – und jetzt zeige ich dir, was wir gelernt haben.“
Er klappte den Bildschirm des Camcorders auf, sodass er zur Seite wegstand. Dann tippte er auf den Einschaltknopf, und der Monitor erwachte zum Leben.
„Steh auf.“
Fitzpatrick gehorchte. Seine Beine zitterten so sehr, dass er sofort das Gleichgewicht verlor und zu Boden fiel.
„Versuchs noch mal, aber vorsichtig.“
Fitzpatrick kam diesmal auf die Füße.
„Dreh dich um.“
Der Korridor hinter ihm war bis in etwa drei Meter Höhe mit schwarzer Plastikfolie verhangen. „Hier beginnt das Labyrinth“, sagte Djinn-X. „Du wirst mit den Inlinern durchfahren, und ich werde dich mit dem Skateboard jagen. Solange du vor mir bist, bleibst du am Leben. Fällst du – dann stirbst du. Ganz einfach, was?“
„Das meinen Sie doch nicht ernst?“
„So ernst wie ein vollgekokster Pitbull“, antwortete Djinn-X.
Er schob mit der Fußspitze sein Board in Position und hob die Waffe an die Schulter; den Videomonitor benutzte er als Zieleinrichtung. „Jetzt aber los.“
Fitzpatrick machte kehrt und startete unbeholfen. Unter seinem Entsetzen glomm ein Funken der Hoffnung – war er doch jedes Wochenende mit seinen Rollerblades unterwegs.
Genaugenommen war er damit richtig schnell. Er wollte, sobald er um die erste Ecke war, einen Spurt einlegen und so seinen Verfolger abschütteln.
Djinn-X ließ ihn etwa fünfzehn Meter weit kommen, bevor er schoss. Drei scharfe Pops. Die drei Einschläge schlugen Fitzpatrick einzeln in den Rücken. Aus seinem Bauch explodierte eine so gewaltige Welle der Angst, dass er nicht einmal schreien konnte. Er krachte auf den Boden und roch die Spanplatten, als er mit dem Gesicht auf den rauen Holzboden aufschlug.
Er lag zuckend am Boden – aber aus irgendeinem Grund lebte er noch.
„Das erste Leben kriegst du umsonst“, rief Djinn-X und schob das Skateboard an. Die Kunststoffrollen rumpelten über den Boden. „Schau, meine schicke Maschinenpistole ist keine MAC-10 und auch keine Uzi; sie ist eine Paintball-MP. Sie verschießt kleine Plastikkugeln mit Farbe. Auf deinem weißen Anzug machen sie hübsche rote Flecken, aber du kriegst davon nur einen Bluterguss.“ Es machte noch einmal ‚Pop‘, und wieder folgte ein stechender Schmerz.
„Mach dich jetzt besser auf die Socken, Sprücheklopfer“, sagte Djinn-X. „Die Flinte hier ist nämlich echt. Und den Trick mit dem Ich-kann-nicht-Rollerbladen kannst du dir sparen. Ich beobachte dich nämlich schon eine ganze Weile.“
Fitzpatrick rappelte sich wieder hoch. Diesmal jagte er davon, so schnell er konnte.
Mit einem Freudenschrei schoss Djinn-X hinterher.
Später
Djinn-X hatte die Digitalaufnahmen von der Kamera auf seinen Laptop heruntergeladen, spielte damit herum und protzte von seinem Bürocomputer aus gleichzeitig damit im Web.
Wartet, bis ihr die nächste Ebene seht,
tippte er.
Großer Schrecken.
Hier eine kleine Vorschau.
Er spielte das Bild ein, an dem er gerade getüftelt hatte: Fitzpatrick in voller Fahrt auf der Flucht durch den Korridor.
Djinn-X hatte die schwarzen Wände digital übermalt; jetzt schien es, als rase sein Opfer durch enge Straßenschluchten.
Feine rote Wolken dampften aus den hässlichen roten Flecken auf seinem Overall.
Sehr hübsch
kam einen Moment später die Antwort.
Wie hast du diesen Dampf-Effekt hingekriegt?
Chemie. Ich hab die Farbmunition mit einer Spritze und etwas Epoxyd aufgepeppt. Dachte, etwas Salzsäure könnte das Ganze noch interessanter machen.
Dann hat es ihn wohl echt ‚gebrannt‘, was?
Djinn-X grinste.
Nein, die Kugel habe ich für den Schluss aufgehoben.
Und was war das für eine?
Die mit Kerosinfüllung. Und einem Kern aus Phosphor.
Klasse! Wozu ein teures Trickstudio, wenn du das Ganze in echt haben kannst!
Das ist doch, worum es uns in dieser ganzen Geschichte geht, Mann.
Das Echte – und ich meine damit nicht die beschissene Coca-Cola.
Ganz deiner Meinung.
Weiß ich doch. Ich weiß, dass du echt bist, und du weißt es von mir. Echt wie das ganze übrige Rudel. Unsere Initiation ist ja nicht irgendein Firlefanz. Ich suche ein Opferlamm aus, verlange, dass du es umbringst und mir zum Beweis die Hand schickst – Fälschung ausgeschlossen. Deshalb muss jeder im Rudel diese Probe bestehen. So schafft man Vertrauen.
Wirklich?
Djinn-X runzelte die Stirn und tippte dann:
Wie meinst du das?
Du weißt, dass ich ein Mörder bin. Aber wie kann ich mir bei dir sicher sein?
Wenn du da Zweifel hast, dann geh zu einem meiner Abladeplätze.
Und bring eine Schaufel mit.
Leichen kann jeder Grabräuber verscharren.
Djinn-X lehnte sich zurück und betrachtete den Bildschirm aus schmalen Augenschlitzen. Dann breitete sich allmählich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus.
Also gut – such dir irgendeinen Abladeplatz aus. Sie liegen im ganzen Land verstreut. Selbst wenn ich nur ein Internet-Angeber sein sollte, glaubst du, ich hätte alle diese Grabstellen fälschen können?
Das ist unwahrscheinlich. Aber das beweist nicht, dass du ein Killer bist. Es beweist nur, dass die anderen Rudelmitglieder Killer sind.
Auch sie könnten nichts als eine Horde angeberischer Grabräuber sein. Aber sie sind es nicht. Ich habe einen Eisschrank voller abgehackter Hände, die das Gegenteil beweisen – aber dafür hast du nichts als mein Ehrenwort.
Genau.
Aber eines weißt du gewiss. Ich habe für dich ein Lamm ausgewählt und dir befohlen, es zu töten. Das hast du getan. Vor dem Gesetz bin ich damit genauso schuldig wie du.
Mit dem feinen Unterschied, dass du dir nicht die Hände schmutzig gemacht hast. Das Gesetz ist bedeutungslos – das weißt du genau.
„Du gehst mir langsam wirklich auf den Wecker“, murmelte Djinn-X.
In Ordnung. Ich biete dir den gleichen Deal, den du mir geboten hast. Such dir eine Nutte, nimm ihre Fingerabdrücke und sag mir, wann und wo. Dann bekommst du von mir ein kleines Geschenkpäckchen.
Ich habe eine bessere Idee. Über Kreuz.
Erklär das.
Das Ironische an unserer Existenz ist doch, dass wir niemals jemanden umbringen können, den wir kennen.
Die Anonymität ist unser größter Vorteil. Aber ich könnte ja jemanden umbringen, den du kennst – und umgekehrt.
„Du räudiger Bastard“, murmelte Djinn-X.
Wer ist das Lamm?
Eine Immobilienmaklerin. Du brauchst mir nichts zu schicken – ich werde wissen, wenn sie tot ist.
Ganz recht. Ich brauche nur einen Namen, eine Stadt und eine Telefonnummer.
Djinn-X griff nach einem Kugelschreiber und notierte sich die Daten, die auf dem Monitor erschienen. „Dann muss ich wohl wieder nach Seattle“, seufzte er. „Flugzeuge und Regen. Scheiße.“
Dafür schuldest du mir etwas, Deathkiss.
Keine Sorge. Ich bleibe nie etwas schuldig.
„Du hängst jetzt seit zwölf Stunden an diesem Ding“, maulte Nikki. „Erfährst du da was, oder bist du nur auf Pornoseiten?“
„Pornografisch würde ich es nicht nennen“, antwortete Jack. „Aber obszön schon.“
Er lehnte sich zurück und streckte sich. Aus seinen Halswirbeln jagte ein stechender Schmerz in seine Schädelbasis hinauf. „Ah! Verdammt“, stöhnte er.
Nikki kam heran und legte die Hände auf seine Schultern.
Sie grub ihre Daumen in seine Trapezius-Muskeln. „Du musst mal ein bisschen lockerlassen. Du hast da Knoten so groß wie Golfbälle.“
Jack schloss die Augen und versuchte, sich zu entspannen.
Immer wieder flackerten Bilder von der Website vor seinem inneren Auge vorbei: verstümmelte Körper, nebeneinander aufgereihte, abgeschlagene Köpfe, bildreiche Beschreibungen von Vergewaltigung und Entstellung. Er schüttelte den Kopf und öffnete die Augen.
„Geht nicht. Auf der Website sind noch ein paar Bereiche, die ich noch nicht durchgesehen habe.“
Nikki ließ ihre Hände von seinen Schultern fallen. „Und essen musst du auch noch. Los, ich kann kein Fastfood mehr sehen. Wir gehen jetzt essen, in ein richtiges Restaurant.“
„Ich habe keinen Hunger.“
„Ich schon. Und ich esse nicht gern alleine.“
Schließlich gab er nach – die Diskussion war ihm der Mühe nicht wert. Die alltäglichen Dinge schienen keine Rolle mehr zu spielen; ohne Nikkis Ermahnungen hätte er weder geduscht noch sich rasiert. Essen war ihm nichts als Treibstoff, Schlaf war die Abwesenheit von Bewusstsein. Manchmal vergaß er zu urinieren, bis die Blase spannte.
Nikki wählte ein Restaurant namens Chantarelles, ein französisches Bistro im Regierungsviertel von Seattle. Und sie bestand darauf, mit dem Taxi anstatt dem Van hinzufahren.
Das Restaurant war klein, ruhig und gepflegt. Irgendwie kam es Jack ein wenig unwirklich vor; immer wieder lugte er hinter sich, als könne er so der Wirklichkeit hinter dem Trugbild auf die Spur kommen.
„Lass das, Jack. Du machst mich ganz nervös.“
Nikki bat den Oberkellner um einen Tisch etwas abseits; er führte sie ganz nach hinten in eine Ecke. Außer ihnen waren nur noch zwei weitere Paare im Lokal; beide saßen am Fenster neben dem Eingang.
Jack setzte sich mit dem Rücken zur Wand.
Ein Hilfskellner füllte ihre Wassergläser. Er wirkte sehr jung, vielleicht achtzehn, asiatischer Typ. Jack fragte sich, ob er auch Computerspiele mochte.
Die Menükarte war kurz und exklusiv. „Schau nicht auf die Preise“, sagte Nikki. „Sei mein Gast.“
„Na schön.“ Auch über Geld zerbrach sich Jack nicht mehr den Kopf. Seit drei Jahren lebte er vom Geld der Versicherung; keine Ahnung, wie viel davon noch übrig war. Er würde es früh genug merken, wenn seine Bankkarte versagte.
„Hmm, ich glaube, ich nehme den Caesar-Salat“, sann Nikki. „Ob sie den wohl am Tisch fertig anrichten? Schon mal probiert?“
„Nein.“
„Das ist einmalig. Sie machen alles vor deinen Augen, sogar das Dressing – zerdrücken die Sardellen, schlagen das Ei … frischer geht’s nicht.“
Zerdrücken. Schlagen.
Jack sagte nichts.
Als der Ober kam, bestellte Nikki ein Glas Rotwein. Jack schüttelte nur den Kopf. Das Trinken von Alkohol zur Entspannung war ihm, als wolle man ein Feuer mit Benzin löschen.
„Im Tagesmenü haben wir Schweinemedaillons an einer Aprikosen-“
„Das nehme ich.“
Nikkis Augen verengten sich kurz zu Schlitzen, dann sagte sie: „Ich hätte gerne den Caesar-Salat und den Hummer.“
„Wie Sie wünschen.“
Als der Ober gegangen war, schwiegen sie eine Weile. Seit zwei Jahren waren sie nun Tag für Tag zusammen und hatten dabei eine Geborgenheit und Leidenschaft geteilt, von der die meisten Paare nur träumen konnten – dabei war es zwischen ihnen noch nicht einmal zu einem Kuss gekommen.
Nicht Liebe war es, was sie zusammenhielt, sondern Hass und Einsamkeit.
„Nun, ist das nicht besser als bei Burger King?“, fragte Nikki schließlich.
„Doch, schon.“
„Ich …“ Sie suchte nach einem Gesprächsthema. „Ich war heute einkaufen. Habe ein Paar tolle Schuhe gefunden.“
Er schien durch sie hindurchzusehen. Mit ihrem flehenden Gesichtsausdruck drang sie schließlich zu ihm durch.
„Oh. Das ist … schön. Wirklich … schön.“
„Oh ja, sie waren wirklich ein Schnäppchen.“
Lange Pause.
„Was … sind es denn für welche?“, fragte Jack vorsichtig.
„Wie? Oh, es sind Pumps. Rot und schwarz, mit kleinen Schleifchen.“
„Ah ja.“ Er versuchte zu lächeln. „Die kannst du sicher gut gebrauchen.“
„Genau.“ Ihre Stimme klang jetzt schärfer. „Die sind sicher genau das Passende, um den nächsten Geistesgestörten an die Angel zu nehmen, den wir dann zu Tode foltern.“
„So hab ich das nicht gemeint.“
„Ach, vergiss es“, blaffte sie ihn an. „Was habe ich mir da bloß eingebildet? Dass ich einfach für ein paar Stunden so tun könnte, als führte ich ein normales Leben? So ein Schwachsinn. Ich bin eine fünfunddreißigjährige Hure mit einem Serienkiller als Partner, und was ist das einzige nicht Geisteskranke, worüber wir beim Abendessen reden können? Schuhe. Das muss man sich einmal vorstellen: beschissene Schuhe.“
„Pumps“, sagte er. „Mit Schleifchen.“
Eine Sekunde lang starrte sie ihn an, dann musste sie lachen.
Er versuchte, mit einzustimmen, brachte aber nur ein schwaches Lächeln zustande.
Nikki lachte, bis ihr Tränen in den Augen standen. Beim Versuch, diese mit der Serviette abzutupfen, ohne ihr Make-up zu ruinieren, scheiterte sie kläglich. Als sie entdeckte, dass sie auch Lippenstift auf der Serviette verschmiert hatte, begann sie zu schluchzen und warf die Serviette von sich.
Dann sprang sie auf und rannte zur Toilette.
Jack saß einfach nur da.
Deathkiss hatte inzwischen noch ein paar Details genannt, und Djinn-X stellte erleichtert fest, dass seine Reise doch weniger unangenehm sein würde als erwartet. Ganz im Gegenteil.
Während des Fluges ging er noch einmal die Einzelheiten durch – auch um sich von der Tatsache abzulenken, dass er in einem Flugzeug saß. Nicht die Möglichkeit eines Absturzes machte ihm zu schaffen, sondern das völlig unvermittelte Auftreten von Turbulenzen. Man saß bequem inmitten anderer Menschen, sah sich vielleicht einen Film an, schlürfte einen Schluck Wein aus einem Plastikbecher, alles fast wie in einem Kino, und dann: Wumm! Auf einmal sackt das ganze Gebäude zwanzig Meter in die Tiefe.
Danach war man echt erst einmal hinüber.
Vorbei war’s mit der Entspannung und dem Film; sollte man jetzt den Wein hinunterkippen und gleich noch einen bestellen, oder besser aufhören zu trinken, damit man nicht später die Stewardess vollkotzte. So etwas kam ihm immer wie Verrat vor – wie ein nettes, gepflegtes Abendessen zu Hause, alles ruhig und friedlich, und plötzlich schlägt dir einer ohne jeden Grund die Nase ein.
Wie damals, als er noch bei seinem Vater gelebt hatte.
Er schloss die Augen und versuchte, sich zu konzentrieren.
Die Reise war die Mühe wert, aus zweierlei Gründen: Da war einmal das Opferlamm selbst. Nach der Beschreibung von Deathkiss musste sie ein scharfes Ding sein. Sie war zweiundvierzig, sah aber aus wie fünfunddreißig, und war dazu Immobilienmaklerin. Geschäftsfrau.
Händler aller Art waren ihm ein Gräuel. Sie waren die wirklichen Raubtiere in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts.
Sie durchstreiften mit ihren unersättlichen Bankkonten den Wirtschaftsdschungel; ihre Waffen waren Demografie, Statistik und Verträge wie Pfeilspitzen zugefeilt und mit Widerhaken versehen. Es waren die Kinder des Babybooms, Hippies, die ihre Ideale gegen Zynismus und Gier eingetauscht hatten. Sie betrogen damit nicht nur sich selbst, sondern auch ihre eigenen Kinder – die Generation X, der er selbst angehörte, die wegen der hemmungslosen Vermehrung ihrer Eltern keine anständigen Jobs finden konnte, dafür aber das wichtigste Ziel skrupelloser Marktstrategen war, die ihren eigenen Sprösslingen ein Produkt nach dem anderen in den Hals stopften. Alternde Parasiten, die ihren Nachwuchs aussaugten.
Sie fertigzumachen würde ihm großes Vergnügen bereiten.
Aber das war nicht der Hauptgrund seiner Reise. Es hätte auch eine 85-jährige Witwe im Rollstuhl sein können – er hätte sich trotzdem auf den Weg gemacht, und das aus einem einfachen Grund.
Vertrauen.
Was Djinn-X anging, war es das wertvollste und vergänglichste aller Gefühle. Schon eine einzige Lüge konnte es zerstören – war es aber gewonnen, dann konnte es zur stärksten Empfindung überhaupt werden, stark genug, um das ganze Gewicht einer Beziehung zu tragen. Vertrauen war die Sehne, die alles zusammenhielt: Freundschaft, Ehre, Pflichterfüllung, Liebe.
Gefühle hatten in seinem Leben nie eine große Rolle gespielt. In seiner Familie hatte er sie jedenfalls nicht erfahren, und wegen der ständigen Versetzungen seines Vaters von einer Armeebasis zur nächsten hatte er auch nie dauerhafte Freundschaften schließen können. Erst mit dem Internet änderte sich seine Lage wirklich; nun spielte es keine Rolle, wo man gerade war. Die Beziehungen spielten sich ja im Cyberspace ab.
Aber auch hier war man vor Verrat nicht sicher. Einmal hatte er sich jemandem anvertraut, der ihm seelenverwandt zu sein schien, einem 17-jährigen Mädchen namens Kelly, die Mangas mochte, Ska-Musik und Clive Baker. Sie durchlebten eine glühend heiße elektronische Romanze, er in Kalifornien und sie in Idaho. Sie tauschten schamlose E-Mails aus und masturbierten zusammen online.
Er war sich sicher, dass er sie liebte. Als er sie schließlich mit einem Greyhound-Bus besuchte, entpuppte sich Kelly als ein 43-jähriger Transvestit namens Kevin. Er behauptete steif und fest, genauso verliebt zu sein.
Er war natürlich Geschäftsmann. Und das erste Opfer von Djinn-X.
Nach diesem Verrat beschloss er, für immer alleine zu bleiben. Der Mord an Kevin ordnete ihn einer anderen menschlichen Spezies zu: homo homicidus. Der Mord bedrückte ihn nicht, sondern verschaffte ihm tiefe Befriedigung. Dies musste seine wahre Bestimmung sein, und er stürzte sich in sein neues Dasein mit einer Zielstrebigkeit, wie er sie nie zuvor besessen hatte. Sein Alltagsjob gab ihm die Gelegenheit, genau die Menschen auszuspionieren, die er umbringen wollte, und dabei blieb er praktisch unsichtbar; ein Fahrradkurier war doch kaum mehr als ein Verkehrshindernis.
Eine Zeit lang hatte ihm das genügt. Aber da gab es dieses alte Sprichwort, das im Netz öfter die Runde machte: Informationen wollen frei sein. Eines Nachts, nach einem besonders befriedigenden Mord – ein Marketing-Leiter, der sich rühmte, für die Mentos-Kampagne verantwortlich zu sein –, ertappte er sich dabei, wie er im Netz mit seinen Mordtaten prahlte.
Natürlich glaubte ihm niemand. Warum auch? Online kannst du behaupten, alles und jedes zu sein; das wusste er besser als jeder andere.
Aber die Sache nagte an ihm. Im Netz konnten sich Menschen mit gleichen Interessen finden – Menschen, die sich sonst nie getroffen hätten. Das Netz bot prompte Verständigung bei völliger Anonymität. Zahlreiche illegale Subkulturen hatten es für sich entdeckt: Anarchisten, Kinderpornografie-Ringe und Videopiraten.
Warum nicht auch Serienkiller?
Von der ihn umgebenden Gesellschaft war Djinn-X inzwischen so weit entfremdet, dass er beschloss, sich eine eigene zu schaffen. Es kostete ihn unendlich viel Zeit, Geduld und mühevolle Auslese; schließlich hatte er seine Technik so weit verfeinert, dass er in einem Punkt völlige Gewissheit hatte: Die Person, mit der er sich austauschte, war ein wirklicher Mörder, genau wie er selbst. Dieses geheime und machtvolle Wissen war das Feuer, in dem Vertrauen geschmiedet wurde. Und Vertrauen galt ihm viel.
Deathkiss gehörte nun zum Rudel. Djinn-X vertraute ihm, und Deathkiss musste sich sicher sein – verdiente die Gewissheit –, dass er umgekehrt auch Djinn-X vertrauen konnte.
Das war schließlich die Grundlage ihrer Gemeinschaft.
Djinn-X fuhr vom Flughafen mit dem Bus ins Stadtzentrum, machte ein Pfandleihhaus ausfindig und kaufte sich gegen bar ein gebrauchtes Mountainbike. Bei der Abreise konnte er es ja wieder weiterverkaufen – ein Verlust von vielleicht 20 Dollar war ihm die Unabhängigkeit wert. Mit eigener Muskelkraft erkundete er die fremde Stadt, sprang über Bordsteine und schlängelte sich durch den Verkehr; nichts anderes kam dem Gefühl näher, das er beim Surfen im Netz verspürte. Er besah sich die Karte, die ihm Deathkiss geschickt hatte, und fuhr dann in Richtung eines Areals von Lagerhäusern.
Eine Immobilienmaklerin als Opfer war eine feine Sache, das i-Tüpfelchen war aber, dass sie sich auf Gewerbeobjekte spezialisiert hatte. Auf seiner Karte waren mehrere Gebäude aus ihrem Angebot markiert; alle waren groß und standen leer. Er brauchte sich nur eines davon auszusuchen und einen Termin zu vereinbaren; dann würde sie kommen. Wahrscheinlich trug sie auch so einen drolligen, orangefarbenen Blazer, wenn sie ihm die Tür aufsperrte. „Hier entlang, Mr. Todd. Ein riesiger, leerer Raum. Keine Chance, mich hier irgendwo zu verstecken. Und ich wette, wenn ich hier schreie, gibt es ein ganz erstaunliches Echo. Wegen des Lärms brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen; nach Einbruch der Dunkelheit ist der ganze Bezirk wie ausgestorben. Sie können sich also richtig gehenlassen … und sehen Sie mal hier! Ein riesiges Industriewaschbecken!“
Er hatte die Wahl zwischen drei Gebäuden; sie lagen nur wenige Straßenzüge voneinander entfernt. Das erste lag an einer Durchgangsstraße und hatte im ganzen Erdgeschoss Fenster. Das zweite war eigentlich in Ordnung, aber gleich am Ende des Blocks lag ein Diner-Imbiss, der durchgehend geöffnet hatte. Das war dann doch etwas zu nah.
Das dritte Gebäude, eine alte Verpackungshalle für Fleisch, lag zwischen einem Händler für Autoersatzteile und einer Freifläche am Ende einer Sackgasse. Es hatte viele Fenster, allerdings nur im ersten Stock, und die meisten waren eingeschlagen. Er entdeckte eine baufällige Feuerleiter, kletterte hinauf und spähte hinein. Ein leerer Raum unter einer dicken Staubschicht und voller Spinnweben. Perfekt.
Er stieg hinunter, schwang sich auf sein Rad und radelte bis zur nächsten Telefonzelle. Er wählte die Nummer, die er von Deathkiss bekommen hatte.
„Hallo, Davis Immobilien hier.“
„Hallo, ich interessiere mich für eines Ihrer Lagerhäuser.“
„Und welches genau?“
Er nannte die Adresse.
„Ah ja, das Waterman-Areal. Es steht schon eine ganze Weile leer, aber die Lage ist erstklassig.“
„Ich würde es mir gerne einmal von innen ansehen.“
„Selbstverständlich. Wann würde es Ihnen passen?“
„Ich bin nur heute Abend in der Stadt und stecke gerade noch in einer Besprechung. Könnten wir uns dort treffen, sagen wir … um einundzwanzig Uhr?
„Ich glaube, ich kann das einrichten. Ich heiße übrigens Julie Saunders.“
„Hi, Julie, ich bin Todd Simkack.“
„In Ordnung, Mr. Simkack – haben Sie noch Fragen, oder sollen wir das dann heute Abend klären?“
„Das machen wir dann heute Abend.“
„Dann bis später.“
Er nahm seine Piercings ab und zog sich im Motel einen Anzug an. Dann ließ er sich von einem Taxi sechs Blocks vom Lagerhaus entfernt absetzen. Den Rest des Weges ging er zu Fuß und genoss dabei den lauen Sommerabend. Es roch nach Dieselruß und heißem Asphalt – ein Geruch, den er schon immer gemocht hatte. Er erinnerte ihn daran, wie er als Kind auf einem Asphaltplatz Basketball gespielt hatte, auf einer der vielen Militärbasen, auf denen der Vater stationiert gewesen war.
Das Opferlamm erwartete ihn schon vor der Halle. Sie war genau, wie Deathkiss sie beschrieben hatte: hochgewachsen, blond und bildhübsch. Ihr Minirock ließ wenig über sie im Unklaren. Blitzartig überfiel ihn die Vorstellung, wie sie auf Knien um ihr Leben flehte. So war sein Lächeln nicht gespielt, als er sich näherte.
„Hallo, Sie müssen Mr. Simkack sein.“
„Todd wäre mir lieber.“
„In Ordnung, Todd. Hier entlang – du meine Güte, sieht aus, als hätte jemand eingebrochen. Leider haben wir immer wieder Probleme mit Hausbesetzern …“
„Macht nichts. Die sind doch nicht gefährlich, oder?“
„Nein, nein. Die meisten sind Ausreißer, die nirgends hinkönnen, aber passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es könnten ja Spritzen herumliegen.“
„Ich halte die Augen auf. Mann, ist es hier dunkel. Gibt’s hier noch Strom?“
„Halt’s Maul, du mieses Stück Scheiße.“
„… Wie?“
Plötzlich machte die Welt einen Satz, wie in einem schlechten Videoschnitt. Er lag unversehens auf dem Rücken, starrte in ein grelles Licht und hatte keine Kontrolle über seine zuckenden Muskeln. Eine Männerstimme sagte: „Keine Bewegung. Nikki, nimm ihm die Waffe ab.“
Kräftige, geübte Hände ertasteten das Messer, das er am Rücken unter dem Hemd im Hosenbund trug. Die Stimme hinter der Taschenlampe sagte: „Kommt dir dieser Moment bekannt vor?“
„Was zum Teufel wollen Sie?“, keuchte Djinn-X. „Schauen Sie, wenn Sie mich ausrauben wollen …“
„Dies ist der Augenblick, in dem das Kommando wechselt.
Das Scharnier, in dem sich deine Beziehung zum Opfer dreht, sich alles umkehrt. Nur dass du diesmal auf der anderen Seite stehst.“
„Deathkiss?“, flüsterte er.
„Nein, ich bin der, der ihn getötet hat.“
Langsam machte sich bei Djinn-X ein altbekanntes Gefühl im Magen breit. Verrat.
„Und jetzt bringst du mich um, oder?“
„Nein, ich töte dich nicht. Ich will nur mal mit dir reden …“
ROAD RAGE: Ich glaube, da gibt es etwas, um das wir uns kümmern sollten: den Closer.
GOURMET: Der Meinung bin ich auch. Er ist eine Bedrohung, auf die wir reagieren müssen. Zum Glück hat er bislang noch keinen von uns erwischt.
ROAD RAGE: Und wenn doch? Dann kennt er alle unsere Geheimnisse.
PATRON: Dann müssen wir ihn einfach zuerst schnappen …
Zwischenspiel
Liebe Elektra: Ich habe Sarah eingeladen, um mit mir ein paar Gruselfilme anzusehen, dazu Simone und Jessica. Ich wusste nicht einmal, ob sie überhaupt Filme anschaut, aber sie schaltete am DVD-Player einfach die Untertitel ein. Ich kam mir richtig blöd vor, weil das ja eigentlich selbstverständlich ist. Außerdem liest sie ohnehin das meiste von den Lippen.
Wir haben uns ein paar Schlachter-Filme ausgeliehen und haben sie uns unten im Keller im Dunkeln angesehen. Es war mehr zum Lachen als zum Fürchten – manche Filme sind ja echt primitiv! Wenn schon ein Psychopath herumschleicht und Leute umbringt, dann geht doch kein vernünftiger Mensch auf den Friedhof oder in ein verlassenes Haus, und wenn, dann würdest du doch deine Freunde mitnehmen. Du würdest nicht auf eigene Faust herumschlendern und erst recht keinen dunklen Keller untersuchen, aus dem du merkwürdige Geräusche gehört hast.
Wir haben das regelrecht als Beleidigung aufgefasst; es sind nämlich immer Teenager, die solchen haarsträubenden Unsinn anstellen.
Jessica hat außerdem festgestellt, dass es nicht einfach Teenager sind – es müssen dann gleich sexbesessene Teenager sein. Wer rumfummelt, kann sich genauso gut gleich eine Zielscheibe auf den nackten Hintern malen.
„Genau“, sagte Sarah, „und was lernen wir daraus zum Thema Sex?“
„Lass die Finger davon, wenn du nicht vorzeitig sterben willst“, meinte Simone.
„Oder nimm es mit der Verhütung ernst“, warf Jessica ein. „Verhütung mit schweren Geschützen sozusagen.“
„Kids!“, rief ich mit Ansagerstimme dazwischen. „Habt ihr ungeschützten Verkehr? Treibt ihr es etwa in verlassenen Zeltlagern und leeren Fabrikhallen? Dann sind unsere extra psychopathenresistenten Kondome genau das Richtige für euch! Exklusiv empfohlen von Freddy, Jason und Chucky!“
„Genau!“, kreischte Sarah. „Mit einer kleinen Eishockeymaske ganz vorn!“
„Und das Modell Freddy wäre dann aus, sagen wir, verbranntem Fleisch“, schlug Jessica vor.
„Iiiih, wie EKLIG!“ Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat – ich glaube, wir alle.
Nun, Elektra, danach wurde unsere Unterhaltung erst richtig abgefahren. Am Schluss hatten wir ein ganzes Sortiment von Sexartikeln für Schlachterfilme entworfen: Zum Beispiel eine aufblasbare Chucky-Attrappe, lenkt vorübergehend ab, während man flieht (aus besonders schnittfestem Gummi); dann den Freddy-Vibrator, orange und grün gestreift, und Jason-Gleitcreme (damit du immer wieder kommst – sogar, wenn du im letzten Film schon gestorben bist!).
Ich bin wirklich froh, dass Jessica und Simone Sarah mögen. Es wäre echt ätzend, wenn ihnen Sarah nicht cool genug wäre – dabei sind wir anderen selbst nicht besonders cool, aber Jessica ist manchmal schon komisch.
Früher war ja Jenny Birch bei uns in der Clique, bis sie und Jessica Zoff hatten. Jessica hat schlecht über sie geredet, dann auch Simone, und ich wahrscheinlich auch.
Ich weiß gar nicht recht, warum eigentlich; ich habe auch keine Ahnung mehr, worüber wir uns eigentlich gestritten haben. Jedenfalls gehört Jenny jetzt nicht mehr dazu.
Und Sarah passt gut zu uns – zum Glück. Ist ganz schön beschissen, wenn du in der Schule zu keiner Clique gehörst. Ich weiß noch gut, wie es war, als ich hierhergezogen bin – es war richtig schwierig, Anschluss zu finden.
Schließlich bin ich zu den Pfadfinderinnen gegangen, und dort habe ich Jessica und Simone kennengelernt.
Wenn ich mir die diversen Grüppchen an der Schule so ansehe, denke ich manchmal, sie kommen alle von verschiedenen Planeten: die Schwänze, die Streber, die Drogis und die Goths. Manchmal frage ich mich, wie es in ihrer Welt wohl aussieht und wie es wohl wäre, dort einmal vorbeizuschauen. Merkwürdig, was, Elektra?
Es gibt auch welche, die haben keinen eigenen Planeten.
Wenn ein Mädchen wirklich fett ist oder ein Junge richtig beschränkt, oder wenn man einfach zu hässlich oder zu blöd ist, um Freunde zu finden. Wenn ich die auf den Gängen herumstehen sehe, dann macht mich das gleichzeitig traurig und wütend. Traurig, weil sie wahrscheinlich immer allein bleiben werden, und wütend, weil niemand auch nur versucht, mal nett zu ihnen zu sein.
Mich eingeschlossen.
Vielleicht hat sich Onkel Rick geirrt, und ich sollte nicht Schriftstellerin werden, sondern eher die Herrscherin der Welt. Dann könnte ich das alles regeln, und alle wären glücklich.
Genau.
Das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum Leute Schriftsteller werden – Weltherrscher ist ein bisschen realitätsfern, also erfinden sie eine eigene Welt, in der sie bestimmen können. Ein Ort, an dem sie alle Aufgaben lösen können, an denen sie im wahren Leben scheitern.
Hmm. Ist das nun cool, oder ist das lächerlich? Was meinst du, Elektra?
Ich bin der Ansicht, du bist ein hochintelligentes und begabtes menschliches Wesen.
Na, so was, danke, Elektra; das ist nett.
Und obwohl ich nur eine elektronische Ausgeburt deiner Fantasie bin, setzt mich die Wohlgestalt deiner leiblichen Form in höchstes Erstaunen. Du bist zweifellos ein herausragendes Exemplar der menschlichen Rasse und jedes männliche Wesen würde sich glücklich schätzen, zu deinen Füssen im Staub zu kriechen.
Seufz. Wenn nur Onkel Rick so leicht zu überzeugen wäre.
Aber deine Füsse stinken tatsächlich.
Ach, halt’s Maul.