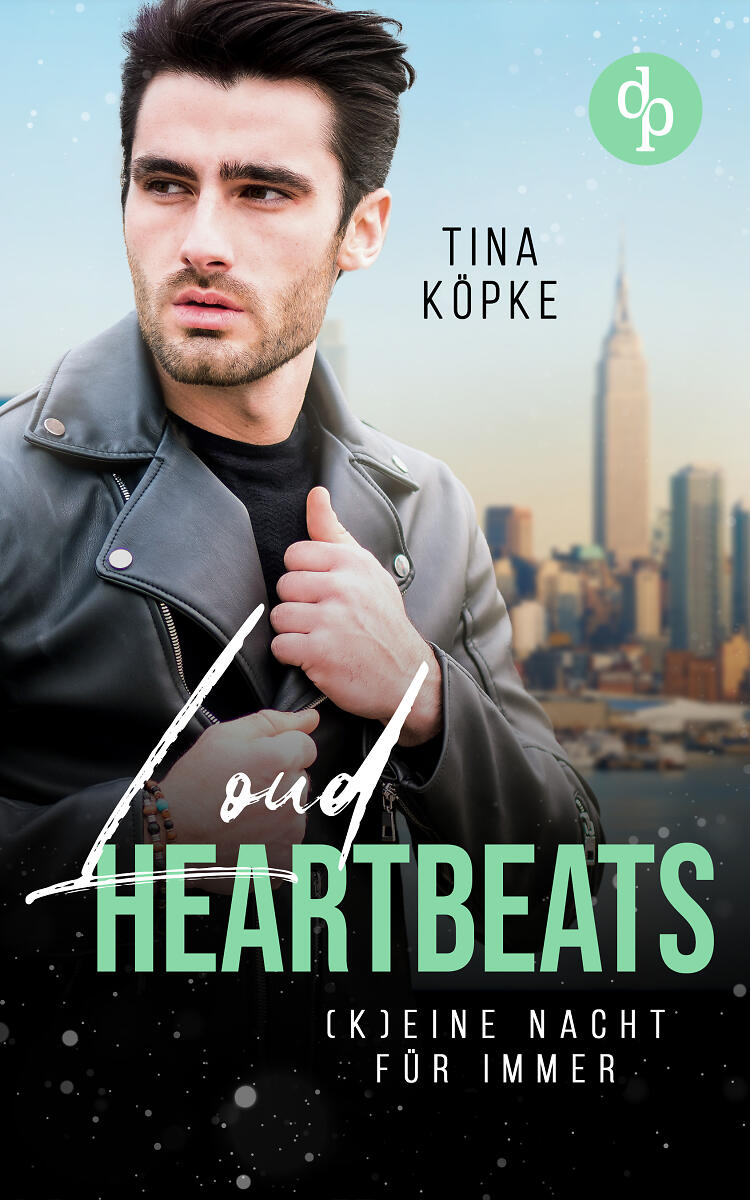Kapitel 1
»Worüber wolltest du reden?«, fragte ich meinen Bruder Paul und ließ mich dabei auf mein Sofa fallen. Bubbles, meine Golden Retriever Hündin, legte ihren Kopf auf das weiche Leder und wartete auf die Einladung zum Hochspringen, die ich mit einem Klopfen auf das Polster aussprach. Sofort hüpfte sie rauf und kuschelte sich in die Ecke.
Wie damals schon, als Paul und ich noch zusammen in dieser Wohnung gelebt hatten, zog er den bequemen Sessel vor. Er streckte seine langen Beine aus, die in alten Jeans und Turnschuhen steckten. »Zuerst will ich wissen, wie es dir geht.«
Skeptisch hob ich eine Braue, lehnte mich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Wenn er schon so anfing, war irgendetwas los, das mir nicht gefallen würde. »Warum?«
Sein Schmunzeln erinnerte mich an unseren Dad. Zum Glück hatte Paul nur die wenigen guten Eigenschaften von ihm geerbt: Das braune, lockige Haar, das Lächeln und dazu die gleichen warmen Augen wie meine. Er hätte es deutlich schlimmer treffen können.
»Weil ich Neuigkeiten habe und nicht will, dass du auf sie reagierst, als wärst du ein bissiger Terrier.«
Unruhe baute sich in mir auf. Paul war normalerweise nicht der große Geheimniskrämer. Wenn er etwas zu erzählen hatte, tat er das, ohne viel herumzudrucksen.
Was auch immer ihn beschäftigte, es musste ihm wichtig sein. Sehr wichtig. Und da er nicht aussah, als wäre er am Boden zerstört, handelte es sich dabei wohl eher nicht um schlechte Nachrichten von unseren Erzeugern. Würde es um sie gehen, wäre er sicherlich traurig, denn trotz der Erfahrungen mit ihnen besaß er immer noch eine deutlich bessere Beziehung zu ihnen als ich.
»Paul«, sagte ich mit bedrohlicher Ruhe. Meine Arbeitstage starteten sehr früh und ich hatte bereits einige Stunden auf den Beinen hinter mir. Auch wenn ich meinen Bruder liebte, zählte Geduld für solche Spielereien nicht zu meinen größten Stärken.
»Jaina«, neckte er mich. Schnell merkte er jedoch, dass mir nicht nach Spaß war. »Okay.« Seufzend rieb er sich über die stoppelige Wange. »Es geht um Heather und mich.«
Als ihr Name fiel, biss ich mir auf die Zunge. Heather McKenna, das geborene Topmodel, das aber nie diesen Weg eingeschlagen hatte, war seit ein paar Monaten die Freundin meines Bruders. Eigentlich war es mir egal, mit wem er ausging. Selbst als er im Frühling meine beste Freundin und Mitbewohnerin Erin gedatet hatte, hatte ich mich rausgehalten. Dabei konnte jeder Blinde mit dem Krückstock sehen, dass sie nur auf Adam, ihren Boss, stand. Der übrigens auch mal Heathers Vorgesetzter gewesen war. Außerdem hatte sie mit ihm – vielleicht oder mit großer Wahrscheinlichkeit – eine Affäre gehabt.
So richtig blickte ich bei den ganzen Beziehungsthemen nicht durch. Zu kompliziert, zu aufwendig.
Meistens hielt ich mich aus den Liebesproblemen anderer heraus, aber in letzter Zeit fiel mir das immer schwerer. Es betraf zu viele Menschen, die mir am Herzen lagen. Alle stürzten sie sich in Romanzen. Möglicherweise hatten sie irgendetwas ins New Yorker Grundwasser gemischt. Das würde diese Gefühlsverwirrungen durchaus erklären.
»Ihr habt euch getrennt, stimmt’s?« Ich kniff die Augen zusammen und musterte Paul. Er sah nicht unglücklich aus, aber meine Frage hinterließ einen verblüfften Ausdruck in seinem Gesicht. »Oder etwa nicht?«
»Nein«, erwiderte er gelassen. »Wir sind noch ein Paar. Ich habe sie gestern Abend sogar gefragt, ob sie mich heiraten will.«
Der letzte Satz wirkte wie ein Blitzschlag auf mich. »Heiraten?«
»Ja.« Paul lachte. Es erheiterte ihn immer, mich aus der Fassung zu bringen. »Falls es dich interessiert, Heather ist mir um den Hals gefallen und hat an die zehnmal gesagt, dass sie es kaum erwarten kann, Mrs Campbell zu werden.«
Ich hörte ihm gar nicht mehr richtig zu.
Mein Bruder würde heiraten.
Ausgerechnet Heather, wobei das nicht einmal der Punkt war, der mir so sauer aufstieß. Ich hatte nicht wirklich etwas gegen sie, vor allem nachdem sie ihre künstlich aufgesetzte Art abgelegt und bewiesen hatte, dass sie ein durchaus netter Mensch sein konnte – wenn sie es denn wollte.
Nein, jede Frau wäre mir recht, solange sie Paul glücklich machte. Es ging allein um den Umstand, dass er überhaupt plante zu heiraten.
Wir waren die Kinder zweier karrieregeiler Egozentriker, die in ihrem Leben alles erfolgreich über die Bühne brachten. Operationen, Gerichtsverhandlungen, selbst wir erschienen – zumindest äußerlich – ziemlich gut geraten. Aber ihre Ehe?
Die hatten sie mit reichlich öffentlichem Tamtam ebenfalls auf eine gewisse Art erfolgreich in den Sand gesetzt. Der Rosenkrieg zwischen ihnen hielt fast zwei Jahre an und es fiel mir schwer zu glauben, dass Paul tatsächlich den gleichen Weg einschlagen wollte wie sie.
Hatte er nichts von unseren biologischen Vorbildern über das selbst auferlegte Verderben gelernt?
»Jaina?« Pauls braune Augen musterten mich.
»Oh, sorry.« Ich sprang auf und stürzte auf ihn zu, um ihn fest in die Arme zu schließen. Etwas überrascht erwiderte er die Geste. »Ich gratuliere dir. Oder besser gesagt euch«, korrigierte ich mich. Jetzt war aus ihm endgültig ein euch geworden und zukünftig würden die Grenzen seiner Individualität immer mehr verschwimmen. Wie konnte er das und seine Freiheit so einfach aufgeben?
»Du freust dich?«
»Na sicher doch!« Ich klang für meine Verhältnisse viel zu euphorisch, aber ich war gerade nur zu extremen Gefühlsäußerungen fähig. Entweder ich schwieg, als hätte er mir den Tod einer geliebten Person mitgeteilt – was dem erstaunlich nahekam –, oder ich strahlte vor Freude wie ein Atomkraftwerk.
Ich wählte das Atomkraftwerk, denn genau das verdiente Paul. Von allen Menschen, die ich kannte, lag mir sein Glück am meisten am Herzen. Es wäre unfair von mir, ihm diese Entscheidung zu versauen, nur weil ich in Gedanken allmählich in den Notfallmodus abdriftete.
»Das ist schön«, gestand Paul, nachdem wir uns voneinander gelöst und ich mich wieder auf meinen Platz gesetzt hatte. »Wir haben nämlich eine Bitte an dich.«
»Okay?«
Paul rutschte an die vorderste Kante des Sessels, die Hände ineinandergefaltet. »Würdest du Heathers Trauzeugin werden?«
Ich blinzelte. »Wir kennen uns kaum.«
»Ich weiß.« Pauls sanfte Gesichtszüge verfinsterten sich. »Sie hat nicht viele Freundinnen. Genauer gesagt … niemanden. Nur Erin, aber es kam uns etwas unpassend vor, sie zu fragen.«
Das verstand ich. Nach dem ganzen Beziehungsheckmeck hätte ich auch davon abgeraten, egal wie sehr sich Erin und Heather inzwischen mochten.
Trotzdem gab es kaum etwas, das ich weniger wollte, als die Trauzeugin zu spielen. Ich hasste alles um Hochzeiten herum und zog es bei Einladungen meist vor, zeitnah die Bar zu plündern und so schnell es ging zurück in mein Hotelzimmer zu verschwinden. Nun eine so wichtige Aufgabe zu übernehmen – mit absoluter Anwesenheitspflicht bis zum bitteren Hochzeitsfeierende –, gefiel mir nicht.
»Klar, gerne«, stimmte ich zu. All meiner Abneigung zum Trotz, ging es hier nicht um irgendeine alte Bekannte aus der Highschool, sondern um Paul. Für ihn würde ich fast alles tun, sogar ein hässliches, fliederfarbenes Kleid mit Puffärmeln und Rüschen tragen. Allerdings konnte er sich sicher sein, dass es nach dem Fest keine Fotos gäbe, auf denen das bezeugt wurde.
»Also für jemanden, den früher alle die Eisprinzessin nannten, bist du erstaunlich kooperativ«, bemerkte Paul. Seine ganze Haltung entspannte sich allmählich wieder, nun, da er die großen Neuigkeiten verkündet hatte und der Vulkan Jaina nicht, wie erwartet, ausgebrochen war.
Manchmal überraschte ich mein Umfeld mit erstaunlich viel Selbstkontrolle. Aber eben nur manchmal.
Ich zuckte in gespielter Gleichgültigkeit die Schultern. Eher ließ ich die Welt untergehen, als ihn wissen zu lassen, dass ich innerlich in einer Schockstarre festhing. »Solange ich nicht heiraten muss.«
»Nein, keine Sorge.« Er lächelte verständnisvoll. Paul hatte, entgegen seinen eigenen Plänen, bestimmt nicht vergessen, wie ich zu dem Thema stand. »Aber wir brauchen deine Hilfe bei der Organisation.« Mein Stirnrunzeln ließ ihn etwas weiter ausholen. »Wir wollen bereits im Herbst heiraten.«
»Im Herbst?«, wiederholte ich ungehalten. Vielleicht war mein bisheriger Schock noch gar nicht so schlimm wie gedacht.
»Ja.«
Er meinte das ernst? »Warum?« Ich riss die Augen auf. »Paul, sag mir nicht, dass du Heather einen Braten in den Ofen geschoben hast.«
Ich war noch viel zu jung, um Tante zu werden.
»Ich bin verantwortungsbewusster als das.«
Er wollte eine Frau heiraten, die er erst ein paar Monate kannte. Gnade uns Gott. Inzwischen befürchtete ich, dass ich diejenige von uns war, die man gewissenhaft nennen sollte.
»Warum also die Eile?«, fragte ich, anstatt meinen Gedanken freien Lauf zu lassen.
»Weil ich Heather liebe und der Herbst ihre Lieblingsjahreszeit ist.«
»Dann heiratet doch im nächsten Jahr? Lernt euch besser kennen.«
»Jaina.« Sein Großer-Bruder-Ton nervte mich, seit unsere Mutter mich aus sich herausgepresst hatte. »Für uns gibt es keinen Grund, noch länger zu warten.«
Ich schluckte alle Bedenken hinunter, auch wenn mich mein Bauchgefühl davor warnte – Paul davor warnte –, diesen großen Fehler zu begehen. Wir besaßen zwar einen sehr kleinen, engen Freundeskreis, aber dafür umso mehr Bekannte durch unsere Jobs. Nur wenige davon waren glücklich verheiratet – glücklich geschieden traf es eher.
Doch es war Pauls Entscheidung und so schwer es mir fiel, auch nur ein neutrales Wort über die Lippen zu bringen, war ich ihm das schuldig. Er hatte so viel für mich getan, dass ich den Hintern zusammenkneifen und ihn unterstützen musste.
Ich gab mich geschlagen. »Was kann ich für euch tun?«
* * *
Ein paar Wochen später hatte ich die Neuigkeiten immer noch nicht so richtig verdaut. Die meiste Zeit tat ich so, als würde diese Hochzeit, die mit jedem Tag näher rückte, nicht stattfinden. Irgendwer bekam sicher kalte Füße. Da das jedoch nicht geschah, konnte ich es nicht mehr länger ignorieren.
Nicht heute zumindest.
Mittlerweile wusste ich, dass Heathers Familie auf eine äußerst klassische Feier bestand, was nur möglich war, weil sie eine Menge Geld besaßen. Als Pauls Schwester wurde ich demnach zu einer Verlobungsfeier der beiden eingeladen, die im herrschaftlichen Anwesen der McKennas in den Hamptons stattfinden sollte. Erleichtert darüber, mich nur um typische Trauzeuginnenaufgaben wie die Tortenverkostung oder die Brautkleidanprobe kümmern zu müssen, war dieser Teil der Eventplanung an mir vorbeigegangen. Es reichte bereits, für so ein nobles Ereignis etwas Passendes zum Anziehen zu finden.
»Was ist damit?«, fragte ich und hielt Erin als auch meiner anderen besten Freundin Miriam ein kurzes, silbern schimmerndes Kleid vor die Nasen. Es war verboten tief ausgeschnitten, ging mir bis knapp über das Knie und wurde nur von zwei hauchdünnen Trägern an meinen Schultern gehalten. Nichts, worin man sich vorbeugte, um eine Münze aufzuheben. Da müsste schon richtig viel Geld auf dem Boden liegen, damit ich der ganzen Welt meinen Hintern präsentierte.
»Ich denke, du solltest Heather nicht unbedingt die Show stehlen«, riet Miriam mir, die neben Erin auf meinem Bett saß. Seit einer halben Stunde sahen sie mir tapfer dabei zu, wie ich einen Fummel nach dem anderen aus meinem überfüllten Kleiderschrank zog, nur um ihn kurz darauf wieder zu verwerfen.
Ich drehte mich dem Ganzkörperspiegel zu und hielt das Stück Stoff vor meine Brust.
Eisprinzessin.
Das schimmernde Silber passte gut zu meinen kühlen, blonden Haaren, die mir knapp bis übers Kinn reichten. Glatte Strähnen rahmten mein Gesicht ein und nur die hellbraunen, sauber gezupften Augenbrauen verrieten meine natürliche Haarfarbe, die ich schon seit Jahren nicht mehr auf meinem Kopf gesehen hatte.
»Hm«, brummte ich und warf das Kleid auf den Berg zu den anderen ausgeschiedenen Kandidaten. Meine Garderobe nervte mich. Ich besaß im Grunde nur zwei Sorten Klamotten: bequeme, die ich mir selbst gekauft hatte, und von Firmen zugeschickte für meine Arbeit als Bloggerin. Es mangelte mir nicht an heißen Teilen für eine Partynacht, aber für eine Verlobungsfeier? Dafür war ich nicht ausgestattet. Ich hatte die Wahl zwischen sexy Minikleid oder Jeans mit aufgerissenen Knien. Mein Repertoire kannte keinen Mittelweg.
Erin stand auf und tauchte regelrecht in den großen Ikea-Kleiderschrank ab. Er war gerammelt voll und schrie danach, mal aussortiert zu werden, aber das war eher Miriams Ding. Sie konnte lächelnd die komplette Marie-Kondo-Nummer abziehen.
»Wie wäre es damit?« Erin zog ein schlichtes, schwarzes Kleid heraus, von dem ich mich vage erinnerte, es zuletzt vor drei Jahren bei der Beerdigung meiner Großtante Daisy getragen zu haben. Es lag eng an, kaschierte geschickt meinen schmalen Oberkörper und war ein einziges Fuck-You an meine Cousinen, die mich früher schikaniert hatten, weil ich eine ziemliche Jungsfigur besaß. Als Erwachsene gab es Kleider wie diese, die meine Vorzüge betonten und an jene Stellen Kurven zauberten, an denen Mutter Natur unbedingt hatte geizen müssen.
»Schwarz auf einer Verlobungsfeier?« Es fiel mir schwer, meine Skepsis zu verbergen. »Wobei … wir beerdigen ja auch Pauls Freiheit. Könnte also durchaus passen.« Schulterzuckend nahm ich es ihr ab und hielt es mir vor dem Spiegel an die Brust.
»Jaina«, tadelten Miriam und Erin mich zur selben Zeit.
»Wenn ich mal heirate, redest du hoffentlich nicht so«, schob Erin hinterher.
»Nicht in deinem Beisein«, versprach ich grinsend, woraufhin sie mich sanft mit ihrem schlanken Zeigefinger in die Rippen pikste.
»Aber jetzt mal im Ernst.« Miriam rutschte bis ans Fußende des Bettes. »Wieso stört dich die Hochzeit so sehr?«
»Weil ich nicht an die Ehe glaube.« Ich hängte den Kleiderbügel an den Griff des Schrankes und zog mir mein weißes Shirt aus. »Schon gar nicht, nachdem Heather und Paul erst seit wenigen Monaten zusammen sind. Sie kennen einander kaum.«
»Nicht jeder wird Jahre warten, um sich für diesen Schritt zu entscheiden«, wandte Erin ein.
Dass das ausgerechnet von ihr kam, fand ich witzig, denn so schnell sah ich sie nicht vor den Altar treten. Nachdem ihr Ex-Freund aus dem Nichts heraus mit ihr Schluss gemacht hatte, war sie ziemlich auf Sicherheit fokussiert. Anders als Paul würde sie nicht im ersten Jahr ihrer Beziehung einen Antrag von Adam annehmen, egal wie oft er sie noch nach Italien entführte.
Miriam konnte ich schwerer einschätzen. Sie und ihr Freund Henry kannten einander schon seit der Schulzeit, ehe sie ein paar Jahre getrennte Wege gegangen waren. Nun, da die beiden ausgerechnet über eine Fernsehshow wieder zueinandergefunden hatten, hingen sie andauernd aneinander. Sie arbeiteten sogar zusammen in Miriams Familienbäckerei. Mich würde es nicht wundern, wenn sie sich bald das Jawort gaben und jede Menge laute, aber bestimmt äußerst süße Babys in die Welt setzten.
»Na ja, solange Paul mehr über sie weiß als ich«, murmelte ich und stieg aus meiner schwarzen Jeansshorts, die mir am Hintern klebte. Der August in New York war dieses Jahr dank einer Hitzewelle besonders heiß. Selbst die Klimaanlage, die in der Wohnung installiert war, kam nicht mehr hinterher. »Ich meine, wusstest du, dass Heathers Familie steinreich ist?«, fragte ich Erin und nahm das Kleid vom Bügel, um es anzuprobieren.
»Nein, darüber haben wir uns nicht unterhalten«, gab sie zu und verlagerte ihre braune Mähne von einer Seite der Schulter auf die andere. »Wir meiden irgendwie die Themen, die unsere Familien und Partnerschaften betreffen.«
»Sei froh.« Ich drehte ihr den Rücken zu, damit sie mir den Reißverschluss hochzog. »Das hat dir den Arsch gerettet. Sie hätten sonst dich als Trauzeugin genommen.«
»Oh. Nun, Adam und ich sind trotzdem als Gäste zur Hochzeit eingeladen.«
»Henry und ich auch«, ergänzte Miriam, während sie mir dabei zusah, wie ich mich vor dem Spiegel drehte.
»Klar, du gestaltest schließlich ihre Torte«, wandte ich ein.
Das Kleid saß wie angegossen, auch wenn es im Vergleich zu dem silbernen fast ein bisschen langweilig wirkte. Erin hatte mit der Wahl trotzdem ein gutes Händchen bewiesen. Es ging auf der Party schließlich nicht um mich, und da weder Mom noch Dad kamen – ein weiteres Armutszeugnis ihrer elterlichen Fähigkeiten –, musste ich niemanden mit meinem Auftreten provozieren oder beeindrucken.
»Aber dann bin ich wenigstens nicht allein«, schlussfolgerte ich erleichtert. Die Hochzeit sollte über mehrere Tage gehen und ebenfalls in den Hamptons stattfinden. Wenn meine Freundinnen mitkamen, wurde es vielleicht doch ganz lustig. Wie ein kleiner Urlaub, nur dass man die eine oder andere lästige Aufgabe zu absolvieren hatte.
»Heute Abend überstehst du auch ohne uns.«
Ich schaute Erin mit einem gequälten Ausdruck an. »Erinnere mich bitte nicht.«
»Wer kommt denn alles?«, fragte Miriam. Sie lehnte sich auf meinem Bett nach hinten. »Du brauchst übrigens noch passende Schuhe.«
Stimmt. »Fick-mich-Pumps sind wohl keine Option, oder?«, fragte ich schnaubend und ging in die Hocke, um im unteren Teil des Schrankes zu wühlen. Turnschuhe, noch mehr Turnschuhe und High Heels, mit denen man jemandem ein Loch in den Kopf schlagen konnte. Großartig. Ich war wirklich auf jede Eventualität vorbereitet – nicht.
»Nein, aber ich leihe dir gerne welche von mir, wenn du magst«, bot Erin an. Ich nickte und sie verschwand sofort im Zimmer nebenan, das ihr gehörte. Krallen klapperten auf dem Parkettboden und kurze Zeit später gesellte sich Bubbles zu mir. Aufgeregt beschnüffelte sie mein Kleid, ehe sie zu Miriam aufs Bett sprang, die sich darum kümmerte, ihren flauschigen Rücken zu kraulen.
Erin kam mit schwarzen Pumps zurück. Die Front war geschlossen und schmale Riemchen über dem Fußrücken sorgten für Stabilität. Sie ging vor mir auf die Knie.
»Wehe, du machst mir einen Antrag«, scherzte ich.
Erin verzog grinsend das Gesicht. »Fuß hoch«, verlangte sie und ich folgte ihrer Aufforderung.
»Also, wer kommt denn nun alles?«, griff sie Miriams Frage wieder auf und schob mir den Schuh über, als wäre sie der Prinz und ich die verdammte Cinderella.
»Keine Ahnung«, gab ich zu und drehte den Fuß etwas, sodass Erin besser an den Verschluss kam. »Laut Paul nur der engste Kreis und ein paar alte Bekannte der McKennas. Soweit ich weiß, ist Heathers Vater vor zwei Jahren plötzlich verstorben und seine Geschäftspartner haben die Familie dabei unterstützt, die Firma sicher durch diese Zeit zu bringen.«
»Was machen sie genau?«, fragte Erin und deutete mir an, den anderen Fuß auszustrecken.
»Irgendwas mit Autos, denke ich.«
»Cool«, kommentierte Miriam und streichelte dabei Bubbles’ kahle Stellen in den Kopf.
»Ich befürchte, dass es unglaublich öde wird.«
»Ach, Jaina«, sagte Erin mit einem Seufzen und lächelte mich von unten an. »Sei nicht pessimistisch. Wenn du schon so an die Sache herangehst, wirst du mit Sicherheit keinen Spaß haben.«
»Dann kann ich wenigstens nicht enttäuscht werden.«
Sie streckte mir die Zunge entgegen und ich lachte. Kurz darauf stand ich in meinem Outfit wieder vor dem Spiegel. Ich brauchte noch das passende Make-up, aber ansonsten konnte ich mich darin sehen lassen. Schwarz, elegant und nicht zu freizügig oder casual.
Ein gesundes Mittelmaß. Alles, was ich nie war und niemals sein würde.
* * *
Wie vermögend die McKennas waren, zeigte sich daran, dass sie mir für die Anreise in die Hamptons einen Fahrer in einem äußerst bequemen, schwarzen Mercedes mit cremefarbenen Lederpolstern zur Verfügung stellten. Fast drei Stunden dauerte die Fahrt, aber da Paul mich vorgewarnt hatte, vertrieb ich mir die Zeit mit meiner To-do-Liste.
Einer der großen Vorteile, Vollzeit in einem Beruf tätig zu sein, der auf modernen Medien basierte, war die Flexibilität des Arbeitsgerätes. Ohne Laptop, aber mit meinem Handy bewaffnet, plante ich Social-Media-Beiträge, erhielt und verschickte E-Mails an Firmenpartner und bearbeitete sogar die letzten Fotos, die Paul und ich vergangene Woche produziert hatten.
Ich liebte meinen Job. Jaina Campbell war nicht nur mein Name, sondern eine Marke, die ich mit Pauls Unterstützung als Fotograf aufgebaut hatte. Zu Beginn schrieb ich auf meinem Blog in meiner gewohnt ehrlichen Art über das unverfälschte New Yorker Studentenleben. Kleine Wohnheimzimmer, Fertigessen, Partys, Last-Minute-Lernsessions und das Stehen auf eigenen Beinen.
Meine Leserschaft wurde mit mir zusammen erwachsen und inzwischen lebte ich von Werbekooperationen mit Firmen. Es gab keinen Job in dieser Welt, den ich lieber machen würde als diesen und so nutzte ich jede sich bietende Gelegenheit, um meiner Arbeit nachzugehen. Sogar auf dem Weg zur Verlobungsfeier meines Bruders.
Wir erreichten East Hampton pünktlich. Der Fahrer hielt in einer Auffahrt, in der ein großer Springbrunnen mit Engelsfiguren aus Stein leise vor sich dahinplätscherte. Gierig sog ich den Duft des Nordatlantischen Ozeans ein. Es war schon zu spät, um den Privatstrand zu nutzen, der an dieses Haus anschloss, aber so wahr mir Gott helfe – irgendwann, spätestens zur Hochzeit – würde ich meine Füße in den Sand vergraben und ins Wasser springen.
Das Grundstück selbst grenzte an ein ungefähr siebzehn Hektar großes Naturschutzgebiet. Niemand brauchte sich hier um lästige Nachbarn zu sorgen. Das Haus an sich umfasste laut Paul über ein-fucking-tausend Quadratmeter und beherbergte um die acht Schlafzimmer und zehn Bäder. Es musste mehrere Millionen Dollar wert sein.
Paul und ich waren nicht arm aufgewachsen, dafür hatten unsere erfolgreichen Eltern gesorgt, aber das war doch nicht normal. Wozu brauchte man so viel Platz?
Offenbar um pompöse, gesellschaftlich anerkannte Hochzeiten zu feiern.
»Ich bringe Ihre Tasche in das Gästehaus«, verkündete mir der steife Fahrer. Ich nickte. Klar, es gab selbstredend auch eine separate Unterkunft für Besucher. Irgendetwas musste man ja mit dem riesigen Grundstück anstellen.
Das Anwesen an sich versprach unglaublichen Luxus. Die Fassade bestand aus einer gesägten Weißeichenvertäfelung mit Kreideanstrich. Bei Tag spendete eine Überdachung – eine sogenannte Porte-Cochère – Schatten über dem Eingangsbereich, deren Tür sich genau in diesem Moment öffnete. Paul kam mir mit einem breiten Lächeln entgegen.
»Bruderherz«, begrüßte ich ihn mit einer Umarmung, ehe ich Abstand nahm, um ihn unter die Lupe zu nehmen.
Im Alltag war er ein äußerst praktisch veranlagter Typ, der sich bequem kleidete. Da er meistens in der Natur fotografierte, trug er eher Jeans, feste Schuhe und Oberbekleidung, die ihn warmhielt oder nicht so schnell zum Schwitzen brachte.
Der Mann vor mir war das genaue Gegenteil. Weißes Hemd mit schwarzer Fliege, dunkles Jackett, Anzughosen und Oxford-Schuhe.
»Meine Güte«, stieß ich beeindruckt aus. »Ich wusste gar nicht, dass du so schick aussehen kannst«, scherzte ich. Paul konnte im Grunde alles tragen. Er wollte es nur nicht.
»Im Vergleich zu den Leuten da drin«, er deutete mit dem Daumen über seine Schulter, »sehe ich aus, als würde ich den Müll rausbringen.«
»Ist der Anzug von der Stange?«
Er nickte gleichmütig. Die Leute drinnen mussten Kleidung tragen, die vermutlich so viel kostete, wie ich in einem Jahr verdiente.
Und ich verdiente wirklich nicht schlecht.
»Mach dir nichts draus.« Ich trat einen Schritt zurück und präsentierte in einer schwungvollen Drehung mein Kleid. »Großtante Daisys Beerdigung.«
Paul lachte. »Da passt du nach all den Kuchen, die Miriam immer mitbringt, noch rein?«
Ich schlug ihm auf den Oberarm, wissend, dass er mich nur neckte. »Sei still, sonst dreh ich um und fahre wieder. Dann musst du mit den Bonzen allein klarkommen.«
»Bitte nicht«, flehte er mich in gespielter Theatralik an. Mit einer einladenden Handbewegung forderte er mich auf, ihm zu folgen. »Ich sollte dich vielleicht warnen.«
»Wovor genau?« Es war ja nicht so, dass wir den Umgang mit reichen Proleten nicht kannten. Wir hatten Privatschulen mit den Nachwuchssnobs überlebt und diverse Geschäftsdinner unserer Eltern. Mich schockte nicht mehr viel, wobei diese eintausend Quadratmeter vor mir sicherlich einiges an Potenzial für Überraschungen bereithielten.
»Vor den McKennas«, sagte er mit einem zähneknirschenden Unterton.
Ich betrachtete ihn von der Seite. So kannte ich ihn gar nicht. Paul war eher berühmt für seine stoische Gelassenheit. »Ist Heathers Mom so schlimm?«
»Nein, sie ist wirklich sehr nett. Aber du solltest dich vor Heathers Bruder in Acht nehmen.«
Bruder? Heather hatte Geschwister? Davon hörte ich zum ersten Mal. »Was ist so schlimm an ihm?«
»Er ist ein Schürzenjäger«, erklärte er voller Unglück in der Stimme.
Ich verstand nicht, was sein Problem war. »Ja und?«
»Pass einfach auf, dass du nicht in seine Fänge gerätst.«
Paul sorgte sich um meine Tugendhaftigkeit. Ich lachte voller Wärme in der Brust. Er würde am Ende des Tages immer mein älterer, beschützender Bruder bleiben. »Mach dir keine Sorgen. Ich bin ein großes Mädchen und kann mit Idioten umgehen. Oder hast du ihn auch vor mir gewarnt?«
Er bedachte mich mit einem Augenrollen, aber in seinem Blick spiegelte sich vor allem Skepsis. Paul war nicht begeistert, dennoch beließ er es dabei und schwieg. Eine unserer Regeln sah so aus, dass wir uns nicht in das Liebesleben des jeweils anderen einmischten. Wahrscheinlich könnte er sich mehr entspannen, wenn ich ihm versprach, dass ich mich heute Abend nur mit einem Typen umgeben würde – mit Mr Jack Daniels.
Wir traten durch die Haustür und standen in einer zweistöckigen Eingangshalle mit Wänden aus französischem Kalkstein. Geschwungene Treppen führten hoch zu einer Galerie und geschmiedete Eisengeländer bewahrten vor dem Sturz in die Tiefe. Niemand wollte gerne auf den hellen Marmorfliesen aufschlagen.
»Wow«, staunte ich. Exotische Grünpflanzen brachten etwas Farbe in diesen Bereich des Hauses, ansonsten wurde mit Dekoration gespart. Eine teure Immobilie wie diese beeindruckte durch ihre pure Existenz und absoluten Minimalismus. Ich musste mir echt keine Gedanken darüber machen, dass Heather meinen Bruder wegen unserer wohlhabenden Eltern heiratete.
Paul seufzte und begleitete mich durch einen beleuchteten Durchgang hinein in einen Raum, der bestimmt um die neun Meter Deckenhöhe maß und damit mindestens zwei weitere Etagen umfasste. Jeweils zu unserer Linken und Rechten flankierten zwei imposante Marmorkamine die Seiten und die Galerie aus dem Eingangsbereich umschloss auch diesen Teil des Hauses. Bequeme, cremefarbene Sofas und Sessel luden zum Ausruhen ein. Flügeltüren führten zu einer Kalksteinterrasse, zu der ein großer Pool gehörte.
Dort fand die Party statt. Der Altersdurchschnitt der Gäste lag ziemlich weit oben. Ein Haufen alter, weißer Männer in teuren Jacketts und mit grauen Haaren lachten über ihre vermutlich schlechten Witze.
Ich war noch nie auf einer Verlobungsfeier gewesen, aber wenn die immer so aussahen, dann verstand ich durchaus den Reiz daran. Lichterketten und Strandfackeln tauchten das Grundstück in romantisches Licht. Ein großes Buffet versorgte die Gäste mit Essen und Kellner schenkten am laufenden Band Champagner, Wein oder Whiskey nach. Für einen Abend im engsten Kreis zählte ich locker vierzig bis fünfzig Besucher. Klein war für die Reichen eben eine relative Größe.
In der Ferne entdeckte ich das honigblonde Haar von Heather. Sie trug es offen zu goldenen Accessoires, die zu ihrem bodenlangen, weißen Chiffonkleid passten. Dadurch, dass nur ein breiter Träger den Stoff an ihrem Körper hielt, sah sie mit dem A-Linienschnitt aus wie eine Prinzessin.
Es bestand keinen Zweifel, wer das Juwel dieser Party darstellte. Pauls warmherzigem Blick nach zu urteilen, verliebte er sich mit jeder Minute noch ein bisschen mehr in sie.
Neben Heather stand ihr etwas kleineres und älteres, aber nicht weniger umwerfend schönes Spiegelbild. Mrs McKenna strahlte durch und durch die Eleganz einer High-Society-Lady aus, nur ohne das ganze Botox. Das hatte sie gar nicht nötig. Wenn Heather im gleichen Alter aussah wie ihre Mom, dann hatte Paul zumindest keinen Grund, ihre welkende Attraktivität zu bejammern.
Nicht, dass er der Typ dafür wäre, aber so was führte immer mal wieder zu unverhofften Scheidungen.
Ein Mann gesellte sich zu den beiden Frauen, und als sie zu ihm aufschauten – er war selbst im Vergleich zu Heathers langen Modelbeinen noch einen halben Kopf größer – leuchteten ihre Augen.
Wir bewegten uns langsam auf die kleine Runde zu. »Das ist Carter«, flüsterte Paul.
Ich nickte. »Ihr Bruder«, schlussfolgerte ich und betrachtete den Herzensbrecher etwas genauer.
Braunes, dickes Haar, ein sauber gestutzter Bart, eine scharf gezeichnete Kieferlinie und breite Schultern, um die sich ein schneeweißes, sorgfältig gebügeltes Hemd spannte. Im Gegensatz zu den meisten anderen hier ignorierte er die Abendhitze nicht und verzichtete auf ein Jackett. Je näher wir kamen, desto mehr beeindruckte mich seine Größe. Er musste locker über eins neunzig sein.
Er lächelte wegen etwas, das seine Schwester eben gesagt hatte, und da verlor ich jeden Restzweifel, dass ihm die Frauen zu Füßen lagen. Carter sah viel zu gut aus, um real zu sein, und ich kam nicht umhin, mich für einen Augenblick zu fragen, was er so unter seinem Hemd und der Anzughose versteckte.
»Jaina.« Heather begrüßte mich mit so viel überschwänglicher Freude, dass ihre Umarmung mich beinahe ins Stolpern brachte. Dezenter Alkoholduft stieg mir in die Nase. Sie war angetrunken, auf ihrer eigenen Verlobungsfeier. Fast hätte ich gelacht.
»Hey, Heather«, erwiderte ich lächelnd. »Noch einmal alles Gute zu eurer Verlobung.« Ich drückte sie und warf Paul dabei einen Hilfe suchenden Blick zu, der mir seine Verlobte vom Hals nahm.
»Vielen Dank.« Sie presste sich an Pauls Seite, der schützend den Arm um ihre Taille legte. »Darf ich dir meine Familie vorstellen?« Ich drehte mich um, bemüht, meine Aufmerksamkeit an ihre Mutter zu klammern. »Das ist meine Mom Leonora.«
Leonora beugte sich mir entgegen und begrüßte mich ebenfalls mit einer Umarmung. Diese Familie war mir etwas zu kuschelbedürftig für die über dreißig Grad, die hier draußen herrschten. »Es freut mich, dich kennenzulernen. Paul hat viel von dir erzählt.«
Ich warf ihm einen Blick zu. »Ich hoffe, nur Gutes.«
»Natürlich. Als ob man irgendetwas Schlechtes von dir erzählen könnte.«
Er grinste, denn wir wussten beide, dass manche die Liste meiner Sünden für ziemlich lang hielten.
»Und das ist Carter, mein Bruder«, fuhr Heather mit der Vorstellung fort.
Ich wappnete mich für den Casanova und drehte mich zu ihm. Aus bernsteinfarbenen Augen betrachtete er mich.
»Die berühmte Schwester.«
»Der berühmte Bruder«, erwiderte ich, um die gleiche gelassene Haltung bemüht wie er. Es gelang mir zum Glück gut, denn das interessierte Funkeln, mit dem er mich bedachte, drang tiefer in mich, als ich es zulassen wollte.
Während seine Schwester und seine Mutter es vorzogen, mich zu umarmen, ging er einen Schritt weiter. Carter beugte sich zu mir vor und hauchte mir erst auf die linke, dann auf die rechte Wange einen Kuss.
»Willkommen in der Familie«, flüsterte er mir ins Ohr, sein Atem warm und die vier Worte mit einem unausgesprochenen Versprechen verbunden.
Kapitel 2
Wenn ich mit Erin und Miriam ausging, dann konnte man uns gut an der Wahl unserer Drinks einschätzen.
Erin liebte alles, was auf der Zunge prickelte. Da sie selbst ein nervöses, aber äußerst süßes Naturell besaß, fand ich das ganz passend. Adam geizte nie mit teurem Champagner und so war sie auf den Geschmack gekommen. Miriam hingegen griff eher – wenn sie überhaupt etwas trank – zu einem Rotwein oder einem klassischen Cocktail, was ihre elegante Persönlichkeit unterstrich.
Ich dagegen liebte Whiskey. Das hatte ich mir unfreiwillig von meinem Dad abgeguckt, der oft in seinem Arbeitszimmer mit Kollegen und Freunden in alten Ledersesseln gesessen und welchen getrunken hatte. Nie waren Frauen dabei anwesend. Die hockten oft bei Mom und tranken ihren sauteuren Rotwein, den ich absolut widerlich fand. Whiskey hingegen besaß, je nach Sorte, diesen cremigen Honiggeschmack, der mir deutlich besser schmeckte. Außerdem fühlte es sich an, als würde ich mit meiner Vorliebe eine Norm brechen. Das machte mir meist noch viel mehr Spaß als das Trinken an sich.
Auf der Feier zeichnete sich das übliche Bild ab. Champagner und Wein für die Frauen, Whiskey und Scotch für die Männer. Jedes Geschlecht blieb fein säuberlich in ihre Gruppen sortiert unter sich. Nur Heather und Paul bildeten die Ausnahme. Als Gastgeber plauderten sie mit allen Gästen.
Ich selbst hielt mein Versprechen und wahrte die Nähe zur Bar, während ich entweder die Leute oder den Pool beobachtete. Die Wasseroberfläche erzitterte immer wieder ein bisschen, wenn lauer Wind vom Meer aufzog und wenigstens etwas Abkühlung brachte. Zu gerne wäre ich eine Runde schwimmen gegangen, aber als Trauzeugin und Schwester des Bräutigams sahen sich ein paar ältere Damen und Herren immer wieder dazu genötigt, mir ihre Aufwartung zu machen. Obwohl ich freundlich blieb, behielt ich die Maske der Eisprinzessin auf. So kam wenigstens niemand von ihnen auf die Idee, mich anzugraben oder mir ihre unverheirateten Söhne vorzustellen.
»Du siehst aus, als würdest du dich köstlich amüsieren.«
Ich sah zur Seite und erblickte Carter, der auf mich zukam. Seine Finger schlossen sich um den Hals einer Bierflasche, die andere Hand steckte in der Hosentasche.
»Gut, dann zweifelt niemand das Gegenteil an«, erwiderte ich schmal lächelnd. Er pirschte sich an mich heran wie ein zur Geduld gezwungenes Raubtier. Als wollte er mit mir, der armen Gazelle, nur ein Tässchen Tee trinken.
»So schlimm?«
Ich schnaubte und zwang meine Mundwinkel dazu, keine Regung von sich zu geben. »Ich habe schon schrecklichere Partys erlebt. Allerdings waren die Gäste meist jünger.«
»Wilde Studentenzeit?«
»Eher nervige Kindergeburtstage.«
»Klingt nach einem Trauma.«
»Topfschlagen mit verwöhnten Fünfjährigen macht einfach keinen Spaß.«
Ich bemerkte aus den Augenwinkeln, wie er grinste und einen großen Schluck aus der Flasche nahm. Das Bier passte zu ihm. Er war nicht der Whiskey-Typ, geschweige denn sonst etwas anderes. »Privatschulkids?«
Ich warf ihm einen kurzen Seitenblick zu und nippte ebenfalls an meinem Glas. »Gut geraten.«
»War nicht schwer. Paul hat bei einem Abendessen von seiner Zeit an der Jungenschule erzählt.« Sein Blick traf meinen und mir fiel auf, dass seine Augen fast dieselbe Farbe wie mein Drink hatten. »Haben sie dich in eine Mädchenschule gesteckt?«
»St. Marys.«
»Was für eine Schande.«
Damit entlockte er mir doch ein Schmunzeln, das ich jedoch zügig überspielte. Es war besser, Carter mit mindestens einer Armlänge Abstand von mir fernzuhalten.
»Und du?« Ich nickte auf seine Bierflasche. »Keine Lust, dich mit den Männern bei einem Glas Scotch und Zigarren zu unterhalten?«
Er grinste süffisant. »Männer interessieren mich herzlich wenig.«
»Also ziehst du von Frau zu Frau und versuchst dein Glück?«
»Haben die Damen schon wieder über mich getratscht?«
Ich zuckte die Schultern. »Partys sind ein Abbild der Gesellschaft. Und die liebt Menschen mit einem zweifelhaften Ruf. Die sorgen immerhin für Gesprächsstoff.«
Carter beugte sich zu mir runter. »Deswegen reden auch alle hinter vorgehaltener Hand von der heißen Eisprinzessin?«
Ich hob eine Braue und drehte den Kopf so, dass ich in sein Gesicht schauen konnte. Erst durch die Nähe erkannte ich einen dunkelgrünen Rand, der seine bernsteinfarbenen Augen umschloss. »Wenigstens sagen sie, ich wäre heiß. Von dir höre ich nur, dass du ein Herzensbrecher bist.«
»Das heiß war eine freie Ergänzung meinerseits.«
»Na dann – danke.«
Er richtete sich wieder auf. »Danke?«
Erleichtert über den zurückgewonnenen Abstand atmete ich aus. »Als Prinzessin besitze ich immerhin genug Manieren, mich für ein Kompliment bedanken zu können.«
Er grinste, schüttelte den Kopf und trank erneut einen Schluck, ehe er eine Hand in die vordere Hosentasche schob und meinem Blick in die Ferne folgte, wo der Ozean lag.
»Wollen wir zum Strand?«, fragte er beiläufig.
Hin- und hergerissen zwischen meinem Drang, von hier wegzukommen und endlich zum Wasser zu gelangen – zum richtigen Wasser, nicht diesem chlorverseuchten Pool –, und dem Wissen, dass er mich dann begleitete, runzelte ich die Stirn.
»Ich glaube, unser Verschwinden würde auffallen«, wandte ich ein.
»Na und?« Er nahm mir mein Glas ab, stellte es auf das Tablett eines vorbeilaufenden Kellners und betrachtete mich mit einem herausfordernden Ausdruck von der Seite. »Was sollte schon passieren? Nachsitzen, weil wir diese dämliche Feier schwänzen?«
Dass er die Verlobungsparty als dämlich bezeichnete, was in etwa meinen eigenen Gedanken entsprach, rückte ihn in meiner Gunst ungewollt höher. Wenigstens hatte ich in ihm jetzt einen Leidensgenossen gefunden.
»Eigentlich soll ich mich von dir fernhalten«, verriet ich ihm. Warum ich das tat, konnte ich gar nicht so genau sagen. Möglicherweise, um eine andere Reaktion zu provozieren als die lässige Fassade, die er mir bot. Oder weil ich das dritte Glas Whiskey intus hatte und das Denken dadurch schwerer wurde.
»Niemand hat behauptet, dass wir am Strand vögeln müssen.«
Ich lächelte so aufreizend wie möglich und fragte im Spaß: »Werden wir nicht?«
»Ich sagte nur, dass wir es nicht müssen. Nicht, dass ich es nicht will.«
Ein ehrliches Lachen rutschte mir über die Lippen und noch ehe ich mich umentscheiden konnte, folgte ich ihm, einen Scheiß darauf gebend, was die Gäste von uns dachten. Nur nach Paul schaute ich mich um, doch der war nirgends zu sehen. Seine Meinung war die einzige, die gezählt hätte, aber da er nicht anwesend war, blieb sie mir erspart.
»Warte kurz«, flüsterte er mir zu und ließ mich an der Treppe stehen, die runter zum Garten führte. Gespannt, was er plante, sah ich dabei zu, wie er sich an die Bar stellte, dem Kellner dahinter einen Schein zuschob, bevor er sich die ganze Flasche Jack Daniels schnappte, um damit zu mir zurückzukommen.
»Nicht, dass wir noch durstig werden«, kommentierte er seine Entscheidung. Er nahm meine Hand und führte mich mit zügigen Schritten von der Party weg. Abenteuerlust packte mich und mein Herz schlug so schnell wie schon lange nicht mehr. Mit Carter neben mir bewegte ich mich auf dünnem Eis, aber wann hatte mich die Aussicht auf Probleme jemals davon abgehalten, Spaß zu haben?
* * *
Zufrieden seufzend vergrub ich meine rot lackierten Zehen früher in den warmen Sand als gedacht. Das Meer schwappte nur wenige Meter von mir entfernt in kleinen Wellen gegen den Strand und trug die Luft des Ozeans an meine Nase. Algen, Schlamm, Salz – der Geruch war so prägnant, ich konnte nicht genug davon bekommen. Immer wieder atmete ich tief ein und aus und versuchte, so viel wie möglich in mich aufzusaugen. Dennoch reichte es nicht.
»Ich habe noch nie jemanden gesehen, der in der Nähe von Wasser so zufrieden aussieht«, hörte ich Carter hinter mir sagen.
Ich drehte mich etwas zur Seite, gerade genug, um ihn im Sand sitzen zu sehen.
»Vermutlich, weil du dich mit Leuten umgibst, die jederzeit Zugang dazu haben.«
Sein weißes Hemd hob sich vor dem nachtblauen Himmel ab. Die obersten zwei Knöpfe standen offen und er trug die Krawatte inzwischen nur noch locker um die Schultern gelegt. Die hochgekrempelten Hemdsärmel entblößten kräftige, muskulöse Unterarme.
»Nein, die meisten interessieren sich eher nicht für so was.«
»Fürs Meer?«
»Für die Natur.«
Ich lachte. »Und du bist so ein Naturbursche?«
Carter winkelte ein Bein an und stützte seinen Ellenbogen darauf ab. Ich erkannte ein süffisantes Schmunzeln auf seinem Gesicht. »Nein, so kann man das nicht sagen. Aber manche Dinge machen draußen eben mehr Spaß als in der Stadt.«
Ich konnte mir schon denken, worauf er abzielte, hakte aber nicht weiter nach. Stattdessen genoss ich für einen Moment mit geschlossenen Augen die Ruhe, die das Meer mitbrachte.
Das knacksende Geräusch eines Deckels, der zum ersten Mal aufgeschraubt wurde, durchbrach die Stille und ich beschloss, mich zu Carter zu setzen. Irgendwie interessierte es mich, welche Art Mensch er war. Seinem Äußeren nach zu urteilen, schien es recht eindeutig: Playboy. Casanova. Herzensbrecher. Aber ihn darauf zu reduzieren war genauso, wie wenn man meinte, ich wäre ausschließlich die Eisprinzessin.
Meine Freundinnen kannten diese Seite an mir nicht, weil ich sie ihnen gegenüber gar nicht aufsetzen musste. In ihrer Nähe war es leicht, mich fallen zu lassen. Einfach ich zu sein. Ich wurde nicht wie Erin dauernd rot, wenn mir jemand ein Kompliment machte, oder rannte die meisten Tage in wunderschönen Kleidern wie Miriam herum. Nein. Ich fluchte, ich trank, ich sagte meine Meinung, selbst wenn sie nicht jeden zufriedenstellte.
Meine Eltern – ganz besonders meine Mutter – hassten meine echte Seite. Andauernd hatte sie mir gesagt, dass Mädchen nicht fluchen oder wie billige Huren roten Lippenstift tragen. Auf diese Weise würde man mich niemals ernst nehmen. Selbst der Umstand, dass ich keinen festen Partner, dafür aber hin und wieder One-Night-Stands hatte, stieß ihr sauer auf. Eine Frau war nur so stark wie ihr Leben stabil. Den Mangel einer ernsthaften Beziehung verbuchte sie als Schwäche, als fehlende Konstante, die einem Kraft gab.
Was für ein Bullshit. Ich trug mit großer Vorliebe knallrote Lippenstifte, fluchte oft wie ein Kesselflicker und schlief, wenn mir danach war, mit jedem halbwegs attraktiven Kerl, der meinen Weg kreuzte.
Miriam und Erin akzeptierten mich so, wie ich war, doch vor den meisten Fremden verbarg ich meine echte Seite. Sie lernten meine kalte Schulter kennen, denn in ihren Köpfen existierte längst ein Bild von mir, noch ehe sie drei Worte mit mir gewechselt hatten.
Bei Carter war es bestimmt genauso. Er hielt mich für schnell und leicht rumzukriegen. Vielleicht lag er damit nicht ganz so falsch, je nachdem, wie der Abend hier verlief und ich Lust hatte. Gleichzeitig war ich neugierig zu erfahren, welche Persönlichkeit er vor der Welt versteckte, denn im Grunde taten wir das doch alle.
»Okay, Carter McKenna«, begann ich und ließ mich, Erins Schuhe in der Hand haltend, neben ihn in den Sand fallen. »Da wir bald mehr oder weniger Familie sind, sollten wir uns möglicherweise kennenlernen.«
»Ich weiß schon ziemlich viel über dich, Jaina Campbell.«
Ich hob eine Braue. »So?«
»Es war kein Witz, als meine Mutter sagte, dass dein Bruder viel über dich redet.«
»Er redet lieber über mich als über sich.«
»Offenbar.«
»Und was hat er so erzählt?«
Carters Mundwinkel zuckte. »Du wohnst mit einer Freundin in Queens, hast einen Hund, bist hauptberufliche Bloggerin und nicht auf den Mund gefallen.«
»Klingt ganz nach mir.« Ich überlegte kurz, was ich bereits von Carter wusste, aber es ging nicht über den Fakt hinaus, dass er ein Frauenheld war. »Mir hat man vorab leider kein Briefing zu dir gegeben.«
»Zum Glück – was sollten wir sonst bloß mit unserer Zeit anstellen?«
Ich verkniff mir ein Grinsen. Carters Art gefiel mir. Er war erfrischend entspannt und sich mit ihm zu unterhalten, machte irgendwie Spaß. »Lenk nicht ab. Ich muss wissen, wer in Zukunft bei Familientreffen mit am Tisch sitzen wird.«
»Ich wohne ebenfalls in New York und sitze im Vorstand von McKenna Cars. Die meiste Zeit treibe ich mich aber eher herum und schaue mir die neuesten Automodelle an oder spiele den Testfahrer.«
»Klingt aufregend.«
»Ich kann mich nicht beklagen.«
»Und sonst? Irgendwelche Freundinnen, die mir vor Eifersucht an die Gurgel gehen, wenn sie mitbekommen, dass ich hier mit dir sitze?«
»Versuchst du herauszufinden, ob ich zur Verfügung stehe?«
»Ich versuche lediglich auszumachen, wie gefährlich es ist, in deiner Nähe zu sein.«
»Dass man dich vor mir warnt, sollte wohl die Frage beantworten.«
Ich stieß ein Lachen aus und schüttelte den Kopf. Mit ihm zu reden, glich einem Wortduell und ich liebte es zu sehr, Wettbewerbe zu gewinnen, als mich nicht darauf einzulassen. Doch damit hatte er wohl recht. Wäre er an jemanden gebunden, wäre Paul deutlich entspannter gewesen.
»Lass uns ein Spiel spielen«, schlug ich vor und nahm ihm die Flasche aus der Hand, um einen Schluck daraus zu trinken. Jack Daniels war nicht mein allerliebster Lieblingsdrink, aber das richtig gute Zeug verschlossen Gastgeber bei größeren Anlässen oft sicher, damit es nicht wie Wasser weggesoffen wurde.
»Ein Spiel?« Ich nickte und beobachtete ihn abwartend. »Okay. Worauf hast du Lust?«
»Wahrheit oder Pflicht«, schlug ich enthusiastisch vor.
»Zu zweit?«
»Das macht Spaß«, versicherte ich ihm. Carter nahm mir die Flasche ab, trank und stellte sie zwischen uns.
»Von mir aus. Du darfst anfangen, Prinzessin. Wahrheit oder Pflicht?«
Gänsehaut überzog mich, als er mich so nannte. Ich räusperte mich. »Wahrheit.«
»Wie langweilig.«
»Kommt auf die Frage an«, sagte ich lächelnd.
Er rieb sich gespielt nachdenklich über den Bart. »Hast du denn einen Freund?«
»Wieso?« Ich lachte. »Hast du Angst, er könnte auftauchen und dich verprügeln?«
»Sehe ich aus, als wäre ich so leicht niederzustrecken?«
Mein Blick wanderte über seine angespannten Arme und die breiten Schultern. »Nicht wirklich.«
»Siehst du.« Er betrachtete mich mit selbstgefälliger Arroganz. »Los, beantworte die Frage.«
Ich schnaubte und lehnte mich nach hinten, die Ellenbogen zur Stütze in den Sand gegraben. »Genau wie du bin ich frei wie ein Vogel.«
»Gut zu wissen.«
Ich ging nicht weiter auf seinen Kommentar ein. »Wahrheit oder Pflicht?«
»Pflicht.«
»War so klar.«
»Enttäuscht?«
»Kommt darauf an, was du tun wirst.«
»Stell mir eine Aufgabe und ich gebe mein Bestes.«
Ja, da war ich mir sicher. Ich überlegte kurz. Da ich nun zumindest ein bisschen über ihn in Erfahrung gebracht hatte, war es an der Zeit herauszufinden, ob hinter seiner großen Klappe mehr steckte als nur heiße Luft.
»Spring ins Meer.«
Ein herausforderndes Blitzen zeichnete sich in seinen Augen ab. Ohne Widerworte zog er sich die Schuhe aus und stand auf. Seelenruhig öffnete er einen Knopf seines Hemdes, einen nach dem anderen. Dabei verankerten sich unsere Blicke, ehe er achtlos den Stoff von seinem Oberkörper streifte und ihn auf den Boden fallen ließ. Verdächtig langsam machte er sich an seiner Hose zu schaffen.
Er zog wirklich eine Show ab und ich genoss sie in vollen Zügen.
In Gedanken malte ich die Linien nach, die sich durch die Muskeln unter seiner Haut abzeichneten. Er hatte die perfekte Brust: glatt rasiert, leicht gebräunt, trainiert. Dazu ein Sixpack, das ihn viel Zeit gekostet haben musste, und seine Hüften formten ein V, dessen Spitze im Bund seiner Hose verschwand. Allein diese Aussicht erregte mich, aber als er nur noch in den engen, schwarzen Boxershorts vor mir stand, bereute ich meine Aufgabe zutiefst. Ich schien nicht die Einzige zu sein, die Freude an dem Spiel hatte, so viel konnte ich – überaus deutlich – erkennen. Allerdings hatte ich mir auch selbst ins Knie geschossen, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass sein Anblick mich so weichklopfen würde.
»Du starrst mir was weg«, bemerkte er mit einem zynischen Lächeln, ehe er sich umdrehte und in Richtung Wasser lief.
»Lass dich bloß nicht von den Fischen fressen«, rief ich ihm nach und sah dabei zu, wie er in den Ozean watete. Selbst von hinten war er mit dem breiten Kreuz nett anzusehen und an dieser Stelle wurde mir klar, dass wir miteinander schlafen würden. Die Frage war nur, wie leicht ich es ihm machte, mich zu erobern.
Sollte ihm der Badespaß zu kalt sein, ließ er es sich nicht anmerken. Ab einer gewissen Tiefe sprang er ins Wasser, tauchte unter und nach mehreren Sekunden wieder auf. Wie so ein verdammtes Parfummodel. Fehlte nur noch das tosende Meer, aber das schien von seiner Ausstrahlung genauso eingeschüchtert zu sein wie ein kleiner Teil in mir.
Auf dem Weg zu mir zurück wuschelte er sich durch das nasse Haar, sodass es ihm auf wundervoll chaotische Weise vom Kopf abstand.
Ohne sich wieder anzuziehen, setzte er sich neben mich. »Zufrieden?«
Ich nickte anerkennend. »Wusste nicht, dass du für die Chippendales arbeitest.«
Carter zuckte die Schultern, wodurch sich Wassertropfen von seinem Schlüsselbein lösten und über seine Brust rollten. Hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich ihm vorgeworfen, wirklich jedes Register zu ziehen, um mich zu verführen.
»Wahrheit oder Pflicht?«
»Pflicht«, lenkte ich ein, um mir nicht wieder vorwerfen zu lassen, ich wäre langweilig. Das war eine der schlimmsten Beleidigungen. Dabei hatte meine Mutter mich im Streit bereits ganz andere Sachen genannt.
»Bist du sicher?«
Sein Blick auf mir reichte aus, damit mein Puls vor Aufregung in die Höhe schoss. Ich fühlte mich wie das kleine Kind, dem es nicht erlaubt war, mit dem Feuer zu spielen, weil es sich daran verbrennen könnte.
Aber Feuer zog mich nun mal an, da konnte ich nichts gegen machen.
»Hast du Angst, dass dir nichts Gutes einfällt?«, reizte ich ihn und griff zur selben Zeit nach dem Jack Daniels, um daraus zu trinken. So, wie er mich ansah, brauchte ich eine Menge Mut für die Aufgabe.
Sein Lächeln schoss mir direkt zwischen die Beine. Als würde er mir allein dadurch versprechen, dass es nichts gab, vor dem er zurückschreckte.
»Du willst also Pflicht«, fasste er zusammen. Sein Blick wanderte an mir herab, blieb kurz an meinen Lippen, dann an meinen Brüsten hängen. Letztendlich saß sein Ziel jedoch tiefer. »Ich will, dass du dich selbst berührst.«
* * *
Mein erster Drang war, ihn zu fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hatte. Dann überlegte ich, ihn zu ärgern, denn seine Aufgabe war so oberflächlich formuliert, dass ich mir einfach an die Nasenspitze hätte tippen können und meine Pflicht wäre erledigt.
Ich tat nichts davon. Die Vorstellung, er würde mir dabei zusehen, wie ich mir selbst Freude bereitete, machte mich ganz scharf, auch wenn ich es vorzog, ihn zwischen meinen Beinen zu haben anstatt meiner Hand.
Trotzdem tat ich, was er von mir verlangte. Da ich sowieso schon zurückgelehnt saß, ließ ich meinen Zeigefinger über meinen Körper hinabtanzen. Ganz langsam, das gleiche Spiel spielend wie er zuvor, als er sich vor mir ausgezogen hatte. Ich gab ihm alle Zeit der Welt, meiner Hand mit seinem Blick zu folgen, der eine brennende Spur auf mir nach sich zog.
Pauls Warnung vor Carter hatte genau den gegenteiligen Effekt erzielt. Ich wollte ihn jetzt nur umso mehr, da ich wusste, dass er kein Mann war, der sich etwas von mir erhoffte, das ich ihm nicht geben konnte. Er sah gut aus, flirtete wie ein Weltmeister und schien die gleichen Vorstellungen von einem Abenteuer zu besitzen wie ich.
Unter anderen Umständen hätte jemand festgestellt, dass wir mehr gemeinsam hatten als gedacht. Aber das war mir zu romantisch, und wenn ich mich nach so was sehnte, würde ich den alten Ladys auf der Party meine Nummer geben, damit ihre braven, anständigen Söhne mit mir ausgingen.
Ich schob den Saum meines Kleides nach oben. Als meine Hand auf meinen Slip traf, spürte ich bereits, welche Wirkung Carter auf mich ausübte. Langsam rieb ich über den dünnen Stoff und ein wundervolles Ziehen breitete sich in meinem Unterleib aus. Ich stieß ein leises Keuchen aus. Im Gegensatz zu mir zeigte Carter keine Regung, aber ich nahm ihm das nicht ab. Selbst als mein Finger auf meine feuchte Haut traf und ich anfing, mich zu streicheln, erkannte ich die Lust in seinem Blick. Er mochte die Kontrolle über seine Körperregungen haben, doch nicht über seinen Ausdruck. Darin lag das gleiche Verlangen, das mich überkam, je schneller ich meine Klitoris rieb und mich in die Arme des Höhepunktes schob.
Gerade als ich von der Welle mitgerissen wurde, legte er mir die Hand auf den Mund und unterdrückte damit mein Stöhnen. Erschrocken blinzelte ich ihn durch den Schleier an und vernahm schwer atmend vertraute Stimmen.
»Paul.« Heathers Kichern – von ihr klang das irgendwie befremdlich – drang gedämpft an meine Ohren. »Wir dürfen doch nicht einfach verschwinden.«
»Es ist unsere Verlobungsparty, wir können tun und lassen, was wir wollen.«
Und das sollte wirklich mein Bruder sein? Der Typ, der nie die Regeln brach?
Fast hätte ich gelacht, aber dann hörte ich ein paar äußerst eindeutige Geräusche, die mich die Luft anhalten ließen. Mein Blick traf Carters und er hatte sichtlich damit zu kämpfen, nicht selbst zu lachen.
Vorsichtig nahm ich seine Hand von meinem Mund.
»Wir sollten abhauen«, flüsterte ich. Er nickte und sammelte seine Klamotten zusammen, während ich die Obhut für die Flasche und meine Schuhe übernahm. Meine Beine zitterten noch etwas und morgen fand ich mit Sicherheit den halben Strand in meiner Unterwäsche, aber jetzt wollte ich nur weg von hier. Paul dabei zu belauschen, wie er Heather ungeahnte Laute entlockte, stand definitiv so was von nicht auf meiner Bucket List.
Wie Diebe stahlen wir uns im Schutz der Dunkelheit vom Strand weg und in Richtung des Gästehauses. Es war eine kleinere Version des Haupthauses und lag so seitlich, dass man von der Party am Pool nur wenig mitbekam. Lediglich ein paar laute Lacher und Musik drangen bis dorthin, aber durch die Weitläufigkeit des Geländes würde niemand unsere Nachtruhe stören.
Wobei an Schlaf nicht zu denken war, wie mir Carter, kaum dass wir die Tür hinter uns geschlossen hatten, deutlich machte. Achtlos ließ er seine Sachen auf den Boden fallen, um mich an die Wand neben dem Eingang zu drücken. Seine Hände stützte er links und rechts von meinem Kopf ab und sein Körper umschloss mich wie ein Käfig. Er roch nach Meer, Whiskey und seinem ganz eigenen, markanten Duft. Ich wollte die Nase über seine Haut wandern lassen, meine Nägel in seinen Rücken vergraben und seinen warmen Atem an meiner Kehle spüren.
Carters Präsenz berauschte meine Sinne und kurbelte meine Fantasie an. Dann endlich senkte er den Kopf und küsste mich hart und fordernd. Seine Zunge schob sich zwischen meine Lippen, die ich nur allzu freiwillig für ihn öffnete. Er eroberte mich in einem hypnotischen Tanz, drückte sich an mich, ließ mich spüren, was seine engen Boxershorts nicht verbergen konnten.
Zuerst entglitten die Absatzschuhe meinen Fingern und fielen klappernd zu Boden. Ich achtete nicht weiter auf sie. Sollten sie von meiner lieblosen Behandlung Schaden davontragen, würde ich Erin neue kaufen. Mein Drang, durch Carters dichte, wilde Haare zu streichen, meine Hand in ihnen zu vergraben, war größer. Noch immer waren seine Strähnen etwas feucht und er gab einen kehligen Laut von sich, als ich vorsichtig an ihnen zog, um ihn von meinen Lippen zu lösen.
»Fuck«, hörte ich ihn gepresst von sich geben, während ich mich zu seiner Brust vorbeugte, um mit der Zunge über die erhitzte, salzige Haut zu lecken. Seine Muskeln spannten sich zum Bersten unter meiner Liebkosung an, bis ich einen kurzen Moment nicht mehr aufpasste und mir der Flaschenhals aus der anderen Hand entglitt. Mit einem lauten Knall zersprang der Jack Daniels auf den teuren Marmorfliesen in winzige Scherben.
Bevor ich erschrocken zur Seite treten konnte, hob Carter mich hoch. Instinktiv verschränkte ich die Arme hinter seinem Hals und blickte auf das Desaster hinab.
»Das müssen wir wegräumen«, stellte ich schwer atmend fest.
»Dafür ist morgen auch noch Zeit.«
Carter macht einen großen Bogen um das zerbrochene Glas – immerhin war er genauso barfuß unterwegs wie ich – und trug mich rüber zu einer Sofaanordnung.
»Meine Schwester hat vor ein paar Wochen knapp vier Millionen Dollar in dieses Gästehaus investiert.« Behutsam legte er mich auf die helle, angenehm weich gepolsterte Couch. Ich wollte mich gerade aufsetzen, da befand er sich bereits über mir. Sein Gewicht drückte mich in den Stoff zurück und erregte mich von Neuem. »Das gesamte Inventar ist noch jungfräulich, und wenn du nichts dagegen hast, werde ich das diese Nacht ändern.«
Ich zog die Unterlippe zwischen meine Zähne und grinste. »Du meinst damit hoffentlich nicht nur das Wohnzimmer.«
Sein Ausdruck versprach, dass er mich auf jedem Zentimeter nehmen würde, der nicht von den Scherben belegt wurde.
Angesichts seiner großen Pläne und den wenigen Stunden, die so eine Nacht zu bieten hatte, spreizte er meine Beine und vergrub sein Gesicht zwischen meinen Schenkeln. Nachdem ich mir selbst zum ersten Höhepunkt verholfen hatte, gab sich Carter reichlich Mühe, mich noch ein zweites und drittes Mal kommen zu lassen. Danach versenkte er sich tief in mir, immer wieder und ohne Rücksicht, so, wie ich es mochte. Wir mussten nicht viel reden, um schnell herauszufinden, was der jeweils andere liebte. Ich gab gerne die Kontrolle ab und Carter riss sie nur allzu bereitwillig an sich.
Wir harmonierten auf beängstigende Weise gut miteinander.
Irgendwann am nächsten Morgen wachte ich neben ihm im Bett auf. Da wir uns die letzte Nacht nicht die Mühe gemacht hatten, die Vorhänge zu schließen, fielen die ersten Sonnenstrahlen in das Zimmer. Es war offenbar meines. Ich entdeckte meine kleine Tasche mit Wechselkleidung unter einem Fenster.
Für ein paar Minuten blieb ich einfach nur liegen, den Kopf auf Carters Brust gebettet, die sich gleichmäßig hob und senkte. Ich lauschte seinem Herzschlag und genoss die Stille. Nach den wenigen Stunden Schlaf fühlte ich mich erschöpft und müde, aber auch außerordentlich entspannt. Carters Arm lag schwer um meinen nackten Oberkörper gewickelt, und ich spürte keinerlei Reue für das, was wir getan hatten. Mir war klar, um welchen Typen Mann es sich bei ihm handelte – einer, der sich nicht binden würde, und das gefiel mir.
Vorsichtig, um ihn nicht zu wecken, entzog ich mich seinem Halt. Er gab einen kurzen, widerstrebenden Laut von sich, schlief aber weiter. Ich speicherte mir noch einmal alles an ihm in Gedanken ab. Die dunklen Bartstoppeln, die angenehm auf der Haut kratzten. Seine weichen Lippen, die so begierig an mir gesaugt hatten, dass auf meiner Brust und auf der Innenseite meiner Oberschenkel Male davon zurückgeblieben waren. Dazu seine Hände, die festhielten, packten, sich in meinen Hintern gruben.
Ich hatte mit einigen Männern geschlafen. Viele waren gut gewesen, aber kein Vergleich zu Carter. Wir hatten ineinandergepasst wie Schlüssel und Schloss – und das meinte ich nicht nur metaphorisch.
Genau deswegen war es an der Zeit für mich, zu gehen. Ich zog mir einen Bademantel über und verschwand im Bad, das zu diesem Zimmer gehörte. Er würde dadurch bestimmt wach werden und wir einander noch einmal begegnen. Aber da er der Bruder der zukünftigen Braut und ich die Schwester des Bräutigams war, konnten wir das sowieso nicht vermeiden.
Ich nahm mir viel Zeit, um das letzte Sandkorn von meinem Körper zu spülen, meine Haare glatt zu föhnen und mich zu schminken. Da die Party nun vorbei war und draußen die Sonne wieder unerbittlich auf uns herabschien, entschied ich mich für schlichte Jeansshorts und ein locker sitzendes, weiches T-Shirt.
Als ich das Badezimmer verließ, war das Bett verwaist. Nur eine einzelne Rose lag darauf, von Carter weit und breit nichts zu sehen. Etwas an dieser Geste kitzelte einen Nerv in mir, den ich schnell zum Schweigen bringen musste. Und obwohl es nicht dabei half, hob ich den blutroten Blütenkopf an meine Nase. Sie duftete intensiv und ich schloss genussvoll die Augen. Keine Schnittrose. Die rochen heutzutage fast gar nicht mehr und dieses Exemplar hier explodierte förmlich. Ungewollt lächelte ich bei der Vorstellung, dass Carter sie von einer der Rosenbüsche auf diesem Grundstück geschnitten hatte.
Das war aber nicht das Einzige, was mir auffiel. Ich lief mit meiner Tasche nach unten. Mein Blick ging sofort zur Eingangstür, wo ich Scherben und vertrockneten Whiskey erwartete. Nichts davon war mehr übrig, jemand – ich konnte kaum glauben, dass das ebenfalls Carter gewesen sein sollte – hatte sie zusammengekehrt und alles weggewischt. Auch meine Kleidung, die es nicht bis hoch ins Zimmer geschafft hatte, lag halbwegs ordentlich auf der Sofalehne.
Das Gästehaus war nicht so ein Palast wie das Haupthaus, aber das Geräusch von laufendem Wasser bemerkte ich erst, als ich in die vermeintliche Ruhe lauschte. Carters Zimmer – oder vielleicht das eines anderen Gastes – lag scheinbar weiter weg vom Wohnzimmer. Ich überlegte, noch einmal zu ihm zu gehen und mich für die kleinen Aufmerksamkeiten zu bedanken, entschied mich dann aber doch dagegen.
Wir hatten nur miteinander geschlafen, nicht mehr und nicht weniger. Er hatte das Gästehaus seiner Familie aufgeräumt und mir einen letzten, wohlduftenden Blumengruß hinterlassen. Ich war davon überzeugt, dass er das bei jeder Frau so tat. Er gehörte nicht zu den Männern, die sich am nächsten Morgen als Arschloch entpuppten – dafür musste ich ihm aber noch lange nicht nachlaufen und mich bedanken.
Stattdessen packte ich meine restlichen Sachen ein, zog mir flache Turnschuhe an und sah mich ein letztes Mal um.
Rückblickend war die Verlobungsfeier gar nicht so schlecht gelaufen, wie befürchtet. Aber ich hatte ja auch nicht damit gerechnet, auf Carter McKenna zu treffen, der mir den Abend versüßte. Wenn diese Art Partys immer so liefen, musste ich sie wohl häufiger besuchen. Nur zweifelte ich daran, noch öfter auf Männer zu stoßen, die einen dermaßen bleibenden Eindruck hinterließen wie er.
Ob ich es wollte oder nicht, er war mir unter die Haut gegangen. Und das gelang nicht vielen Menschen.