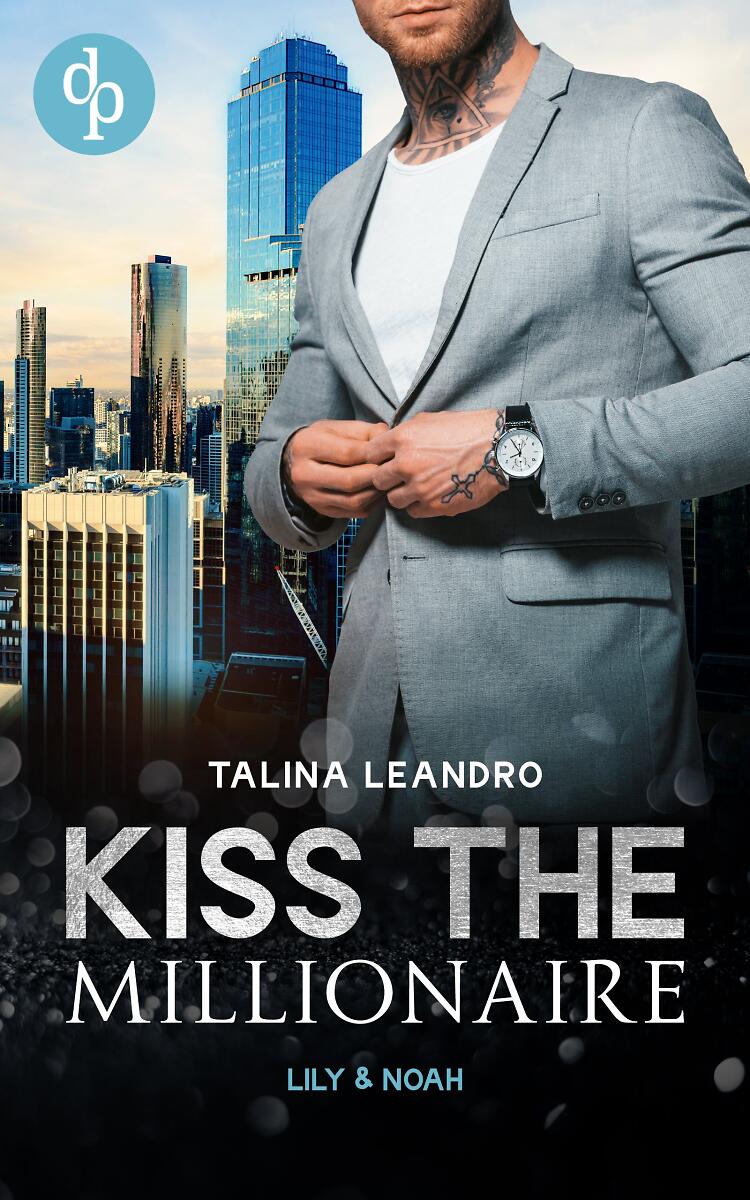Kapitel 1
Noah
Portsea, Australien
Die dunklen Straßen sind nur durch einzelne Laternen spärlich erleuchtet. Mittlerweile ist es halb fünf in der Früh und bald wird die Sonne aufgehen. Seit Stunden ziehe ich mit meinen Jungs Will, Brad und Zack, die ich seit dem Sandkasten kenne, von Bar zu Bar. Das machen wir an jedem unserer monatlichen Männerabende, die für gewöhnlich unter viel zu viel Alkoholeinfluss auf einen spontanen Abstecher in einem Tattoo-Studio enden, um irgendein Ärgernis zu kompensieren, das meistens durch meine ach so vorbildliche Familie ausgelöst wird. Der Schmerz beim Stechen, gibt mir den absoluten Kick und ein euphorisches Gefühl. Doch nicht heute. Nach dem letzten Absacker ziehen wir durch die Straßen von Portsea – einer wunderschönen kleinen Küstenstadt, unweit von Melbourne – auf der Suche nach Abenteuer, Action und Ablenkung.
Zack hat sich von seiner Freundin Sabrina getrennt und ist heute ziemlich auf Krawall gebürstet. Ich bin der Älteste unserer Männerrunde und leider auch derjenige, der jedes Mal verhindern muss, dass unsere Abende nicht völlig aus dem Ruder laufen. Die drei sind ziemliche Chaoten und sicher nicht der beste Umgang, doch mein einziges Tor zu einer halbwegs normalen Welt, in der nicht ständiger Erfolgsdruck, Etikette und Machtgehabe den Tag bestimmen.
Wir sind auf dem Weg zur nächstgelegenen Tankstelle, denn so langsam geht uns das Bier aus.
Die Nacht ist sternenklar und auf der Back Beach Road fährt kein einziges Auto.
Zack balanciert wackelnden Schrittes und mit ausgebreiteten Armen mitten auf dem Fahrstreifen. Er singt lauthals vor sich hin und macht seinem Kummer auf diese Art und Weise Luft. Um welchen melancholischen Herz-Schmerz-Song es sich handelt, ist allerdings nicht klar herauszuhören. Zack ist wohl schon so benebelt, dass er garantiert nicht einmal mehr selbst die Melodie zuordnen könnte. Aber besser Singen, als weitere Straßenlaternen auszutreten, wie er es vor einer Stunde noch getan hat.
„Halt endlich die Klappe, Zack. Mein Bier wird noch schal“, grölt sein zwei Jahre jüngerer Bruder Will lachend hinter mir. Wir haben uns für das Wochenende in dem Ferienhaus seiner Eltern in Portsea eingenistet, um Zack auf andere Gedanken zu bringen. Je weiter wir von seiner Ex entfernt sind, desto besser – und dieses kleine Kaff irgendwo in der Pampa erscheint mir als genau richtig dafür. Unser Kreuzzug dürfte bei dem Alkoholkonsum der Jungs wahrscheinlich recht bald ein jähes Ende finden. Spätestens wenn Brad einen bestimmten Pegel erreicht hat, von dem er nicht mehr weit entfernt ist, wird er sich ein ruhiges Eckchen suchen und einfach wegpennen. Einfach so. Und wir Idioten können dann sehen, wie wir ihn wieder auf die Beine bringen und nach Hause befördern.
„Mehr Bier!“, grölt Brad und torkelt auf mich zu. Seine Wangen sind vom Alkohol gerötet und sein Blick leicht schielend. Er legt den Arm um meine Schulter. „Noah, mein Hübscher mit der sexy Goldcard. Komm, hol uns Nachschub. Vielleicht ist ja eine nette Kassiererin am Start. Die kannst du dann direkt mitbringen.“
Ich drücke Brad von mir, denn er stinkt total nach Kneipe. „Rück mir nicht so auf die Pelle“, entgegne ich und schiebe nach: „Noch ein Sixpack und dann ist Feierabend, Bradley Simpson!“
„Hey, Noah. Du hörst dich an wie deine Brüder. Ich dachte, du seist nicht so ein Spießer wie die beiden“, bemerkt Will und späht in seine leere Flasche auf der Suche nach dem letzten Tropfen Bier.
„Du spinnst doch“, erwidere ich kopfschüttelnd und erwische mich dabei, wie ich beim Gehen meine Chucks über den Asphalt schleifen lasse. Wenn ich so weitermache, werden sie schneller abgenutzt sein, als mir lieb ist. Dabei habe ich sie erst vor wenigen Tagen gekauft. Es ärgert mich, wenn ich mit meinen Brüdern verglichen werde. Vergleiche haben mein bisheriges Leben schon viel zu sehr geprägt. Wer ist erfolgreicher? Wer wickelt die meisten Geschäfte ab? Wer zieht die besseren Kunden an Land? Wer hat den besseren Abschluss? Ich kann es nicht mehr hören. Deshalb habe ich bereits mit sechzehn alles dafür gegeben, um aus meiner Braver-Muster-Sohn-Rolle auszubrechen und mir die ersten Tattoos stechen lassen. Eigentlich war es nur eine Trotzreaktion und reine Provokation gegen meine Eltern. Doch mittlerweile haben diese Tattoos eine tiefere Bedeutung: Sie zeigen mir, dass ich mehr bin, als nur ein gut erzogener, wohlhabender Mensch, dem seine Rolle antrainiert wurde. Ich bin Noah Taylor, der Kreativkopf, der, der seine eigenen Weltvorstellungen hat. Und die bestehen nicht aus Reichtum und Erfolg. Sondern aus Leben und Verwirklichung.
Unser Fußmarsch dauert schon länger als zwei Stunden und meine Fußsohlen schmerzen mittlerweile bei jedem Schritt, doch ich beschwere mich nicht. Erleichtert nehme ich die Lichter einer Tankstelle in Augenschein.
Zack stimmt Too Lost In You von den Sugarbabes an.
Sofort schnelle ich herum, ziehe die Brauen finster zusammen und lege den Zeigefinger auf die Lippen. „Pssst!“ Bin ich denn der Einzige hier, der noch einigermaßen klar denken kann? Obwohl … auch ich habe mittlerweile einen leichten Schwips. Trotzdem müssen wir ja nicht auf Biegen und Brechen die Leute verärgern. So viel Benehmen habe ich auch mit erhöhtem Alkoholpegel noch. Den Kopf wieder geradeaus auf die Straße gerichtet, nähere ich mich der Tankstelle. Kurz vor dem Eingang bleibe ich stehen.
„Will, du kommst mit. Zack und Brad“, mitleidig schaue ich an ihnen herab, so wie es meine Mutter immer tut, wenn sie ihr Gegenüber einer ihrer abfälligen Musterungen unterzieht, „ihr bleibt besser hier. Setzt euch einfach irgendwo hin und wartet.“ Ich richte mein Basecap, ignoriere das lallende Genörgel hinter mir und passiere, gefolgt von Will, die sich automatisch öffnende Ladentür.
Wie bei einem Raubzug streifen wir an den Regalen vorbei, machen bei den Chipstüten und dem Kuchenregal Halt, obwohl wir eigentlich nur Bier kaufen wollen.
Der Mann hinter der Theke hat uns bereits beim Eintreten kritisch in Augenschein genommen, so als würde uns auf der Stirn stehen, dass wir lange Finger machen wollen. Dass mein Portemonnaie mit dicken Scheinen bestückt ist, kann er ja nicht wissen.
„Lass uns was Süßes mitnehmen“, schlägt Will mit weit aufgerissenen Augen vor und zeigt auf den abgepackten Fertigkuchen.
Doch ich schüttele den Kopf. „Eine Tüte Chips und Bier reichen. Komm jetzt. Hol endlich das Sixpack und bleib nicht vor jedem Regal stehen.“ Leicht ungehalten, weil ich das Gefühl habe, mit einer Horde Kleinkinder unterwegs zu sein, von denen zwei nörgelnd vor der Tür warten, steuere ich die Kasse an.
Der Typ dahinter ist ein älterer Herr mit schütterem Haar und gräulichem Schnauzbart. Er hat eine seiner buschigen Augenbrauen angehoben und mustert mich argwöhnisch.
Die Frischkuchenauslage neben der Kasse zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Wenn Kuchen, dann richtigen und nicht so einen Fertigfraß.
Hinter mir höre ich Will, der eigentlich William heißt, summend auf mich zu schlendern. „Könnten Sie uns noch vier Stücke Sahnetorte einpacken?“
Der Mann stützt sich mit ausgebreiteten Armen auf dem Tresen ab und lehnt sich argwöhnisch vor. „Habt ihr auch vor, das zu bezahlen?“
„Was denken Sie denn?“, ahme ich gespielt empört meine Mutter nach, was den Kerl sofort aufhorchen und das Gesicht verziehen lässt. Auch wenn Bernadette Taylor ein echter Drache sein kann, habe ich mir von meiner Mutter schon sehr früh vieles abgeschaut, das mir heute von Nutzen ist.
Mit irritiertem Gesicht packt der Tankwart den Kuchen auf eine Pappunterlage und wickelt ihn in laut knisterndes Papier ein. „Sonst noch was?“, fragt er, als er auf die Kasse zuhält und den Kuchen auf dem Brett für das Wechselgeld ablegt.
Will legt das Sixpack und die Chipstüte dazu. Dann greift er nach einer aktuellen Ausgabe des Playboys und grinst schief.
„Ist das dein Ernst?“, bemerke ich augenrollend und presse die Lippen aufeinander.
Der Mann scannt die Artikel ab, woraufhin sich laut klirrend die Kasse öffnet. „Macht fünfzehn Dollar und achtzig Cent.“
Aus meiner Jeans, die ich zu dem übergroßen Hoodie trage, ziehe ich mein Portemonnaie hervor und suche nach der kleinsten Note, die ich ausmachen kann. Leider finde ich lediglich einen Einhundertdollarschein. Mir ist durchaus bewusst, dass es riskant ist, mit so viel Geld herumzulaufen. Meine Eltern schieben mir immer wieder Geld zu, obwohl ich in der Firma genug Eigenes verdiene. Ich bin dadurch wohl der bestverdienende Creative Director weit und breit – wenn das meine Mitarbeiter wüssten.
„Geht das auch kleiner?“, fragt der Tankwart stirnrunzelnd, als ich die Banknote auf die Wechselgeldablage lege.
„Nein, tut mir leid. Ich habe es nicht kleiner.“
Mürrisch nimmt er den Schein entgegen und schiebt ihn skeptisch dreinschauend durch das Geldprüfgerät. Nachgiebig brummend sortiert er den Schein schließlich in das dafür vorgesehene Fach in der Kasse und gibt das Wechselgeld aus. Hat er wirklich angenommen, ich würde ihn mit Falschgeld betrügen?
Als ich das Rückgeld einstecke, torkelt Will auf die elektronische Glastür zu, die sich zu langsam öffnet, sodass er dagegen prallt.
„O Mann“, entweicht es dem Tankwart, als er kopfschüttelnd zu Will schaut.
Dieser reibt sich verlegen die Stirn und taumelt dann aus dem Laden. In der einen Hand hält er das Sixpack und in der anderen die Chips. Beinahe hätte er mit seinen schwingenden Armen auch noch den Zeitungsständer umgeworfen, der nun bedrohlich wackelt, aber zum Glück doch noch stehenbleibt.
Augenrollend sehe ich ihm hinterher und greife mir den Kuchen. „Wiedersehen“, sage ich knapp und eile Will nach, bevor er draußen noch Unsinn anstellt oder vor ein Auto läuft.
Dieser hat schon die Straße passiert und steht neben Brad und Zack, die an einer Leitplanke auf der anderen Seite stehen.
Die drei, die wie die Hühner auf der Stange wirken, bringen mich zum Schmunzeln. „Meine Herren, ich habe Kuchen mitgebracht!“, rufe ich und flaniere zu ihnen hinüber.
„Aber Gabeln haben wir vergessen“, bemerkt Will.
Lachend hebt Zack die Hand und formt sie zu einer Kelle. „Wir haben doch Besteck dabei.“ Feixend zwinkert er Will zu.
Ungläubig schlage ich mir die freie Hand gegen die Stirn. Meint er das ernst? Ich bin zwar froh, dass er sich nun wieder einigermaßen gefangen hat, aber die Richtung, in die seine Laune jetzt umschlägt gefällt mir auch nicht. „Zack, wie alt bist du? Fünf?“
„Du alte Sau“, gibt Will an Zack zurück. „Aber den essen wir nicht hier auf der Straße. Lasst uns irgendwo hinsetzen.“
Mir platscht etwas Nasses auf den Kopf. Hat mich ein Vogel angeschissen? Irritiert blicke ich in den Himmel. Dieser ist nicht mehr sternenklar, sondern von dunklen Quellwolken behangen. Ich strecke den Arm aus und halte wartend die Handfläche nach oben. Einen Augenblick später haben sich drei Regentropfen darauf gesammelt. „Männer, lasst uns lieber irgendwo unterstellen.“
„Und wo? Hier ist doch weit und breit nichts“, lallt Brad.
Suchend blicke ich mich um. Wir befinden uns abseits der Stadt in Küstennähe. In der Umgebung ist zwar ein alter Industriekomplex, aber bis wir da sind, sind wir unter Garantie klitschnass. Ein dunkles Gebäude in ungefähr einhundert Meter Entfernung zieht schließlich meine Aufmerksamkeit auf sich. Ocean Discovery Centre steht auf einer großen Werbetafel unweit daneben.
Sofort zeigt Zack mit dem Finger darauf. „Lasst es uns dort versuchen.“
„Ocean Discovery Centre? Können wir nicht woanders hin? Da arbeitet Isabelle“, bemerke ich und presse die Lippen aufeinander.
„Umso besser“, meint Zack. „Dann kannst du der Kleinen einen Denkzettel verpassen, weil sie dich damals abserviert hat.“
„Das ist doch schon ewig her. Außerdem hat sie inzwischen Ethan geheiratet. Die Sache liegt längst bei den Akten.“
„Ach was. Und warum hast du dann gerade so merkwürdig reagiert? Gib es zu – du bist immer noch gekränkt. Ist ja auch verständlich. Serviert dich ab und zeckt sich in die Familie ein. Du musst ihr das heimzahlen. Das nennt man ausgleichende Gerechtigkeit und so.“ Die Argumentationskette eines Betrunkenen ist wirklich nicht zu unterschätzen.
Ich schüttele resigniert den Kopf. Manchmal ist es wirklich erschreckend, wie rachsüchtig dieser Mensch sein kann. Dennoch hat er seine guten Seiten – sonst wäre er nicht mein Freund. Mit ihm an der Seite, hat man keine Feinde mehr.
Dicke Tropfen platschen Zack ins Gesicht. „Jetzt komm, ich will hier keine Wurzeln schlagen! Wir schauen erst mal, ob wir uns da unterstellen können.“
“Na schön“, antworte ich und stecke den verpackten Kuchen schützend unter meinen Hoodie.
Die Jungs nehmen die Beine in die Hände und sprinten los. Lächelnd sehe ich ihnen nach und muss kurz darauf loslachen, weil sie in Schlangenlinien voran stolpern.
Kühler Wind weht mir um die Nase und lässt meinen benebelten Verstand aufklaren. Als weitere Tropfen auf mich herunterplatschen, jogge auch ich los.
Zwei Minuten später erreiche ich das Ocean Discovery Centre und sehe die drei Deppen schon über einen der hinteren Zäune klettern. Nach Unterstellen sieht das nicht aus. Ich lege die Hände wie einen Trichter an den Mund. „Was zur Hölle macht ihr da? Seid ihr denn eigentlich völlig bescheuert?“, rufe ich, aber es folgt keine Antwort. Ein gefrustetes Seufzen entgleitet mir, denn der Abend droht gerade genauso aus dem Ruder zu laufen, wie befürchtet. Schnell haste ich ihnen hinterher, um sie von weiteren Dummheiten abzuhalten, doch sie sind bereits über den Zaun geklettert und rennen auf eines der Außenbecken hinter einer kleinen Zuschauertribüne zu.
Kopfschüttelnd und fluchend steigere ich das Tempo, um sie einzuholen. „Lasst den Unsinn! Hier sind überall Kameras!“
„Das denkst aber auch nur du“, ruft Will und schiebt sich an Zack und Brad vorbei und verschwindet hinter einer Ecke.
Wie meint er das? Ist hier etwa nichts überwacht? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. In Melbourne wäre das ein Ding der Unmöglichkeit. Ich erreiche die Ecke und mache direkt dahinter eine Vollbremsung, denn dort ist eine Treppe, die nach unten führt.
Ein Schild an der Wand weist auf das Bassin der Robben hin, die man, wenn man der Treppe folgt, unter Wasser beobachten kann.
In der Mitte von dieser sitzen zwei der drei Vollidioten, die ich an guten Tagen meine besten Freunde nenne, und grinsen mich an. Heute allerdings schäme ich mich für sie. Denn sie sind leider das Paradebeispiel von noch lange nicht erwachsenen und ziemlich verzogenen Rich-Kids. Sie gehören zu dem Schlag, der meint, dass man mit Geld alles regeln kann und kennen somit keine Grenzen. Trotzdem waren sie in der Vergangenheit immer mein Tor zu einer gewissen Art von Normalität. Eine, die nicht von ständigem Erfolgsdruck geprägt ist, wie das in meiner Welt der Fall ist. Deshalb habe ich oft Nachsehen mit ihnen, denn im Grunde sind sie ganz okay.
Zack ist wieder seiner melancholischen Phase verfallen, denn ich höre ihn erneut Too Lost In You singen. Vielleicht war das ihr gemeinsamer Song. Er ist um eine Ecke verschwunden.
Mit einer unguten Vorahnung trete ich näher, denn sein Gesang wird von einem Sprühgeräusch untermalt. Bitte nicht.
Will schiebt sich an mir vorbei und bricht in schallendes Gelächter aus.
Zack hat offensichtlich doch wieder eine seiner Spraydosen in seinem Rucksack mitgeschmuggelt. Neben ihm liegt der Playboy von der Tankstelle auf dem Boden. Eine Fotostrecke eines berühmten Nacktmodels ist aufgeschlagen. „Die ist tausendmal schöner, als Sabrina“, nuschelt Zack vor sich hin und überträgt die Kurven der Dame auf das Glas des Bassins.
„Woah! Was für riesen Möpse!“, grunzt Will.
Ich schlage mir mit der Hand vor die Stirn. „Zack, hör auf mit dem Mist!“
„So, und damit es dir auch besser geht, mein Freund, schreibe ich in meinem Leichtsinn jetzt noch groß Isabelle an die Scheibe“, grunzt Zack und sprüht los.
Ich muss lachen, denn einen kleinen Denkzettel hat Isabelle wirklich verdient.
„Kuchenzeit. Komm, her mit dem geilen Scheiß“, ruft Brad von hinten lallend.
Sofort beendet Zack seine Arbeit und hält auf Brad zu.
Ich eile hinterher.
Brad hat den Blick an Will gerichtet. „Und du, du machst das Bier auf.“
Obwohl mir nicht ganz wohl bei der Sache ist, setze ich mich zu ihnen und ziehe den eingepackten Kuchen unter meinem Hoodie hervor.
Drei gierige Augenpaare starren auf die herrlich duftende, von dem Lauf ein wenig in Mitleidenschaft gezogene Sahnetorte, die ich von dem Packpapier befreie.
Wie ein ungeduldiges Kind drängt Zack die beiden anderen nach hinten und nimmt sich eines der vier Stücke der Torte.
Einen Augenblick später greifen Will und Brad zeitgleich nach den anderen Stücken. Meins bleibt ein wenig zermatscht auf der Pappunterlage liegen. Kurz darauf folgt ungeniertes Schmatzen.
„Du nicht, Noah?“, fragt Will mit vollem Mund und verschluckt sich fast, als über uns das Licht einer Taschenlampe aufleuchtet.
„Hallo? Ist hier jemand?“ Die fremde Stimme lässt uns sofort innehalten und treibt mir den Puls in die Höhe. Verdammt! Man hat uns gehört. Das musste ja so kommen. Mist.
Meine Freunde reißen schockiert die Augen auf. Erschrocken drehe ich mich in die Richtung, aus der das Licht kam, während mir der Atem stockt.
Zack, Brad und Will starren einander ungläubig an. Den hilflosen Gesichtern nach zu urteilen, weiß offenbar keiner von diesen Kindsköpfen, was zu tun ist.
Bedächtig lege ich den Zeigefinger auf die Lippen und steige die Treppe ein Stück nach oben, um zu sehen, wo der Mann hingegangen ist und eine geeignete Fluchtmöglichkeit abzuwägen. Mein Herz klopft heftig unter meinem Shirt, als ich die letzte Stufe nach oben nehme. Vorsichtig spähe ich nach links und rechts über den Gang, doch kann niemanden sehen. Wortlos winke ich die Jungs hinter mir hoch. Uns bleibt keine andere Möglichkeit, als denselben Weg zu nehmen, den wir hergekommen sind, denn von uns kennt sich niemand auf dem Gelände aus. Und sich zu verlaufen, würde bedeuten, geschnappt zu werden.
Während die Jungs hektisch die Treppe hinter mir raufstürmen, halte ich nach dem Wächter Ausschau. „Lauft zum Zaun“, weise ich Zack und Will leise, aber streng an und gebe ihnen entsprechende Handzeichen, als sie an mir vorbeitreten. Ungeduldig sehe ich zu Brad, der nur schleppend die Treppe hochkommt. Sein Alkoholpegel wird der höchste von uns allen sein. Kopfschüttelnd steige ich ein paar Stufen hinab und reiche ihm meine Hand. „Komm jetzt, du besoffener Idiot!“, zische ich und ziehe ihn zu mir.
Brad stöhnt mit verkniffenen Augen und ist ziemlich blass um die Nase.
Damit es schneller geht, lege ich seinen Arm um meine Schulter und hoffe, dass er mich nicht vollkotzen wird.
Zusammen erkämpfen wir uns den Weg nach oben und treten auf den Gang. Will und Zack sind rechts in die Dunkelheit verschwunden, also werden wir es auch tun.
„Ich kann nicht mehr laufen“, stöhnt Brad viel zu laut.
Sofort halte ich ihm den Mund zu. „Sei still! Und jetzt komm. Wer saufen und einbrechen kann, der kann auch abhauen!“, mahne ich leise und laufe, ihn weiter stützend, über den Gang in Richtung Freigehege. Ein Adrenalinstoß lässt meinen Puls in die Höhe schnellen.
Vor einem Robben-Bassin stoppt Brad und kotzt mir vor die Füße. Na super, das fehlte mir grade noch.
Hektisch blicke ich mich um, als plötzlich ein Licht aus der Ferne auftaucht.
„Stehenbleiben!“, ruft eine dunkle Gestalt mit männlicher Stimme und nähert sich uns bedrohlich schnell.
„Bradley! Mensch, heb dir den Rest für später auf! Wir sind gleich am Arsch!“ Wütend ziehe ich ihn weiter, egal ob er weiterkotzt oder nicht.
Brad hält sich die Hand vor den Mund und stolpert mehr, als dass er läuft. Es verlangt mir einiges ab, ihn zu stützen.
Vor einem Loch im Zaun warten bereits die beiden anderen Volltrottel auf uns.
„Wo bleibt ihr denn?“, fragt Zack leise und streckt den Arm nach Brad aus, den ich immer noch würgend vor mir her bugsiere.
„Hier, zieh den Penner raus! Schnell!“, zische ich verärgert und sehe nach hinten.
Die Schritte der Gestalt werden zunehmend lauter und der Schein der Taschenlampe immer größer.
„Verdammt! Jetzt macht schon“, fluche ich gereizt und muss mitansehen, wie Brad beim Durchsteigen durch den Zaun immer wieder in die Knie sackt. Bis der da durch ist, haben wir übermorgen. Daher entschließe ich mich für ein waghalsiges Ablenkungsmanöver.
„Noah, was machst du?“, höre ich Zack rufen, als ich mich umdrehe und Reißaus nehme. Ich renne so schnell mich meine Beine tragen und mache einen großen Bogen um den Wächter, der sofort von den Jungs ablässt und mir folgt.
Mein Fluchtweg führt mich über wackelige Steinplatten, die wohl nicht mehr zum gut gepflasterten Besucherbereich gehören. Gehetzt wie ein junges Reh stolpere ich in Richtung eines Bassins vor einer Zuschauertribüne.
„Bleiben Sie auf der Stelle stehen!“, brüllt der Wächter, der mir immer näherkommt.
Meine Halsschlagader sticht bereits, so ein Tempo habe ich drauf. Schnell springe ich auf die Tribüne, als mir plötzlich von gegenüber ein zweiter Wächter den Weg abschneidet.
„Verdammter Mist!“
„Sie sollen stehenbleiben! Sofort!“, ruft der erste Wächter keuchend, doch ich habe andere Pläne, als geschnappt zu werden und ein dickes Bußgeld oder eine andere Strafe zu kassieren und von meiner Familie mal wieder dafür geächtet zu werden.
Ich drehe auf dem Absatz um und laufe auf das Bassin zu. Vielleicht gelingt es mir, über den Beckenrand die andere Seite zu erreichen, die direkt neben einem Zaun endet. Über den könnte ich entkommen. Vorsichtig, aber schnell setze ich einen Fuß nach dem anderen auf den circa zwanzig Zentimeter breiten Rand des Bassins und laufe zur gegenüberliegenden Seite hinüber.
„Das ist gefährlich! Kommen Sie sofort da runter!“
Ich habe keine Ahnung, was sich in dem Becken befindet, und will es auch lieber nicht wissen. Mein Ziel ist der Zaun. Und den werde ich erreichen. Ich muss! Sonst bin ich wirklich am Arsch.
„Runter da!“, schreit der zweite Wächter, dessen Stimme sich etwas jünger anhört als die des anderen.
Wie aus einem Affekt heraus drehe ich den Kopf zur Wasseroberfläche, aus dem eine Flosse auftaucht, und bin dadurch so abgelenkt, dass ich die nasse Stelle vor mir viel zu spät entdecke. Ich verliere die Balance und gerate ins Straucheln. Auch mein verzweifelter Versuch, mit den Armen zu rudern, um das Gleichgewicht wiederzufinden, hilft mir nicht. Ich rutsche nach hinten aus und schlage mit dem Kopf auf dem Beckenrand auf. Der dumpfe Knall verwirrt meine Sinne. Alles, was ich noch um mich herum mitbekomme, sind verzerrte Rufe, bevor mich eine kalt-nasse Dunkelheit umgibt, die mir den Atem raubt. Game Over, Noah Taylor.
Kapitel 2
Lily
Portsea
Das lodernde Rot des Sonnenaufgangs ängstigt mich und ist bei Weitem nicht so angenehm wie sich die warmen Strahlen auf meiner Haut anfühlen. Ich hasse diese Farben. Sie erinnern mich an schlimme Zeiten, die zwar in der Vergangenheit liegen, für mich aber tagtäglich noch präsent sind. Ich trete kräftiger in die Pedale, um mich abzulenken und lasse mir den Fahrtwind durch das Gesicht wehen, als ich mit dem Rad über die Back Beach Road in Richtung Ocean Discovery Centre fahre. Jede Woche ist bereits komplett durchgeplant. Morgens stehe ich in aller Herrgottsfrühe auf und schwinge mich auf das Fahrrad, um noch vor Arbeitsbeginn meinen Hund Valon etwas auspowern zu können und ein bisschen Zeit mit Tinkerbell zu verbringen. An zwei Nachmittagen die Woche betreue ich den Bingo-Abend für die ortsansässigen Senioren in einem Wohnheim und wenn ich nicht mit meiner Schulfreundin Sarah beim Badminton bin, verbringe ich die Abende mit meinem Vater und Lesen. Viele Romane aber auch Sachbücher über Meereskunde. Manche würden mich als Streberin bezeichnen – ich nenne es Ehrgeiz. Ich möchte etwas aus meinem Leben machen, denn durch den frühen Tod meiner Mutter weiß ich nur allzu gut, wie kostbar es ist. Die meisten jungen Leute in meinem Alter verbringen ihre Freizeit mit Partys, trinken Alkohol und lassen sich gehen. Manche von ihnen wissen nicht einmal, was sie beruflich machen wollen. Aber ich nicht. Ich habe Meeresbiologie studiert und danach im ODC ein Praktikum gemacht. Aus zwei Wochen wurde ein halbes Jahr und daraus ein unbefristeter Arbeitsvertrag als Tierpflegerin. Ich kann mir keinen schöneren Ort zum Arbeiten vorstellen. Vor allem nicht, seit Tinkerbell da ist. Für mich ist die junge Delfindame mehr als nur ein Tier, um das ich mich im ODC kümmere, denn ich habe eine Patenschaft für sie übernommen und so ist sie für mich, ebenso wie Valon, eine Art Familienmitglied geworden. Aber auch die Pflege der anderen Tiere und die Vorbereitung unserer Shows bereitet mir viel Freude. Mein Chef, John, hat schon mehrfach betont, dass ich das Zeug zur Tiertrainerin hätte und Shows geben könnte. Aber das ist nichts für mich. Bingo-Abende mit mir lang vertrauten Rentnern zu betreuen, ist für mich okay, aber mit Tieren vor einem wildfremden Publikum? Nein, dazu fehlt mir der Mut.
Ich ziehe die Gurte meines Rucksacks nach, rutsche auf dem Sattel nach hinten und breite die Arme aus. Dieses Gefühl von Freiheit und die frische Seeluft versetzen mich in tiefe Entspannung. Auch wenn Montag ist und viele Menschen diesen Wochentag eher mit Selbstmitleid antreten, so bin ich immer voller Elan. Wie immer eigentlich. Elan ist mein zweiter Vorname, scherzt John gerne.
Das ODC gerät in mein Sichtfeld. Ich trete unablässig in die Pedale und genieße die salzige Meeresluft, die mich umgibt. Mein Samojede, Valon, begleitet mich zur Arbeit und sprintet freudig neben mir her. Es gibt einen Grund, warum ich mit dem Rad, und nicht mit dem vollgestopften Bus fahre. Ich fühle mich unter vielen Menschen nicht wohl und bin lieber für mich allein oder verbringe Zeit mit Valon. Gut, dass es für John okay ist, dass ich Valon mitnehme. Wahrscheinlich auch nur, weil er so kuschelig aussieht und seinen Jagdtrieb außergewöhnlich gut unter Kontrolle hat.
Gedanklich bin ich schon bei Tinkerbell, sehe nur sie, Valon und mich allein, als mir einfällt, dass Isabelle heute ebenfalls bei ihr ist. Isabelle macht seit ein paar Wochen ein Praktikum bei uns. Wie ich gehört habe, kommt sie aus Deutschland. Sie hat Biologie studiert und möchte jetzt Tierärztin werden. Vor dem Praktikum im ODC hat sie in der Vihaze-Tierrettung gearbeitet. Ein spannender Job. Ich jedoch ziehe Meerestiere den Säugetieren oder Reptilien vor – den Menschen sowieso.
Eigentlich ist Isabelle ganz nett, aber ich habe sie schon öfter in Begleitung eines ziemlich wohlhabend anmutenden Anzugtypen gesehen. Einmal sogar in ihrer Freizeit in einem ziemlich teuren Kleid. Ich glaube, der Typ war ihr Freund. Finanziell scheinen sie in einer ganz anderen Liga zu spielen, sodass ich mich frage, warum sie überhaupt hier arbeitet. Offenbar hat Isabelle es ja nicht nötig. Sie und ihr Freund wirkten nicht, als ob ich in ihre Welt passe. Daher halte ich den Kontakt zu Isabelle so begrenzt wie möglich, um mich vor einer demütigenden Enttäuschung zu bewahren. Ich hoffe, sie nimmt mir das nicht übel, wenn ich nicht jedes Mal auf ihre Versuche eingehe, mich in ein Gespräch zu verwickeln. Was mir allerdings an ihr gefällt, ist ihr Wissensschatz über Tiere. Von John habe ich erfahren, dass sie in ein paar Monaten wieder weg ist, um woanders Berufserfahrung zu sammeln. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut oder schade finde. Denn irgendwie mag ich sie. Zumindest in ihrer Rolle als Kollegin, ohne den ganzen Gucci und Versace-Kram. Ich wette, ihr Kerl kleidet sie ein.
Vor meinem Ziel drossele ich das Tempo und komme neben den Fahrradcontainern zum Stehen. Valon weicht mir nicht von der Seite und wartet gehorsam auf dem Gehweg, bis ich das Rad in einen der Container geschoben und abgeschlossen habe. Ich werfe den Schlüssel in meinen Rucksack und sehe dabei flüchtig, dass mein Smartphone aufleuchtet. „Bestimmt wieder Dad“, murmele ich augenrollend in mich hinein. Dabei weiß ich genau, dass er es nur gut meint und mir bestimmt nur einen tollen Tag wünschen möchte.
Nachgiebig brummend öffne ich den Nachrichtenverlauf mit Dad und lese seine Nachricht.
Ich wünsche dir einen schönen Tag, mein Schatz. Vielleicht schaffst du es ja doch, heute nach der Arbeit auf eine Pizza oder ein Sandwich mit mir ins Diner zu gehen. Würde mich freuen. Hab dich lieb. Dad.
Laut seufzend antworte ich.
Mal sehen. Hab dich lieb. Muss jetzt arbeiten.
Ich weiß noch nicht, ob ich hingehe. Erst mal schauen, wie der Tag wird. „Komm, Valon“, fordere ich meinen Samojeden-Rüden auf und trete durch den Eingang, denn ich will schnell zu Tinkerbell. Kurz dahinter drossele ich allerdings das Tempo als ich zwei Polizisten sehe. Offenbar brechen die beiden Beamten gerade auf und nicken meinem Boss John Wilk, dem Inhaber des Centers, zu.
Dieser sieht ihnen mit besorgtem Gesicht nach.
Wahrscheinlich wurde mal wieder ein Fehlalarm ausgelöst. Das passiert öfter. Dann rückt jedes Mal die Polizei aus. Trotz meiner Neugierde spreche ich John nicht darauf an, sondern grüße nur flüchtig und gehe an ihm vorbei. „Guten Morgen, John.“
„Morgen“, entgegnet er nachdenklich und reibt sich über den Hinterkopf. „Ach, Lily?!“, ruft er mir unvermittelt hinterher und an seinem Unterton höre ich heraus, dass mir das, was er sagen will, nicht gefallen wird.
Unvermittelt bleibe ich stehen und sehe zu ihm herüber. „Heute Nacht wurde hier eingebrochen.“ John rauft sich das lichte, graue Haar und reibt sich die trüb-blauen Augen. Er sieht aus, als hätte er nicht viel geschlafen, denn die sonst so frische und sonnengebräunte Haut wirkt fahl und weist dunkle Schatten unter den Augen auf.
Damit habe ich nicht gerechnet. „Oh nein, John. Das ist ja schrecklich! Wurde etwas gestohlen?“
„Nein, das nicht.“ Mein Boss steckt die Hände in die Taschen seiner Jeans, über der er ein Shirt mit dem Logo des ODC trägt. „Eine Gruppe junger Erwachsener hat sich wohl einen Spaß erlaubt und ist hier eingestiegen. Es wurde nichts geklaut, aber scheinbar hat sich ein Graffiti-Künstler ziemlich ausgelebt. Und ein anderer von ihnen ist auf dem Beckenrand von Tinkerbells Bassin ausgerutscht und hat sich verletzt. Die Anderen sind entkommen.“
Entsetzt reiße ich die Augen auf und meine Knie drohen nachzugeben. Am meisten schockiert mich, dass mein Delfinmädchen einen riesen Schreck erlitten haben muss.
„Der Kleinen geht es gut“, beruhigt John mich, weil er mir meine Sorge offenbar ansehen kann und runzelt die Stirn. „Den Einbrecher, der an Tinkerbells Beckenrand gestürzt ist, hat es übel erwischt. Gerade wird er im Krankenhaus behandelt. Er stand wohl unter Alkoholeinfluss. Auch wenn es wohl eine Art dummer Jungenstreich war – von einer Anzeige absehen, kann ich trotzdem nicht.“
Beiläufig nicke ich nur und möchte am liebsten sofort losrennen, um nachzusehen, wie es meinem Patenkind geht. Ich finde es richtig, dass John diesen Schwachmaten anzeigt. Was fällt dem Idioten ein, die Tiere so zu erschrecken?! „Ich schau dann mal nach Tinkerbell, John.“
Als mein Chef mich mit einem „Mach das“ aus dem Gespräch entlässt, jogge ich, dicht gefolgt von Valon, in Richtung des Bassins.
Kurz davor bleibe ich stehen. Im Park ist es ungewöhnlich ruhig, als stünde alles um mich herum noch unter Schock. Auch mir läuft es eiskalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, dass sich Fremde unbefugten Zutritt verschafft haben. Was alles hätte passieren können … nicht auszudenken.
Als ich mich genauer umsehe, sind von außen keine Spuren eines Einbruchs zu erkennen. Lediglich auf dem Fußweg liegen verstreute Krümel, weißes Geschmiere, das nach einem Lebensmittel aussieht, ein Pappuntersetzer und ein paar Bierdosen, die teils geöffnet sind. „Was ist das denn?“, murmele ich irritiert und renne auf das Becken zu. Doch als ich bemerke, dass Valon mir nicht folgt, drehe ich mich herum. „Valon! Ich fasse es ja nicht! Aus! Pfui!“, rufe ich der treulosen Tomate zu, die sich an den Essensresten bedient. Da er fast alles verputzt hat, laufe ich weiter. Er wird schon nachkommen. Besorgt renne ich auf das Bassin zu und stecke meine Hand ins Wasser. Die Wasseroberfläche glitzert im Sonnenlicht. Normalerweise begrüßt mich mein Delfinmädchen mit einem Zweimetersprung, doch heute nicht. Das gefällt mir nicht. Ich lehne mich an das Becken und strecke meinen Arm aus, dabei begleitet mich das kräftige Pochen meiner Halsschlagader. Mit einem Plätschern meiner Hand versuche ich sie anzulocken, doch sie kommt nicht. Allerdings sehe ich ihren Schatten ruhig auf einer Stelle schwimmen. Oh nein.
Tinkerbell wirkt wie vor einem Jahr, als sie zu uns kam. Sie war erst acht Monate alt und wurde von unserem Team aus einem maroden Fischernetz befreit, das herrenlos im Meer trieb. Ihr Zustand war kritisch, denn Tinkerbells Verletzungen waren nicht unerheblich. Über Monate ist sie von mir fürsorglich wieder aufgepäppelt worden. Inzwischen geht es ihr richtig gut, obwohl sich eine der Wunden immer wieder von neuem entzündet. Aber ich bin mir sicher, dass wir das noch in den Griff bekommen. Schließlich genießt sie durch meine Pflege die bestmögliche Versorgung. Durch die viele Zeit, die ich mit ihr verbracht und ihr Vertrauen gewonnen habe, habe ich mich schließlich dazu entschlossen, die Patenschaft zu übernehmen. Irgendwie fühle ich mich für sie verantwortlich. Sie war von Anfang an mein Mädchen. Und das wollte ich gern verschriftlichen. Außerdem ist sie, abgesehen von meinem Hund Valon, das einzige Wesen, das ich gern in meiner Nähe habe. Natürlich auch mein Dad, Sarah und die Senioren aus dem Wohnheim auch, aber am liebsten sind mir die beiden, da ich ihnen uneingeschränkt vertrauen kann Außerdem hat Sarah nicht mehr so viel Zeit für mich. Seit ein paar Wochen hat sie einen neuen Freund und leider kaum noch Zeit für mich. Einerseits verstehe ich das und ich freue mich ja auch für sie, aber gleichzeitig stimmt es mich traurig, weil ich sie sehr vermisse. Meine letzte Beziehung mit einem Volleyballspieler ist schon ein paar Jahre her und war eher eine Sommeraffäre, als etwas mit ernsten Absichten. Zumindest von seiner Seite.
„Der Tierarzt hat ihr etwas zur Beruhigung gegeben“, höre ich die Stimme von Isabelle hinter mir und fahre erschrocken herum.
„War es so schlimm?“, frage ich besorgt.
Isabelle geht auf mich zu und stellt sich neben mich. „Sie war sehr aufgebracht. Du weißt ja, traumatisierte Tiere geraten bei unvorhergesehenen Ereignissen schnell aus der Fassung.“
So, wie traumatisierte Menschen … wie ich. Beklemmung steigt in mir auf und versucht mir die Luft zu nehmen. Scharf atme ich ein und versuche, nicht in Panik zu geraten. Ich kenne das leider schon. Sie sucht mich immer wieder mal heim – die Panik.
„Alles in Ordnung?“ Isabelle streichelt mir mit der Hand über den Arm.
Ich zucke zusammen und weiche zurück. „Es geht schon wieder.“
Valon stürmt auf mich zu und stellt sich an mir auf. Mit der Schnauze tippt er mich an, um mich ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Das kann er gut und er merkt sofort, wenn ich ihn brauche. Diese posttraumatische Belastungsstörung werde ich wohl nie loswerden. Zumindest nicht, wenn ich nicht endlich daran arbeite. Dazu müsste ich meine Bedürfnisse jedoch endlich mal über die der Anderen stellen. Bisher war es immer umgekehrt: Ich habe mich eher mit den Sorgen meiner Mitmenschen und -tiere beschäftigt, um nicht auf meine eigenen Probleme schauen zu müssen.
„Tinkerbell ist in ein paar Stunden wieder ganz die Alte“, versucht Isabelle mich aufzumuntern und sieht aus, als wüsste sie genau, was in mir vorgeht. Sie kneift prüfend die Augen zusammen und bedenkt mich mit einem sanften Lächeln. „Noah ist manchmal ein Trottel, aber ganz bestimmt kein böser Mensch. Er wollte sie nicht erschrecken.“
Sofort durchzuckt mich ein Adrenalinstoß. „Noah?“
„Ja, der Kerl, der hier ausgerutscht ist. Seine Gehirnerschütterung hat ihn hoffentlich gelehrt, nie wieder so einen Mist zu machen.“
Eine Gehirnerschütterung ist noch viel zu wenig Bestrafung. „Du kennst ihn?“
„„Er ist der Bruder meines Mannes Ethan, du hast ihn bestimmt schon mal gesehen als er mich abgeholt hat. Nun ja, jedenfalls kenne ich Noah ein wenig und er ist eigentlich ganz in Ordnung. Er hat einfach nur die falschen Freunde, zumindest sieht Ethan das so. Vielleicht ist er aber auch noch verärgert, weil ich ihm damals einen Korb gegeben habe, zumindest würde das das Graffiti mit am Robbenbassin erklären. Seine Mutter sagt auch immer –“ Sie stoppt abrupt als sie merkt, dass sie ins Plappern geraten ist. „Entschuldige, ich drifte ab.“ Sie lächelt verlegen. „Der Typ ist ganz in Ordnung? Einbrechen, Tiere zu Tode erschrecken und Vandalismus … Das macht doch kein normaler Mensch, der in Ordnung ist“, wiederhole ich pikiert Isabelles Aussage und wende mich von ihr ab. Wenn Isabelle solche Menschen in Ordnung findet, fehlt wohl doch jegliche Grundlage für eine Freundschaft unter Kollegen. Gut, dass ich ohnehin nicht vorhatte, mich mit ihr anzufreunden. „Endschuldige, aber ich muss jetzt arbeiten.“
„Kein Problem. Bis später, ja?“, fragt sie und sieht mich verunsichert an.
Ganz bestimmt nicht. Mir ist heute ganz und gar nicht nach Gesellschaft. Und schon gar nicht, nachdem ich jetzt deine Einstellung zu solchen Typen kenne. Ich sehe ihr nach, wie sie auf die Robbengehege zusteuert. Betrübt stelle ich mich an den Rand des Beckens und blicke zu meinem Delfinmädchen. „Dieser Noah ist ja wohl das Allerletzte! Keine Angst, meine Kleine. Dir geht es bald wieder gut.“ Und mir hoffentlich auch.