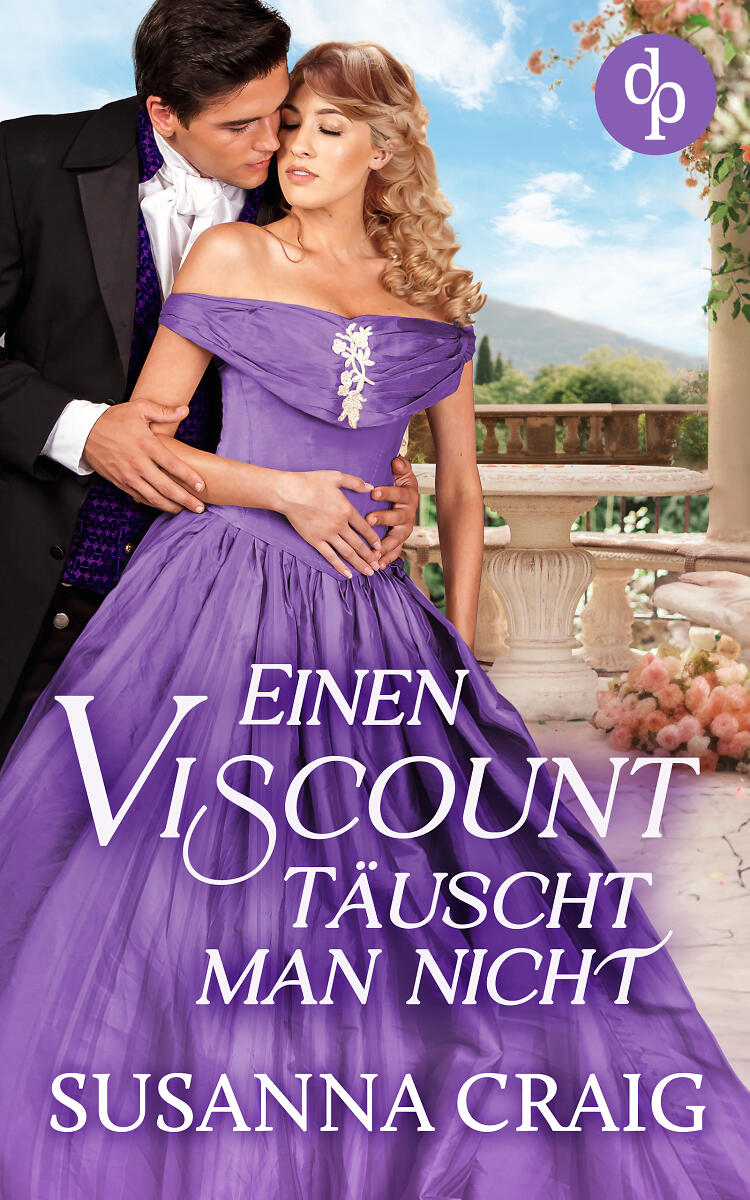Prolog
Lady Sterling war aus der Dunkelheit geboren worden. Nicht aus der Dunkelheit der Nacht, obwohl viel von ihrer Arbeit zwischen Abenddämmerung und Morgengrauen getan wurde. Nein, ihr Name war in den dunklen Seelen von Männern entstanden – Männern, deren Machtgier über das Streben nach Königreichen und Kronen hinausging, über Länder und Titel, sogar über Handel und Politik bis in die trostlosen Dachkammern und Keller ihrer Dienerschaft. Oft waren es noch junge Mädchen, deren Bitten auf taube Ohren stießen und deren Ablehnung überhaupt nichts bedeutete.
Um all dieser unschuldigen Opfer willen ließ Lady Sterling sich als Diebin brandmarken.
Heute Abend war Vauxhall Gardens ihr Jagdrevier. Papierlaternen tanzten träge in der Brise und darunter schlenderten lächelnde Paare vorbei, sich ereifernde junge Männer, sogar Familien.
Die warme Luft war schwer vom Bewusstsein, dass die Freuden des Sommers bald ein Ende haben würden. Aus der Ferne hörte sie Musik und Leute, die sich beim Abendessen – hauchdünnem Schinken – angeregt unterhielten. Aber ihr Blick fiel auf die unbeleuchteten Alleen, in denen andere Gelüste befriedigt werden konnten. Am Rand einer Gruppe von Herren stand Lord Penhurst, bereit, sich von der Herde abzusondern. Lady Sterling schminkte sich ein verführerisches Lächeln auf, zog ihr Mieder ein kleines Stück tiefer und machte sich auf den Weg. Es war schwierig gewesen, in seine Nähe zu gelangen, denn er bevorzugte die heiligen Hallen und Bälle der oberen Zehntausend. Dort versuchte er, sich eine reiche Frau zu angeln, und Lady Sterling hatte gar keinen Zutritt. Fast bedauerte sie den Erfolg, dass sie ihn hier heute Abend angetroffen hatte. Sie hatte die Herausforderung genossen, die Jagd. Aber sie musste an Betty denken, die ihren dicken Bauch bald nicht mehr verbergen konnte und die dank Penhursts Zügellosigkeit ihre Arbeit und das Dach über ihrem Kopf verloren hatte. Nun, wer tanzte, musste die Musik bezahlen, wie es in der alten Redensart hieß. Und heute Abend wollte sie dem Baron die Rechnung präsentieren. Sie wusste genau, in welchem Moment er sie sah – oder jedenfalls ihren Ausschnitt. Sie verlangsamte ihre Schritte, um sich besser in den Hüften wiegen zu können. Er würde auf ihre stumme Aufforderung reagieren. Daran hatte sie keinen Zweifel. Die Frage war nur, ob er allein kommen würde.
„Ich glaube“, säuselte einer der Männer – nicht Penhurst –, „der Vogel ist zum Abschuss freigegeben.“
Ein Schauer der Unsicherheit überlief sie, doch sie verbarg es, indem sie den Kopf abwandte. So hatte man eine gute Sicht auf ihren schmalen Nacken und die feuerrote Seide ihres Kleides schimmerte. Sie warf einen Blick zurück, sah Penhurst herausfordernd in die Augen und senkte dann die Wimpern.
„Ja“, sagte der Baron gierig. „Man sieht nur selten eine so füllige Brust und so einen schönen Hintern.“
Die Männer waren schon alle betrunken. Wenn sie es nicht an dem unsicheren Gang gemerkt hätte, mit dem Penhurst auf sie zukam, dann hätte sie es aus den Bemerkungen geschlossen, die seine Gefährten hinter seinem Rücken machten – schmutzige Witze über Bratspieße mit Sahnesoße, die ihnen offenbar geistreich vorkamen. Mit manchen Männern wurde man leichter fertig, wenn sie betrunken waren. Andere dagegen wurden dann aggressiv. Nach dem, was Betty ihr erzählt hatte, konnte sie sich denken, welche Wirkung Alkohol auf Penhurst haben würde. Wieder überlief sie ein Schauer. Dann sagte einer von Penhursts Freunden leise zu ihm: „Im Pandämonium gibt es bessere Unterhaltung, alter Junge.“
Penhurst winkte lachend ab. Sie war sehr erleichtert und ihre Angst wie weggeblasen. Das Pandämonium war ein berüchtigtes Casino, in dem um hohe Beträge gespielt wurde, und ein Mann von Penhursts Ruf, der sein Treuegelübde brach, konnte nicht erwarten, dort auf Kredit spielen zu können. Wenn es ihm gelungen war, für heute Abend Geld zusammenzukratzen, musste er es bei sich tragen.
Natürlich würde eine prall gefüllte Brieftasche Betty nicht dafür entschädigen, was sie erlitten hatte und noch erleiden würde. Aber selbst ein magerer Geldbeutel wäre für das Mädchen besser als die Taschenuhr, auf die Lady Sterling es abgesehen hatte. Sie freute sich über die Aussicht, ihn zu ruinieren, und zuckte nicht einmal zusammen, als der Baron ihr den Arm um die Taille legte, sie den schattigen Pfad entlang zog und sein schnapsgeschwängerter Atem ihr in die Nase stieg.
„Ich habe heute Nacht noch viel vor“, sagte er. „Aber ich gebe dir ein Sixpence-Stück, wenn du mir einen bläst, mein Täubchen.“
Ihr kam die Galle hoch, doch sie schluckte sie hinunter. Sie hatte noch nie das Versprechen einlösen müssen, das Männer in ihrer Kurtisanenkleidung sahen. Heute Abend würde es nicht anders sein. Im Gegensatz zu Lord Penhurst war sie intelligent, stocknüchtern und – bewaffnet. Sie fürchtete nichts mehr als Unrecht. Sie wandte sich um, strich über seine gestärkte seidene Hemdbrust und schnappte sich geschickt seine Uhr. Sie tat so, als würde ihre ganze Aufmerksamkeit ihm gelten, doch in Wirklichkeit hatte sie nur Augen für die vielversprechende Ausbuchtung weiter unten – den Geldbeutel. Seine Freunde hätten ihm raten sollen, darauf aufzupassen. Ihre eifrigen Finger wanderten zu seiner Taille. „Ooh Gott. Mir wird schon der Mund wässrig.“ Das stimmte nicht. Dafür hatte sie Tränen in den Augen. Warum zogen Herren es vor, sich mit Kölnisch Wasser zu bespritzen, statt sich zu waschen? Sie hielt den Atem an und beugte sich näher zu ihm, hielt sich an ihm fest und zeichnete die dekorative Stickerei auf seinem Hemd nach. Wie sie erwartet hatte, war der Geldbeutel an seiner Kleidung befestigt, wahrscheinlich an einen versteckten Knopf genäht, damit er nicht so leicht von einem Taschendieb entwendet werden konnte. Trotzdem gelang es ihr, die Börse zu lockern, als sie sich fester an ihn drückte und die Arme um ihn schlang. Sie hatten gerade den Kiesweg verlassen und waren kaum außer Sichtweite der Passanten, doch seine Hände legten sich schon jetzt schwer auf ihre Schultern und drückten sie nach unten. Ihr Körper streifte an seinem entlang – gehorsam, sinnlich. Als sie sich auf Augenhöhe mit dem Bund seiner Satinhose befand, baumelte der Geldbeutel sichtbar unter dem Saum seines Jacketts.
Er packte sie am Nacken, als sie vor ihm niederkniete. „So ist es richtig. Ich sehe gern Mädchen auf den Knien.“
Das hatte Betty ihr schon erklärt. Sie kämpfte gegen den Wunsch, den Mann nicht nur finanziell bluten zu lassen, legte ihm eine Hand auf den Oberschenkel und grub ihre Fingerspitzen in seine Haut. Er keuchte und warf genüsslich den Kopf zurück. Jetzt, da er nicht hinschaute, machte sie ihren wichtigsten Schritt – sie platzierte ihre Visitenkarte dort, wo die Uhr gewesen war. Ein Risiko, aber es musste sein.
Männer – soweit sie wusste, alle, doch besonders solche wie Lord Penhurst – waren überheblich und gierig. Ihren Trieben ausgeliefert und dennoch sicher, dem sogenannten schwachen Geschlecht haushoch überlegen zu sein. Sie wollte, dass sie wussten, wer sie hereingelegt hatte, dass sie begriffen, wer ihre Geheimnisse und ihre Zukunft in der Hand hatte. Ihrem Ruf sei Dank sorgte ein Rechteck aus steifem Papier mit dem Namen „Lady Sterling“ dafür, dass ein Mann es sich gründlich überlegte, ob er weitere Opfer ins Unglück stürzte. Mit flinken Fingern schob sie die Karte in seine Westentasche und tat derweil so, als würde ihre andere Hand sich an den Knöpfen seiner Hose zu schaffen machen. Dabei ließ sie die Geldbörse aus ihrem Versteck fallen. Der kleine Lederbeutel landete auf den feuchten Blättern neben ihr, und das Klimpern der Münzen war Musik in ihren Ohren. Betty und ihr Kind würden nicht hungern müssen.
Penhurst erstarrte und seine Hand schloss sich um ihren Hinterkopf. Einen Moment lang dachte sie, auch er hätte gehört, wie sein Geldbeutel zu Boden fiel. Aber nein, seine Aufmerksamkeit war von einem anderen Geräusch gefesselt worden: Schritte. Jemand ging den Pfad entlang und kam aus der entgegengesetzten Richtung.
Genau die richtige Ablenkung. Das Glück war ihr heute Abend hold. Sie musste nicht zur Waffe greifen, um sich zu befreien. Heimlich tastete sie auf dem schmutzigen Boden nach dem kleinen Lederbeutel, bis sie ihn fand. Sie versuchte, den Kopf wegzuziehen und wollte aufstehen, doch Penhurst ließ sich nicht so leicht abschrecken. „Mach weiter“, befahl er, zerrte an ihrer Perücke und packte fester zu, sodass sie nicht in die Richtung sehen konnte, aus der das Geräusch kam. „Sie werden weitergehen, wenn sie schlau sind.“ Ein grunzendes Lachen. „Es sei denn, es sind Leute, die gern zusehen.“
Sie. Eine Gruppe von Männern vielleicht? Männer, die aus ihrer gegenwärtigen Haltung schließen konnten, dass sie nur allzu bereit war, zu … Sekundenlang fürchtete sie, sie hätte ihr Glück zu sehr herausgefordert.
Dann hörte sie eine Männerstimme sagen: „Lass uns umkehren, Julia. Wir hätten nicht diesen Weg nehmen sollen.“
Erleichterung durchflutete sie. Die Schritte waren die eines Mannes und einer Frau. Einfach ein Pärchen, das sich aus Versehen in eine der dunklen Alleen verirrt hatte – oder das jedenfalls behaupten würde, falls man es erwischen würde.
„Aber wir sind schon fast am Ende des Weges.“ Die Frau klang jung, aber nicht mehr wie ein Kind. „Sieh mal, das Licht ist viel heller dort drü… oh! O Himmel!“ In der Stimme der jungen Frau schwangen Erschrecken und gleichzeitig Neugier. Man konnte sich leicht vorstellen, wie sie den Hals reckte, um besser sehen zu können. „Was machen die Leute da im Gebüsch?“
Lady Sterling wartete die Antwort des Begleiters nicht ab. Stattdessen nutzte sie ihre Chance und schrie. Entgeistert ließ Penhurst sie los, sie rappelte sich auf, raffte ihre Röcke zusammen und hielt sie mit geballten Fäusten fest, um ihre Beute zu verbergen.
„Wie können Sie es wagen, Sir?“, rief sie. Sie eilte zurück auf den Pfad, der nicht beleuchtet und halbwegs sicher war, und achtete nicht auf die Kieselsteine, die sich in die dünnen Sohlen ihrer Schuhe bohrten. „Er hat versucht, mich zu – zu z-zwingen …“, sagte sie stammelnd zu dem Paar, rannte an den beiden vorbei und wollte im Dunkel der Nacht verschwinden. Und das hätte sie auch getan, wenn der Mann sie nicht am Arm festgehalten hätte. „Sind Sie verletzt, Ma’am?“
Sie konnte seine Gesichtszüge bei dem schlechten Licht kaum erkennen, wohl aber die Fürsorglichkeit in seiner Stimme. Wenn Männern das Schicksal der Frauen wirklich am Herzen läge, würden sie ihre Brüder davon abhalten, unschuldigen Mädchen das anzutun, was Penhurst seinem Stubenmädchen angetan hatte. „Lassen Sie mich los, Sir.“ Das Zittern in ihrer Stimme war nicht aufgesetzt. Sie hatte nur einen Augenblick Zeit, um zu entkommen. Selbst eine Schlafmütze wie Penhurst würde bald herausfinden … „He, du kleine …!“, rief der Baron. In der Hecke hinter ihr raschelte es, als er die Knöpfe befingerte, die sie geöffnet hatte. „Wir sind noch nicht fertig miteinander!“ Sie rechnete damit, dass der andere Mann bei den Worten des Barons ihren Arm noch fester umklammern würde, und begriff nicht sofort, dass er sie losgelassen hatte. Sie rührte sich nicht und er flüsterte: „Laufen Sie!“ Einen Moment lang blieb sie ungläubig und wie versteinert stehen. Ihr Blick schweifte über das Gesicht des Fremden, von dem sie nur wenig sehen konnte – den schattigen Umriss einer griechischen Nase und funkelnde Augen, deren Farbe nicht zu erkennen war. Dann griff sie nach Penhursts Taschenuhr und dem Geldbeutel und flüchtete in die Dunkelheit.
1. Kapitel
Schon bevor Captain Jeremy Addison das Büro von General Zebadiah Scott betrat, ahnte er, dass er in Schwierigkeiten war. Zu seinem Vorgesetzten gerufen zu werden, war meistens kein gutes Zeichen. Angesichts der Tatsache, dass der General großen Wert darauf legte, sein Privatleben streng von seinen militärischen Angelegenheiten zu trennen, war der Befehl, bei Scott zu Hause in der Audley Street zu erscheinen, noch unheilverkündender. So eine Anweisung ein paar Stunden vor Mittag zu bekommen, war noch schlimmer. Doch Jeremy hatte die letzten Wochen überwiegend im Untergrund verbracht, einem Netzwerk unterirdischer Büros. Es beherbergte und verdeckte die Aktivitäten einiger der besten Geheimdienstoffiziere in der britischen Armee. General Scotts Nachricht war ein willkommener Vorwand für ihn gewesen, sich die Beine zu vertreten und den Kopf freizubekommen, einem Verlies zu entkommen, in dem er an seinem eigenen Scheitern beinahe erstickt wäre. Er hatte es schon fast aufgegeben, die Chiffre in dem vermeintlichen französischen Kochbuch zu knacken. Doch sobald Jeremys Stiefel den Marmorboden des Foyers hinter sich ließen und den Plüschteppich des Büros betraten – und er Auge in Auge General Scotts fragendem Blick begegnete –, begriff er, dass es klüger gewesen wäre, sich nicht vom Fleck zu rühren.
Scott neigte zur Begrüßung den Kopf. „Sehr verbunden, Captain Addison. Ich frage mich, ob Sie schon Zeit gefunden haben, die Zeitung von heute zu lesen?“ Er wies auf die Ausgabe der Times, die auf dem ansonsten leeren Schreibtisch lag.
In seinen fast zwölf Jahren beim Militär hatte Jeremy General Scotts Büro nur zweimal von innen gesehen, als er bei den Horse Guards gewesen war. Beide Male waren Jeremy beim Anblick der wackligen Bücherstapel, Briefe und Landkarten auf dem Tisch des Mannes die Hände feucht geworden. Doch irgendwie war das hier – nicht einmal ein Löschpapier oder Tintenfass, nur eine blanke Mahagoniplatte, die beinahe unter einer einzigen Zeitungsseite verschwand – noch schlimmer. Die Offiziere in Scotts Diensten spekulierten schon lange darüber, dass der General ein erstklassiger Schauspieler sei. Die gütige, großväterliche Ausstrahlung. Der Pfeifenrauch. Die zerknitterte Kleidung, die Vergesslichkeit und sogar die Brille, die er meistens bis auf die Stirn hochgeschoben hatte – sie war meistens ohnehin so fleckig, dass sie keine Sehhilfe mehr gewesen wäre. Alles Requisiten, hieß es, für einen Auftritt, bei dem Scott penibel Regie führte.
Jeremy hatte diese Theorien immer bezweifelt. Warum sollte ein Mann in Scotts Position Theater spielen? Doch nun war das kunstvoll gemalte Bühnenbild verschwunden und das Gerüst zu sehen. Jetzt wurde ihm die schreckliche Wahrheit bewusst. Es war, als würde er zufällig einen Blick hinter die Kulissen, die Kostüme und die Schminke werfen. Aber in Wirklichkeit sah er diese Dinge nur, weil Scott ihn hinter die Bühne gebeten hatte. Und das Schauspiel würde gleich beginnen.
Unter Scotts wachsamem Blick stolperte Jeremy auf den Tisch zu – eine widerwillige zweite Besetzung, die auf die Bühne geschubst worden war. Er beugte sich über das Papier, verschränkte die Hände auf dem Rücken und atmete tief durch. Kein Hauch von Tabak hing in der Luft. Er überflog hastig die dicht bedruckte Seite und sah, was General Scotts Aufmerksamkeit erregt hatte. Die Worte sprangen Jeremy förmlich ins Gesicht:
Pandämonium! Die schlaue Lady Sterling hat wieder zugeschlagen. Diesmal hat sie verhindert, dass der sonst geizige Lord P. den Vauxhall Gardens einen Besuch abgestattet hat. Eine fette Gans, die ausgenommen wurde, bevor sie spielen konnte.
Scott hatte ihn von seiner Arbeit weggerufen, den ganzen Weg durch die Stadt, damit er eine Tratschgeschichte über einen Gentleman las, der Opfer einer Taschendiebin geworden war? Jeremy war sehr behütet aufgewachsen, doch das Leben in der Armee hatte seinen Wortschatz beträchtlich erweitert. Er war versucht, mit einem beeindruckenden Schwall von Schimpfwörtern zu antworten. Aber er begnügte sich damit, dem General einen finsteren Blick zuzuwerfen. Er wusste genau, warum Scott ihn hatte kommen lassen.
Die unverkennbaren Anzeichen eines Lächelns zuckten um Scotts Mundwinkel. „Ah. Sie haben schon von Lady Sterling gehört?“
Wer hatte das nicht? Ihr skandalöser Werdegang – ranghohe Herren zu verführen, um ihnen dann ihr Geld zu stehlen – bot den Klatschmäulern schon seit Monaten Gesprächsstoff, sowohl am oberen als auch am unteren Ende der Gesellschaft.
„Meine Schwester Julia findet die Aktivitäten dieser Frau unterhaltsam und hält mich auf dem Laufenden.“ Was, wenn sie erfuhr, dass Lady Sterling am selben Abend wie sie Vauxhall einen Besuch abgestattet hatte?
Julia hatte stundenlang aufgeregt von diesem kurzen Zusammentreffen mit einer unglücklichen jungen Frau geredet, die vor einem Schurken geflohen war. Was würde sie dazu sagen, dass sie vielleicht Lady Sterling begegnet war? Sie wäre überzeugt, dass sich ihre Wege gekreuzt haben mussten, trotz der Menschenmenge und der Größe des Parks. Sie würde ewig darüber spekulieren, ob sie die Frau in Grün oder die Frau in Blau gewesen sei. Es würde nie ein Ende haben.
Eine verräterische Röte stieg Scott in die Wangen. „Sterling. Klingt nach Erstklassigkeit und Zuverlässigkeit. Reinheit – vielleicht im Motiv, wenn auch nicht in der Methode. Ein interessanter Deckname für eine Diebin, nicht wahr?“
Jeremys Augen wurden schmal. „Ich denke, Sie haben mich nicht wegen einer Namensgleichheit kommen lassen, Sir.“
Mit einem angestrengten Schnaufen, das verdächtig nach einem Lachen klang, setzte sich Scott an seinen Schreibtisch und gab Jeremy ein Zeichen, auf dem Stuhl gegenüber Platz zu nehmen.
„Ebenso wie Ihre Schwester“, sagte Scott nach einem Moment, „verfolge ich Lady Sterlings Wirken mit Interesse. Sie greift Männer an, von denen ich sagen würde, dass sie irgendwie verwundbar sind. Männer mit Geheimnissen, die sie lieber für sich behalten würden. Geld spielt sicher eine Rolle bei ihren Taten, aber ich glaube, das ist nicht das Einzige, was sie diesen Männern nimmt.“
Jeremy wurde wider Willen neugierig. „Sie meinen, sie sammelt Informationen?“
„Ja. Informationen, die für Erpressung verwendet werden können. Vielleicht ist sie sogar schon im Besitz von Geheimnissen, die dem Erfolg des Militärs, dem König und sogar der Nation schaden können. Ich muss wissen, auf wessen Seite sie steht.“ Scott hatte seine Finger in einer nachdenklichen Pose verschränkt. Jetzt legte er die gefalteten Hände vor sich auf den Schreibtisch. Das Papier darunter raschelte leise. „Ich beauftrage Sie, sie zu finden.“
Jeremy hatte geistesabwesend genickt, als Scott erklärt hatte, warum ihn der Fall interessierte. Jetzt sprang er auf. „Mich? Aber ich … ich …“ Er hatte mit Büchern und Papier zu tun, nicht mit Menschen. Er schluckte eine unumwundene Befehlsverweigerung hinunter und fragte stattdessen: „Was soll ich mit ihr machen, falls es mir gelingt?“
„Wenn“, korrigierte Scott, nahm die Zeitung und reichte sie Jeremy, als sei eine Klatschspalte gleichbedeutend mit einem Befehl. „Und ich denke, die Antwort liegt auf der Hand, Lord Sterling.“
Jeremy konnte gerade noch verhindern, dass er erschauerte, als sein Titel genannt wurde. Niemand in der Armee sprach ihn so an. Manchmal dachte – nein, hoffte – Jeremy, dass die Männer, mit denen er arbeitete, vergessen hatten, dass er Viscount war. Wenn er doch nur selbst in diesen Zustand seliger Ahnungslosigkeit zurückkehren könnte. Mit siebzehn Jahren hatte er nicht gewusst, dass sein Vater zu einem sogenannten Kadettenzweig einer jener großen Familien mit Ländereien, Herrenhäusern, Titeln und dergleichen gehörte. Richard Addison, ein Pfarrer mit einer Vorliebe für Geschichte, hätte sich über die Entdeckung gefreut, weil er nachverfolgen konnte, wie sich die Linie seines Stammbaums mit dem Hauptzweig kreuzte. Doch er war letztes Jahr gestorben und Jeremy stand auf dem nächsten Platz der Erbfolge. Eine Zeit lang hatte Jeremy sich ausgemalt, die Leute in London, die über die Erbfolge bei Titeln entschieden, würden merken, dass sie aus Versehen zwei Seiten in ihrem zerlesenen Gotha geblättert und einen geeigneteren Erben übersprungen hatten. Sein Widerwille war nur noch größer geworden, als er herausfand, dass er nicht nur Ländereien und Herrenhäuser geerbt hatte, sondern auch einen Stapel grün eingebundener Rechnungsbücher, in denen die Zahl in der Spalte „Soll“ immer größer war als die der Spalte „Haben“.
Jeremy war sehr gut in Mathematik, organisiert und verantwortungsbewusst. Er hatte sofort begriffen, was diese Zahlen bedeuteten. Der Besitz war mit Hypotheken belastet und Lord Sterling – er – war hoch verschuldet. All seine Hoffnungen, das vermaledeite Erbe für seine Mutter und seine Schwester verwenden zu können, ihnen nicht nur jeden erdenklichen Komfort, sondern sogar Luxus zu ermöglichen, waren zerronnen. Jeremy hatte vier Tage finster vor sich hin gebrütet und sich dann seinen Plan, im nächsten Semester nach Oxford zu gehen, aus dem Kopf geschlagen. Er hatte verkauft, was er nicht brauchte, und den Rest vermietet. So hatte er gerade genug zusammengekratzt, um sich stattdessen ein Offizierspatent zu kaufen, und sich damit abgefunden, sein Studium zugunsten von Kugeln und Bajonetten an den Nagel zu hängen. Aber schließlich war General Zebadiah Scott auf ihn aufmerksam geworden, der Drahtzieher des britischen Geheimdienstes. In den letzten zehn Jahren hatte Jeremy seine Begabung für Mathematik und Wortspiele zum Knacken von Codes genutzt. Er bekämpfte Feinde aus Papier und Tinte und führte Schlachten ausschließlich mit dem Verstand.
Bis heute hatte ihm die Aufmerksamkeit des Generals keinen Ärger gemacht. Doch jetzt zuckte Jeremy zusammen, als Scott ihm das Papier in die Hand drückte und verkündete: „Ich möchte, dass Sie sie heiraten.“
Für einen Moment herrschte Stille und die beiden Männer sahen einander gleichgültig an. Doch Jeremys Herz schlug rasend schnell und pumpte ihm das Blut in die Gliedmaßen. Sein Instinkt riet ihm zur Flucht. Nach einem langen Augenblick warf er den Kopf zurück und brachte ein Lachen zustande. „Sie heiraten. Guter Witz, Sir. Fast wäre ich darauf hereingefallen.“
Scotts Grinsen wurde breiter und seine Augen funkelten nicht ganz – oder nicht nur – belustigt. „So?“ Ein Schmunzeln. „So weit reicht meine Befehlsgewalt natürlich nicht, Captain Addison. Ich muss aber gestehen“, fuhr er fort, „dass Ihr Titel mich veranlasst hat, Sie auszuwählen – die, äh, Namensgleichheit, wie Sie es nannten.“ Er hielt inne und legte den Kopf schief. „Ich brauche jemanden, der ihr nahekommt. Jemanden, der ihr Vertrauen gewinnt. Finden Sie heraus, was sie weiß – und ob sie bereit wäre, ihre außergewöhnlichen Gaben für die Krone einzusetzen.“
Als Jeremy klar wurde, worum es bei dem Auftrag ging, umklammerte er die Zeitung und zerknüllte sie so, dass sie nicht mehr lesbar war. Alles nur, weil Scott aus Lady Sterling eine Spionin machen wollte?
„Und Sie meinen, dass ich der richtige Mann dafür bin? Wäre ein Agent für diese Aufgabe nicht besser geeignet?“
Scott wusste genau, dass Jeremys Fähigkeiten auf einem anderen Gebiet lagen – genauer gesagt, bei seinen Büchern. Andererseits hatte er darum gekämpft, eine Chiffre zu entschlüsseln, für die andere ihr Leben riskiert hatten – der wichtigste Auftrag, der ihm je anvertraut worden war. Vielleicht hatte Scott den Glauben an seine Fähigkeit, Codes zu knacken, verloren. Vielleicht war dieser seltsame neue Auftrag eine Art Umschulung.
„Es wird Ihnen guttun, mehr Zeit an der frischen Luft zu verbringen, Captain Addison“, sagte der General. Das war eine schräge Anspielung auf die dunklen Räume und die geheime Arbeit des Untergrunds. „Sie sind zu blass. Außerdem kann ich keinen einzigen Agenten entbehren.“ Scott warf ihm einen vielsagenden Blick zu. „Sie laufen in beängstigend großer Zahl in den sicheren Hafen der Ehe ein.“
Jeremy war es danach, unruhig auf dem Stuhl hin und her zu rutschen. Stattdessen glättete und faltete er die Zeitung, bis sie ein ordentliches Rechteck war, nicht größer als ein Brief, und steckte sie sich in die Brusttasche. „Machen Sie sich keine Sorgen um mich, Sir“, sagte er mit einem kurzen Nicken. Es würde – es konnte – keine echte Lady Sterling geben.
Nicht, solange er lebte.
Und die, die sich Lady Sterling nannte? Die war nur eine Diebin mit Sinn für Ironie. Scotts Auftrag war eine Chance, die Frau zu enttarnen, die Spekulationen, den Klatsch und die Hänseleien seiner Schwester zu beenden. Es gab ihm einen Stich ins Herz, wie immer, wenn er daran dachte, dass er dazu verdammt war, allein zu bleiben.
„Ich fange am besten damit an, ihr letztes Opfer ausfindig zu machen. Wer ist dieser Lord P. aus der Zeitung?“
„Roderick Penhurst. Residiert in der Brook Street, in der Nähe des Hanover Square. Nach allem, was man hört, ist der Mann bankrott – und offenbar so verzweifelt, dass er das Wenige, das ihm geblieben ist, in der vergeblichen Hoffnung verspielt, seine Finanzen aufzubessern.“
Jeremy kannte Lord Penhurst nicht, aber er hatte den Namen Pandämonium erkannt. In den Straßen nahe dem Untergrund wimmelte es von Spielcasinos, einige ehrenwert, die meisten nicht. Noch vor Kurzem war er versucht gewesen, eins oder zwei zu besuchen, weil er so gut mit Zahlen umgehen konnte. Nur die Angst vor einem größeren Verlust – dem Respekt und dem Vertrauen seiner Mutter und seiner Schwester – hatte ihn zur Vernunft gebracht.
Scott öffnete die Lippen, als wäge er seine nächsten Worte sorgfältig ab. „Sie sollten auch wissen, dass Penhurst in dem Ruf steht, ein Taugenichts zu sein – und ich meine nicht die Sorte ‚umwerfender Kerl‘, die einem in den Robin-Ratliff-Romanen meiner Frau begegnet.“ Wieder eine Pause. „Nach dem, was ich über ihre Opfer weiß, macht Lady Sterling Jagd auf Räuber, vielleicht in der Absicht, diese Männer für ihre früheren Verbrechen büßen zu lassen.“
Ehrenwerte Beweggründe, aber keine ehrenwerten Methoden. „Eine Art Racheengel, meinen Sie?“ Er gab sich keine Mühe, seine Zweifel zu verbergen.
Scott nickte beharrlich. „Genau. Aber das ist nur Spekulation – und Penhurst wird sicher abstreiten, dass er irgendetwas Unrechtes getan hat. Wenn Sie mit ihm reden, müssen Sie das Thema taktvoll zur Sprache bringen. Vorsichtig. Nur Dummköpfe fallen mit der Tür ins Haus, wie es im Sprichwort heißt.“
Jeremy wäre beinahe aufgebraust. „Ich bin nicht dumm, Sir.“
„Dann wären Sie jetzt auch nicht hier“, sagte Scott und stand auf.
Jeremy fühlte sich nicht klüger als in dem Moment, in dem Scott ihn zu sich beordert hatte, aber er begriff, dass sich ihr Gespräch dem Ende neigte. „Colonel Millrose sagte, Sie würden die Stadt verlassen, Sir.“
„Ja, gleich morgen früh. Ich habe meiner Frau einen lange überfälligen Urlaub in Brighton versprochen.“
Jeremy versuchte, sich vorzustellen, wie der General mit einem Strohhut am Strand entlangschlenderte. Als das misslang, schaute er sich stattdessen in dem geräumigen Zimmer um. Holz, grüne Wände, Ledersessel, in denen man fast versank, und gut sortierte Bücherregale. Ganz anders als General Scotts Büro in Whitehall und doch ein Spiegelbild des Besitzers. Ob es ein getreues Abbild war, konnte Jeremy im Moment nicht erraten.
Als er den Untergrund verlassen hatte, war die Morgensonne beinahe schmerzhaft grell gewesen. Doch durch zwei Fenster mit Samtgardinen sah er nun dunklere Wolken am Horizont aufziehen, Vorboten des grauen Herbsthimmels und des Regens. Er hoffte, dass das schlechte Wetter dem General nicht den Urlaub verderben würde.
„Ich wünsche Ihnen und Mrs. Scott eine gute Reise“, sagte Jeremy und verbeugte sich zum Abschied tief.
„Danke, Addison – oder sollte ich Sterling sagen?“ Der Hauch eines Lächelns, das um die Mundwinkel des Mannes spielte, war selbst für einen Meister im Codeknacken nicht zu entschlüsseln. „Und ich wünsche Ihnen viel Glück, obwohl ich nicht glaube, dass Sie es brauchen.“
„Danke, Sir.“ Unwillkürlich hob er die Stimme, ein Klang von Zweifel schwang mit. Was auch immer er in diesem Moment empfand, es war keine Dankbarkeit. „Ich werde versuchen, mich Ihres Vertrauens würdig zu erweisen.“ Als er erneut das Foyer betrat, hätte er schwören können, dass er Scott hinter sich kichern hörte.
***
Die Tür von Penhurst House öffnete sich, nachdem er angeklopft hatte. Zum Vorschein kam ein Diener, der der schlaksigste in Mayfair sein musste. Er stotterte, als er sagte, dass er nachsehen müsse, ob Lord Penhurst zu Hause sei. Nach ein paar Minuten kam der junge Mann zurück, sagte Jeremy, dass Lord Penhurst ihn empfangen würde und führte ihn zu einem Büro, das ganz anders aussah als das von General Scott. Statt des üblichen Landschaftsgemäldes hing der mottenzerfressene, ausgestopfte Kopf eines riesigen Hirsches über dem Kamin. An dem brüchigen Geweih baumelte ein Kleidungsstück aus Spitze – das Strumpfband einer Dame, erkannte Jeremy und riss den Blick davon los. Der Geruch von Zigarrenrauch, Whisky und Schweiß stach ihm in die Nase. Die Vorhänge waren fest zugezogen, und es roch, als hätte seit einiger Zeit niemand mehr gewagt, ein Fenster zu öffnen. Lord Penhurst saß in der Mitte des schwach beleuchteten Raums auf einem gepolsterten Stuhl, der schon bessere Tage gesehen hatte, und beobachtete Jeremy, der sich im Zimmer umsah.
„Wer sind Sie?“, fragte er, ohne aufzustehen. In der einen Hand hielt er ein Glas aus geschliffenem Kristall.
„Captain Jeremy Addison, Mylord.“
„Verdammt.“ Mit trüben Augen musterte er Jeremys Uniform von oben bis unten. „Jetzt bin ich dran, nicht wahr?“
„Ich fürchte, ich verstehe Sie nicht, Sir“, antwortete Jeremy und verwirrte Penhurst damit noch mehr. „Ich bin hier, um ein paar Fragen darüber zu stellen, was gestern Abend in Vauxhall passiert ist.“
„Vauxhall.“ Penhurst spuckte das Wort aus und hob dann offenbar in der Absicht, den bitteren Geschmack hinunterzuspülen, das Glas an seine Lippen. Als er feststellte, dass es leer war, warf er das schwereGefäß angewidert beiseite. Jeremy sah zu, wie es auf den fleckigen Teppich fiel und unter einen Tisch rollte. „Was soll ich erzählen, das die Zeitungen noch nicht wissen? Diese Hure hat meinen Geldbeutel gestohlen und ist im Dunkel der Nacht verschwunden – und ich habe nicht einmal the spit ’n’ polish bekommen, den sie mir versprochen hatte.“
Jeremy errötete vor Verlegenheit und war dankbar für das schlechte Licht im Zimmer. „Können Sie mir irgendetwas sagen, das helfen könnte, äh, Lady Sterling zu identifizieren?“
„Die Armee des Königs ist jetzt hinter ihr her, was? Nun, ich wünsche ihnen Glück. Schade, dass ihr euch nicht früher darum gekümmert habt“, knurrte Penhurst. „Ich habe nicht viel gesehen – sie hat mich auf einem der dunklen Pfade ausgeraubt.“
Die von Büschen gesäumten Pfade ohne Laternen waren wohl nicht als Liebesnester angelegt worden, doch sie wurden als solche genutzt. Genau deshalb hatte Jeremy Julia von diesen Wegen fernhalten wollen. Doch Julia, bei der die Neugier meistens über die Klugheit siegte, hatte ihren eigenen Kopf. Wenn sie jemals herausfinden würde, dass die berüchtigte Lady Sterling nicht nur in Vauxhall gewesen war, sondern auch in einer dieser dunklen Alleen ihrem nächsten Opfer aufgelauert hatte … vielleicht in derselben dunklen Allee, in der die arme Frau Jeremy begegnet war, offensichtlich auf der Flucht vor einer schiefgegangenen Verabredung … Dieselbe? Sicherlich nicht … Nichtsdestotrotz beschleunigte sich der gleichmäßige Trab von Jeremys Puls zu einem unsicheren Galopp. Er holte tief Luft, um sich zu beruhigen, und roch die miefige Luft, die im Zimmer herrschte.
„Sie war angezogen wie ein Flittchen“, fuhr Penhurst fort. „Und sie sprach in dieser kehligen Art – Sie kennen das. Ich bekam vom bloßen Zuhören einen Steifen. Ich hatte sie im Nu auf den Knien, das können Sie sich denken. Aber ich hatte noch nicht einmal meine Hose geöffnet, da gab es in der Nähe plötzlich einen Aufruhr, und sie huschte davon. Sie stieß mit einem Kerl zusammen – ich versuchte, ihn zu rufen, aber er ließ sie los und machte sich selbst aus dem Staub, bevor ich ihn zusammenstauchen konnte, weil er mir den Abend ruiniert hatte.“
In Jeremys Kopf begann es zu pochen, im gleichen Rhythmus wie sein Herzschlag, und jedes Wort von Penhurst war ein Hieb. Die Frau im Gebüsch, die Frau, die er für einen kurzen Moment festgehalten hatte, war Lady Sterling gewesen? Die Lady Sterling? Und er hatte sie entkommen lassen?
Nein, nein, nein!
„Danach begriff ich, dass sie statt meiner, äh, Wertsachen das hier hinterlassen hatte.“ Penhurst zog eine kleine rechteckige Karte aus seiner Westentasche und hielt sie Jeremy mit zwei Fingern hin.
Jeremy beugte sich vor und nahm sie. Im Halbdunkel musste er blinzeln, um die Worte zu erkennen, die in Druckschrift darauf standen:
LADY STERLING
Kopfgeldjägerin.
Der Anblick des Namens war ihm immer unbehaglich, auch wenn er darauf gefasst war, und er überflog ihn so schnell wie möglich. Aber Kopfgeldjägerin war eben ein Blickfang – ein altmodisches Wort heutzutage in der Zeit der Bow Street Runners, Londons erster professioneller Polizeitruppe. Doch in einer Stadt, die immer größer wurde, entgingen Kriminelle oft der Festnahme, und es gab Leute, die die traditionellen Methoden der Justiz bevorzugten. Er drehte die Karte nachdenklich in den Fingern. Auf der Rückseite standen zwei Worte mit Tinte geschrieben:
Für Betty.
Bestätigte die handgeschriebene Nachricht Scotts Verdacht, dass Lady Sterling vielleicht ein anderes Ziel verfolgte, als es die Klatschblätter vermuten ließen? Kopfgeldjägerin stand auf der Karte, nicht Diebin. Die Aufschrift „Für Betty“ sprach dafür, dass sie Penhursts Geldbeutel wegen einer anderen Frau gestohlen hatte. War sie eine Art weiblicher Robin Hood? Er hielt die Karte hoch, gab sie Penhurst aber nicht zurück. „Mylord, wer ist Betty?“
Penhurst zuckte die Achseln. „Keine Ahnung.“ Doch noch während er sprach, schweifte sein Blick ab. Er log. „Ich hoffe, man wird sie für ihre Tat aufhängen!“
„Dafür“, rief ihm Jeremy in Erinnerung, „muss man sie erst einmal finden.“ Zum ersten Mal, seit er Scotts Büro verlassen hatte, verspürte er einen Funken grimmiger Vorfreude. „Ich danke Euch für Eure Unterstützung bei dem Unternehmen, Lord Penhurst.“
Er verbeugte sich schneidig, behielt die Visitenkarte, verließ das muffige Zimmer und begab sich wieder in die vergleichsweise gemütliche Eingangshalle. Dort erwartete ihn derselbe Diener; er stand so nahe an der Tür, dass er wahrscheinlich viel von dem Gespräch seines Herrn aufgeschnappt hatte. An seiner finsteren Miene erkannte Jeremy, dass dem jungen Mann missfiel, was er gehört hatte.
Jeremy deutete mit dem Kinn in Richtung Haustür, dass der Lakai sie öffnen sollte. Er hoffte, dass der Lärm der Straße ihre Unterhaltung etwas übertönen würde.
„Haben Sie vielleicht gehört, dass Ihr Herr eine Bekannte namens Betty erwähnt hat?“, fragte er leise.
„Sie war hier Stubenmädchen, Sir.“ Ein Muskel zuckte am Kiefer des jungen Mannes. „Sie hatte das Pech, dass Lord Penhurst ein Auge auf sie warf, und als sie ein Kind erwartete, warf er sie aus dem Haus. Kein Wunder, dass er behauptet, sie nicht zu kennen. Seinetwegen hätte sie verhungern können – und das Baby auch.“
„Wissen Sie, was aus ihr geworden ist?“
Der Junge sah sich schnell um und senkte die Stimme noch mehr. „Jedes angestellte Mädchen in London weiß, dass es sich an Lady Sterling wenden kann, wenn es in Schwierigkeiten ist. Die Gentlemen nennen sie eine Taschendiebin, aber sie lässt sie nur für das bezahlen, was sie Mädchen wie Betty genommen haben.“ Er hielt inne und sein Blick folgte einer Kutsche mit Wappen, die vorbeipolterte. „Natürlich gibt es Dinge, die nicht mehr gutzumachen sind.“
Jeremy dachte an die arme Betty, ein Opfer der Zügellosigkeit ihres Herrn – vielleicht war er nur einer von vielen. Er dachte an Penhursts Wunsch, dass sie gehängt werden sollte – Penhurst hatte natürlich Lady Sterling gemeint, doch ein solcher Mann würde ebenso schnell dem Dienstmädchen die Schuld an seinem gegenwärtigen Ärger geben. Er dachte auch an Penhursts vulgäres Auftreten gegenüber Lady Sterling, an seine Behauptung, er hätte sie auf die Knie gezwungen. Er erinnerte sich an die Angst in der Stimme der Frau, das Zittern in ihren Gliedern, als Jeremy sie an der Flucht gehindert hatte. Er überlegte, was passiert wäre, was Penhurst getan hätte, wenn Jeremy sie nur einen Moment länger festgehalten hätte. Plötzlich bereute er nicht mehr, dass er sie hatte entkommen lassen. Er umklammerte die Visitenkarte so fest, dass seine Knöchel weiß wurden. Sie bestahl diese Männer, aber was wurde ihr gestohlen?
„Wissen Sie, wo Betty jetzt ist?“, fragte er und atmete noch einmal scharf ein. Nicht, um sich zu beruhigen, sondern um sich zu konzentrieren. Lady Sterlings Wohlergehen war nicht sein Problem.
„Ja. Lady Sterling hat eine neue Stelle für sie gefunden – jedenfalls, bis das Baby kommt. Bei einer Mrs. Mildred Hayes in Clapham.“
„Und was ist mit den anderen Dienerinnen hier? Sind sie sicher vor …?“ Er warf einen hastigen Blick über die Schulter.
„Sie werden es bald sein.“ Jeremys Zweifel war ihm offenbar ins Gesicht geschrieben, denn der Lakai fuhr schnell fort. „Lady Penhurst will ihren Sohn aufs Land schicken. In das Witwenhaus in Cornwall mit nur einem Pagen als Diener.“
„Bettys wegen?“, fragte Jeremy, obwohl er fürchtete, dass er die Antwort schon wusste. Die arme Dienerin und nicht der Sohn des Hauses hatte den Zorn der Hausherrin abbekommen, wenn sie in einer kompromittierenden Situation erwischt worden waren.
„Weil Lady Sterling Lord Penhursts Uhr und Kette gestohlen hat“, erwiderte er mit einem rauen, freudlosen Lachen. Es galt der Herzlosigkeit, eine Uhr wichtiger zu nehmen als das Leben eines Dienstmädchens. „Familienerbstück, sagen sie. Ein Stück aus massivem Gold mit einem L auf dem Verschluss und jeder Menge Verzierungen.“
Seltsam. Penhurst hatte nichts von der Uhr gesagt, dabei klang es, als sei sie wertvoll. Und einzigartig. Etwas, das man leicht wiedererkannte, falls man sich danach umsah.
„Lady Penhurst war fassungslos, als er ihr sagte, dass die Uhr weg ist“, sagte der Diener. „Hat sich die Kehle heiser geschrien. Sagte, sie würde ihm den Kopf abreißen, wenn er aus seinem Zimmer kommen würde, es sei denn, er wolle die Reisekutsche besteigen.“ Er und Jeremy lächelten sich grimmig an. Beide wussten, dass es für die Dienerinnen in Penhurst House nur eine Verschnaufpause war. Was auch immer Lady Sterling Wertvolles stahl, es würde nie Strafe genug sein, um einen Mann wie Penhurst abzuschrecken. Es sei denn …
Geld kann ein Motiv für ihre Taten sein, aber ich glaube, sie nimmt diesen Männern noch mehr.
General Scott hatte von Geheimnissen gesprochen, von Schwachstellen – gab es einen Grund dafür, dass Penhurst nichts von der Uhr gesagt hatte? Jeremy schaute noch einmal auf die Karte und die beiden verdammten Worte: Für Betty. Die vermeintliche Taschendiebin hatte sich einige Mühe gemacht, um Penhurst daran zu erinnern, dass sie die Wahrheit über ihn wusste. Nun war es an Jeremy, die Wahrheit über sie herauszufinden. Er nickte dem Diener dankbar zu, steckte die Karte in seine Brusttasche und ging die Treppe hinunter.
„Sir?“
Jeremy warf einen Blick über die Schulter.
„Wenn Sie Betty finden, Sir, sagen Sie ihr bitte, dass Walter …“ Er hielt inne, als wolle er nicht zu viel verraten.Röte stieg ihm ins Gesicht und ließ seine Sommersprossen stärker hervortreten. „… seine besten Wünsche schickt. Sagen Sie ihr – sagen Sie ihr, dass ich immer noch gern den Spaziergang im Park machen würde, wenn sie möchte.“
Mit zusammengekniffenen Augen starrte Jeremy die Straße hinunter, auf der im Laufe des Morgens nach und nach Leben einkehrte. Würde das Mädchen überhaupt bereit sein, mit einem Fremden zu reden?
„Warum kommen Sie nicht mit? Sie können es ihr selbst sagen.“
Walter starrte ihn mit offenem Mund an. Dann warf er einen Blick zurück auf die offene Tür und die Halle dahinter, erwog seine Möglichkeiten und zuckte die Achseln. „Ja, Sir. Das ist eine gute Idee“, sagte er, nahm seine gepuderte Lockenperücke ab und stopfte sie in die Tasche seiner Livree. Die beiden machten sich auf den Weg in Richtung Westminster Bridge.