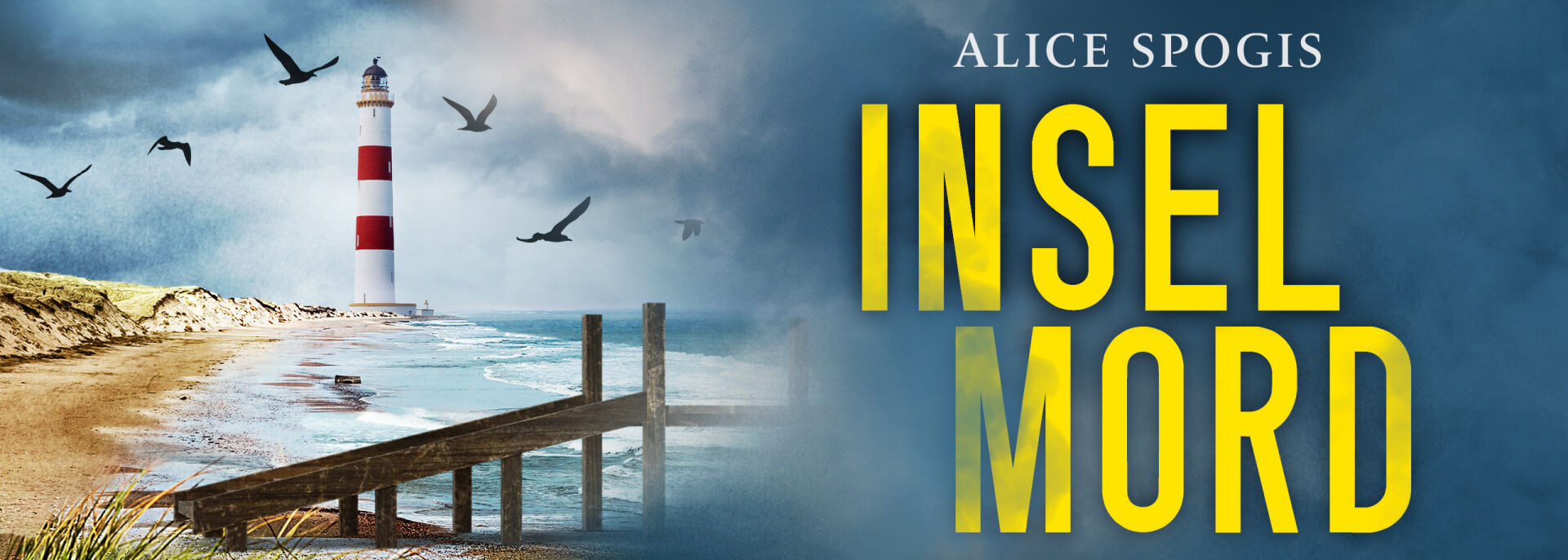1. Kapitel
Montag, 13. Juni
Intercity 2206 von Münster/Westfalen nach Norddeich/Mole
Mein Leben ist ein Acker voller Tretminen. Eine davon geht gerade hoch.
»Jemand zugestiegen?«
Grünschattierungen rauschen an mir vorbei wie ein monotoner Refrain. Felder, Hecken, Bäume. Ich nehme sie nicht wahr, erlebe sie nur als Kulisse für meine Gedanken. Alles verloren, flüstern sie. Immer wieder, einem Mantra gleich. Als wüssten sie nicht, dass ich es längst begriffen habe. Den anderen Reisenden kann ich mit dem Blick aus dem Fenster entkommen, mir selbst nicht.
Langsam wende ich mich von der Landschaft ab, durch die ich seit einer Viertelstunde hindurchstarre. Der Schaffner kämpft noch mit der Abteiltür. Sie hakt in der Mitte, und es bereitet ihm Mühe, seinen massigen Körper durch den Spalt zu zwängen. Kaum hat er es geschafft, ist mir, als schrumpften Raumvolumen und Atemluft um die Hälfte. Mein Nacken beginnt zu kribbeln. Eine leise Panik schleicht sich von dort an. Es ist das Gleiche wie mit Aufzügen. Enge will Flucht.
Seine Frage hängt noch in der Luft und löst geschäftiges Kramen in Jackentaschen und Handgepäck aus. Das reißt mich aus der Starre. Mit schweißfeuchten Fingern durchwühle ich meinen Rucksack nach dem gefalteten Papier und ertaste – nichts.
Hitze schießt mir in die Ohren. Himmel, das darf nicht wahr sein. Ich habe den Wisch eben noch eingepackt.
»Fahrschein«, blökt es zu mir herunter.
Jaja, ich suche doch.
Eine Schrecksekunde glaube ich, das war’s. Dann finde ich den Zettel und halte ihn hoch. Er klebt so sehr an meiner Hand, dass der Schaffner ihn mir förmlich wegreißen muss.
»Ihre Legitimation«, sagt er, ohne mich anzusehen, und ich reiche ihm meinen Personalausweis nach.
»Der interessiert mich nicht. Ich will Ihre Legitimation. Ihre Kreditkarte.« Jetzt sieht er mich mit hochgezogenen Brauen an. Um mich herum wird es ganz still.
»Das Plastikding, mit dem Sie Ihre Fahrkarte bezahlt haben!«, fügt er hinzu, als würde ich schlecht Deutsch verstehen.
»Ich … ich habe das Ticket bezahlt. Im Internet. Sonst hätte ich es ja gar nicht ausdrucken können.«
Er verdreht die Augen. »Können Sie nicht lesen? Steht doch unten drauf. Wenn Sie bei der Buchung angegeben haben, dass Sie sich mit Ihrer Kreditkarte identifizieren wollen, müssen Sie die auch mitführen.«
»Wozu? Der Ausdruck ist der Beweis!«
Er sieht durch mich hindurch aus dem Fenster, dann fixiert er mich. »Wenn Sie mir Ihre Kreditkarte nicht zeigen, ist das Ticket ungültig.«
Mir fällt nichts ein, was ich dazu sagen könnte. Die Mastercard liegt zu Hause, in der Nische hinter dem Kühlschrank. Ich war mir sicher, dass ich sie dort, wohin ich gerade unterwegs bin, nicht brauchen würde. Das Kleingedruckte meines ersten Onlinefahrscheins habe ich glatt übersehen. Früher wäre mir so was nicht passiert. Früher, das war vor drei Monaten. In einem anderen Leben.
»Ts.« Er seufzt tief und unterstreicht es mit einem ausladenden Kopfschütteln.
Wortlos sehe ich ihn an.
Das scheint ihn herauszufordern. Seine Haltung strafft sich, und der Ausdruck in seinen Augen wird hart. »Zwei Möglichkeiten. Entweder Sie zahlen jetzt hundertsieben Euro, oder der nächste Halt ist für Sie Endstation.«
Etwas in mir regt sich. Ein Rest Widerstand und das Wissen, dass ich bloß schlappe achtzig Euro bei mir habe – als Reserve für besondere Ausgaben.
»Das sehe ich nicht ein. Ich habe einen bezahlten Fahrschein!«
Der Schaffner macht einen Schritt auf mich zu. Ich versuche, an ihm vorbei Luft zu holen. Ausweichen kann ich nicht. Das Abteil ist voll besetzt, und der ganze verdammte Intercity gleicht schon am Vormittag einer Pressfleischkonserve, die in der Sonne schmort.
Ich muss diesen Zug nehmen, wenn ich mich retten will.
Der Fahrscheinsheriff zuckt mit den Augen und versucht, eine Schweißperle zu ignorieren, die ihm über Stirn und Schläfe an der Wange hinunterläuft, kurz am Kinn verharrt und dann ihren Weg Richtung Kragen nimmt. Es ist nur ein Moment der Irritation, doch irgendwie untergräbt das seine Autorität. Sein Gesichtsausdruck sagt mir, dass er mich dafür bestrafen wird.
»Okay. Sie stehen jetzt sofort auf und packen Ihren Kram zusammen. In zehn Minuten sind wir in Rheine. Das war’s dann, verstanden?«
»Oder was?«
»Oder es setzt eine Anzeige.«
Ich mache den Fehler mich zurückzulehnen. Ein Stich durchfährt mich. Sofort wird mir übel vor Schmerz. Ich fluche innerlich und keuche. Das Einzige, was ich provoziert habe, ist das Aufreißen meiner äußerst unpraktisch gelegenen Wunde. Eine schwache Entgegnung ist alles, was ich zustande bringe.
»Sie wissen ganz genau, dass ich den Fahrschein bezahlt habe. Ist Ihnen das denn noch nie begegnet? Menschen? Die ihre Kreditkarte vergessen haben, weil sie in Gedanken ganz woanders sind?«
Er zückt die Keule der Paragrafen reitenden Handlanger mit zynischem Grinsen. »Wir haben unsere Vorschriften.«
Er hat mich. Er weiß es.
Im Abteil wird es unruhig.
»Das können Sie nicht machen!«
»Sie sehen doch, dass es der Frau nicht gut geht!«
»Gibt es denn keine andere Lösung?«
Wäre ich nicht so abgeschnitten von der normalen Welt, würden mich die Versuche meiner Mitreisenden rühren.
So blicke ich nur weg. Draußen vorm Fenster ziehen Kornfelder mit leuchtenden Mohntupfern vorbei. Vögel stürzen sich durch das Flimmern der Hitze über den Ähren. Mein Hirn versucht krampfhaft, die schweißgetriebenen Ausdünstungen um mich herum in den Geruch des Sommerbodens zu verwandeln. Würzig. Von der Wärme getragen. Die Fenster sind jedoch verriegelt, lassen nichts durch. Wie meine Kapsel.
Ich sage nichts mehr. Mit Kleingeistern zu diskutieren, ist aussichtslos. Die Appelle der anderen prallen daher auch wirkungslos an dem Mützenträger ab.
»Also, was ist jetzt?« Ohne jede Gnade lässt er mir die Wahl. »Rausfliegen oder zahlen. Bar oder Kreditkarte.«
Am liebsten würde ich ihn mit seiner roten Krawatte am Zugende festbinden.
»Ich habe keine Kreditkarte dabei.«
»Dann Euros.« Seine Lippen vibrieren.
»Mein Bargeld reicht nicht.«
In seinem Blick sehe ich Triumph und vor meinem geistigen Auge das Ende meiner Reise, bevor sie richtig begonnen hat. Müde lege ich den Kopf in die Hände.
Lütje Teehuus, Januspark, Juist
Lysander Falk sitzt vor seinem Japan Sencha Extra Fine und müht sich trotz seiner Verfassung, dem grünen Tee den vollmundigen Charakter abzuringen, den die Karte verspricht. Leicht und duftig, soll er sein. Wie gern würde er das auch von sich behaupten. Stattdessen kann er nicht umhin, missmutig aus dem Fenster zu sehen. Die Sonnenterrasse ist gut gefüllt, was angesichts der Außentemperatur kein Wunder ist. Sie erinnert ihn an einen sommerlichen Vormittag in Spanien, an eine Zeit, die so unbeschwert war, dass es ihm heute vorkommt, als hätte er sie nur geträumt. Deswegen sitzt er auch drinnen, in der Stube. Weil er das Licht nicht erträgt und auch nicht das Lachen der anderen, die sich ihren Aufenthalt auf der Insel mit rechtschaffener Arbeit verdient haben. Und weil er sich verstecken muss, bis er die Kraft hat, sich ihrer Weltsicht entgegenzustemmen. Bei dem Gedanken lacht er bitter auf und wendet sich wieder dem mit seinen hellblauen Akzenten urig gestalteten Inneren des Lütje Teehuus zu. Verborgen im Januspark ist das historische Insulanerhäuschen genau der richtige Ort, um sich zu verkriechen, ein wenig verwunschen und anheimelnd.
Der Mann am Tisch schräg gegenüber hat sich vom Treiben hinter der Scheibe abgewandt und hockt mit krummem Rücken vor seinem Matjes, den er mit so viel Argwohn fixiert, als könnte er ihm noch im letzten Moment vom Teller springen. Fast macht es den Eindruck, als wünschte sich der Typ das sogar. Gesunder Appetit sieht anders aus.
Zum x-ten Mal rührt Lysander in seiner Tasse und sieht zu, wie der andere mit fahrigen Bewegungen zu essen beginnt. Dabei ist der mürrische Fischfreund so angestrengt darauf bedacht, den Mund zu treffen, dass er ihn nicht bemerkt. Auch nicht die aufmerksamen Augen des schrankbreiten Kerls im Rollkragenpulli, der sich ihm gerade von der Seite nähert.
»Seit wann sitzt du aufm Trocknen?« Der Bullige knallt ihm ein Bier neben die Hand. Ein Geruch nach Pferd nimmt mit ihm Platz.
»Moin, Berno, alles im Lot?« Der Matjesmann stochert in seinen Bratkartoffeln herum.
Lysanders Tee ist plötzlich uninteressant. Halb verbirgt er den Kopf hinter der Speisekarte und tut so, als würde er das Angebot studieren.
»Nee, keen Stück.« Berno leert die goldschimmernde Flüssigkeit in seinem Glaskrug fast bis zum Grund. Er wartet, bis die Bedienung herüberschaut, und macht mit den Fingern ein V in ihre Richtung.
»Heute is wieder Döskopptag an der Dunenburg. Gefällt mir nich.«
»Hm.« Der Matjesmann nickt und schaut auf die Pfütze im Glas seines Kumpels. Er schnauft ein wenig zu übertrieben. »Apfelschorle. Mannomann. Wenn du schon Pause machst, kannst du ja wohl auch mal ’n Bier trinken.«
»Nö«, sagt Berno. »Wenn man jeden Tag im Jahr Bereitschaft hat, darf man sich schon mal ’ne Auszeit mehr nehmen. Aber Alkohol ist ’ne andere Hausnummer. Nix für mich jedenfalls.«
Sein Freund schiebt den nahezu unberührten Matjesteller von sich weg und verschränkt die Arme. »Jaja, du Aufpasswauwau. Don’t drink und fahr die Kutsche. Wann kommen denn deine Festlandjungs zur Saisonverstärkung?«
»In einer Woche. Hoffentlich ’n paar Gescheite diesmal. Man weiß ja nie, was die einem so schicken.«
»So oder so wär’s mir lieb, wenn du sie im Blick behältst.«
»Dir vom Leib, meinst du wohl. Was macht deine Front?« Berno nimmt der Bedienung die nachbestellten Getränke ab, schiebt sich die neue Saftschorle und seinem Sitznachbarn das frische Bier zu. Der wiegt leicht den Kopf hin und her und sieht aus, als hätte er Schmerzen.
»Schatten im Dunkeln. Vorhänge zu. Sendeschluss. Immer das Gleiche«, antwortet er und reibt sich den Nacken.
Vielleicht tut ihm wirklich etwas weh, denkt Lysander.
»Und keiner muckt was.« Berno kippt das zweite Glas und rüstet sich zum Aufbruch. »Da kriegst du keinen Haken rein, solange die sich nix zuschulden kommen lassen.«
Sein Gesprächspartner zuckt mit den Schultern. »Wie du so gern sagst: Wo kein Kläger, da kein Richter. Aber wir geben nicht auf, bis wir rausgekriegt haben, was dahintersteckt. Wir werden Rottmann packen. Das schwör ich dir. Er kann sich nicht ewig verstecken. Bis dahin zündeln wir weiter.«
»Nur ohne echtes Feuer.« Berno steht auf und klopft ihm auf den Rücken, bevor er verschwindet.
Sein Freund sieht ihm hinterher und schüttet das Bier in einem Zug herunter, wie um seinen Mutpegel konstant zu halten.
Eine solche Entschlossenheit bringt Lysander bei seinem kalten Tee nicht mehr auf. Er klappt die Karte zu, legt fünf Euro auf den Tisch und geht Richtung Tür. Erst jetzt nimmt der Mann gegenüber ihn wahr. In seinen Augen flackert Angst.
Intercity 2206 von Münster/Westfalen nach Norddeich/Mole
»Wie viel brauchst du?« Dem Geräusch nach zückt die Frau neben mir ihre Brieftasche.
Mein Blick bleibt am Boden kleben. Seit ich dieses Abteil betreten habe, versucht sie mir ebenso hartnäckig ein Gespräch aufzudrängen, wie ich zurückschweige.
»Siebenundzwanzig« Meinen Stolz habe ich also auch zu Hause gelassen.
Ohne zu zögern gibt sie dem Schaffner dreißig Euro. Umständlich wühle ich mein Barvermögen aus dem Rucksack hervor, um meinen roten Kopf zu verbergen.
Sobald der Vollstrecker das Abteil verlassen hat, bedanke ich mich bei ihr. »Du kriegst es so bald wie möglich wieder.«
»Klar, du entkommst mir sowieso nicht mehr«, sagt sie und findet das witzig.
Ich kann nicht lachen.
»Mach dir mal keinen Stress«, fügt sie schnell hinzu. »Kannst es mir auf Juist zurückgeben. Wir haben ja massig Zeit.«
Irritiert schaue ich sie an.
»Wiebke Ingelbach.« Sie zwinkert mir zu. »Wir müssen doch zusammenhalten!«
Noch immer verstehe ich nichts.
»Die Unterlagen der Klinik. Ich hab auf dem Bahnsteig neben dir gestanden, als du sie rausgeholt hast. Ich fahr da auch hin. Ist das nicht toll? Dann kennen wir uns schon. Wie heißt du überhaupt?«
»Ella Brandt«, antwortet der höfliche Teil in mir brav. Der Rest möchte am liebsten durch das geschlossene Fenster springen und neben dem Gleis verbluten. Das fehlt mir gerade noch. Ich kann mich selbst schon nicht ertragen. Angesichts der Vorstellung, dass Wiebke mir von nun an Gesellschaft dabei leistet, fängt meine Magensäure sofort an zu brodeln. Wie selten in meinem Leben fiebere ich der nächsten Begegnung mit einem Geldautomaten entgegen und stoße ein stilles Gebet in den Äther, dass Norddeich einen hat.
Dünenstraße, Juist
Lysander weiß, dass er sich mit dem Rückweg beeilen sollte. Heute ist Ankunftstag, und er hat keine Lust, gleichzeitig mit den Neuen einzutreffen. Denn bis sie sich eingewöhnt haben, werden sie ihn mit aufgerissenen Augen verfolgen. Erst allmählich, wenn sie verstanden haben, wo die Grenze verläuft, werden ihre Blicke anders sein – in der Summe nicht weniger, aber besser verborgen. Das macht es ihm zumindest leichter, damit zu leben. Nicht dass er die Aufmerksamkeit herausfordern würde, ganz im Gegenteil. Er weicht ihr aus, wo er kann. Dass sie wie ein Makel an ihm klebt, ist nicht seine Schuld.
Das nicht.
In dieser Hinsicht hat er sich nichts vorzuwerfen.
Leider erlöst ihn das kein bisschen.
Deshalb treibt die Unruhe ihn hinaus und zwingt ihn sich zu bewegen. Nur wenn seine Füße so sehr wehtun, dass er kaum noch laufen kann, erinnert er sich daran, wer er einst war und dass er sich geschworen hat, den Kampf nicht aufzugeben. Alles, was er will, ist, ganz normal zu leben.
Doch trotz seines Drangs, die Klinik vor den Neuankömmlingen zu erreichen, wählt er nicht den kürzesten Weg. Und das liegt nicht daran, dass er seine Füße noch mehr fordern will. Er muss den Schlenker machen, weil er ihn bereits auf dem Hinweg genommen und an dem frei stehenden grauen Haus in der Dünenstraße etwas mitbekommen hat, von dem er sich wünscht, es wäre Einbildung gewesen.
Fahrrinne nach Juist
Mit Wasser fühle ich mich seit jeher im Einklang. Vor allem in Form von Meer. Schon als Kind habe ich es nie erwarten können hineinzuspringen. Ich bin darauf losgestürmt und habe es begrüßt wie einen lang vermissten Freund. Stundenlang konnte ich mich von ihm tragen lassen und mit ihm spielen, bis meine Eltern die Geduld verloren. Nur mit Mühe und unter großem Protest konnten sie mich herausziehen und in die ungeliebte Kleidung stecken.
Irgendjemand hat einmal gescherzt, ich sei wohl eher eine Nixe, die versehentlich an Land geraten sei. So habe ich mich tatsächlich oft gefühlt. Wie im falschen Element gestrandet.
In den nächsten vier Wochen werde ich reichlich Wasser um mich haben. Das ist das einzig Positive. Nur deshalb habe ich mich für die Dunenburg entschieden. Weil die Klinik auf einer Insel in der Nordsee liegt, möglichst weit entfernt von allem.
Und weil ich keine andere Idee mehr hatte. Ich kann mich nicht dazu durchringen, mit Begeisterung an diesen Psychokram zu glauben, den sie dort veranstalten, um die Gestrauchelten wieder gesellschaftsfähig und hamsterradtauglich zu machen. Ich weiß nur, dass Wasser mich heilt.
Unter normalen Umständen würde ich mich freuen.
Stattdessen lehne ich an der Reling der Fähre und denke ans Springen. Es wäre so einfach.
Aber ich stehe bloß still, bewegt nur durch das Schiff, das bei Hochwasser durch die Fahrrinne pflügt und Kurs auf den Anleger nimmt, während rechts in der Ferne die Konturen Norderneys mit dem schmutzigen Blau der See verschmelzen.
Der Wellengang ist landrattenfreundlich, nur selten klatscht das Wasser hoch bis zur Brüstung und sprüht mir feine Gischt ins Gesicht. Tief atme ich die Luft, die nach Salz, Tang und Schiffsöl riecht, und beobachte, wie ein paar Touristen den kreischenden Möwen trotz der Füttern-verboten-Schilder ungelenk ihre Essensreste zuwerfen.
Die meisten sehen aus, als wären sie schon jenseits der Arbeitsgrenze. Bestimmt wollen sie noch schnell die Gunst der nächsten anderthalb Wochen nutzen, bevor die Sommerferien beginnen und die Insel mit Familien fluten. Bis eben haben sie fast alle drinnen gesessen und Würstchen oder Kuchen verschlungen, als ginge es nach Alcatraz. Jetzt können sie die Ankunft kaum erwarten.
Mir geht es genauso. Weniger aus Vorfreude, sondern weil ich Wiebke endlich abzuschütteln hoffe. Die letzten anderthalb Stunden des Alleinseins verdanke ich nämlich einzig der gnädigen Fügung, dass meine aufdringliche Retterin seekrank ist. Bleich wie ein ausgewaschenes Handtuch kauert sie seit Beginn der Überfahrt in einer Ecke des Bordbistros, verdreht die Augen in regelmäßigen Abständen zur Decke und versucht angestrengt, das Wogen der Fähre zu ignorieren.
Umso besser für mich. Denn sobald ich im Zug nicht mehr hatte so tun können, als würde ich schlafen, hat sie endlos auf mich eingeredet. Dass ich dabei aus dem Fenster sah, störte sie nicht. Nach zwei Stunden verbalem Dauerfeuer weiß ich jetzt unter anderem, dass sie aus einem Schweinemastkaff im Münsterland stammt und wegen zwei Fehlgeburten eine Depression hat. So munter, wie sie drauflosplapperte, halte ich das für ein Gerücht.
»Bipolar«, sagte sie, wie um meinem Unglauben vorzubeugen, »manische Phase!«
Als wäre das eine Auszeichnung.
»Deshalb hasse ich meinen Namen auch so«, fuhr sie fort, ohne dass ich eine Frage gestellt hätte. »Wiebke, das klingt doch schon nach Wankelmut. Und außerdem dick!«
Da ist was dran. Wiebke ist ziemlich rund um die Hüften und wiegt sie beim Laufen wie ein schwankender Kutter.
»Emily!«, sagte sie schließlich. »Das wäre mein Traum.«
Ich hatte peinlich berührt geschwiegen. Für mich klang beides nach pummeliger Nervensäge.
Nicht zum ersten Mal frage ich mich, warum sich wildfremde Menschen ständig dazu bemüßigt fühlen, mir ihre Lebensgeschichte aufzudrängen. Als hätte ich ein Erzähl-mir-alles-Gesicht, das ihnen signalisiert: Lass es raus, hier hört endlich mal jemand richtig zu!
Scheinbar bin ich von Natur aus vertrauenswürdig. Für die Journalistin Ella war das lange eine zuträgliche Gabe. Für das heutige Wrack ist es ein Grauen.
Schwimmbad der Rehabilitationsklinik Dunenburg, Juist
Das Wasser versöhnt Lysander für den Moment. Er liegt mit geschlossenen Augen auf dem Rücken und lässt sich von den sachten Schwingungen treiben. Niemand wagt es, ihn zu stören. Die Pause zwischen den beiden Schwimmgruppen gehört heute ihm allein. Zum Glück, denn er ist immer noch ziemlich durcheinander.
Als er auf seinem Rückweg an dem grauen Haus vorbeigekommen war, hatte es sich als schönstes Sommertagsidyll gezeigt. Nichts deutete mehr darauf hin, dass die Geräusche real waren, die ihn auf dem Hinweg erschüttert hatten.
Ein plötzliches Poltern riss ihn aus seinen Gedanken, als er gerade im Begriff war, das Haus hinter sich zu lassen. Obwohl die geschlossenen Fenster die Lautstärke deutlich dämpften, klang es so, als wäre im Inneren etwas Größeres zusammengebrochen. Spontan musste er an eine Holzkonstruktion denken, die auf einen harten Grund schlägt und zerbirst. Ein betagtes Schrankregal vielleicht.
Doch noch während er sich darüber wunderte, warum er dann keine Gegenstände krachen hörte, die hinterherstürzten, folgte ein menschlicher Aufschrei, dunkelstimmig und erstickt. Beinahe so, als wäre jemand unter etwas begraben.
Erschrocken drehte er sich um und ging zurück, um herauszufinden, ob sich jemand in Not befand und seine Hilfe brauchte.
Just in diesem Augenblick öffnete sich die Haustür, und eine auffallend attraktive Frau mittleren Alters kam heraus. Sie entdeckte ihn, und ein Lächeln trat in ihr Gesicht, das umso aufgedrehter wurde, je länger sie ihn ansah.
Da keimte die altbekannte Panik in ihm hoch. Statt sich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen, wandte er sich ab und entfernte sich zügig.
Erst als er am Lütje Teehuus eintraf, fiel ihm ein, dass die Frau viel zu elegant gekleidet war. Zumindest, wenn der Müllsack, den sie in der Hand gehalten hatte, auf einen Hausputz schließen ließ. Wie von einem niederkrachenden Schrankregal ramponiert sah sie auch nicht gerade aus.
Seit ihm diese Details bewusst sind, gehen sie ihm nicht mehr aus dem Sinn, und er wirft sich vor, die Frau nicht wenigstens gefragt zu haben, ob alles in Ordnung sei. Mit der Antwort hätte sie ihm auch gleich ihre Stimmlage verraten. Dann hätte er vielleicht einschätzen können, ob sie es gewesen war, die geschrien hatte.
Oder jemand anders.
Im Nachhinein blieb ihm nur, denselben Weg zurück zu nehmen und auf irgendeinen Hinweis oder eine zweite Begegnung zu hoffen. Leider vergeblich. Das Gefühl, sich übersensibel in etwas hineinfantasiert zu haben, hielt ihn davon ab, durch die unteren Fenster zu spähen.
Als er das Haus zurückgelassen hatte, hatte es friedlich im Grün der umgebenden Büsche gestanden, und er war sich vorgekommen wie der letzte Trottel.
Geschieht dir recht, denkt er und dreht sich mit einer fließenden Bewegung in die Bauchlage. Noch immer wütend über sich selbst, verausgabt er sich im Delfinschwimmen, bis die nächsten psychisch Versehrten zum Rückentraining eintrudeln.
Fähranleger, Juist
Mein Plan war, vom Schiff zu sein, noch bevor Wankel-Wiebke merkt, dass es sich nicht mehr bewegt. Das ist gründlich danebengegangen, denn ich habe ihren Drang unterschätzt, endlich wieder festen Boden unter die Füße zu kriegen. Jetzt steht sie neben mir an der Mole und zieht die Stirn kraus. Entgegen ihrer augenscheinlichen Erwartung stürmt uns kein freudiges Begrüßungskomitee entgegen, das uns samt der Koffer in Empfang nimmt.
Stattdessen wimmelt es am Anleger von Handkarren mit Werbeschriftzügen von Hotels und Ferienwohnungen, die vermuten lassen, dass die Ankömmlinge ihren Weg in die Unterkünfte allein finden müssen. Die meisten unserer Mitreisenden scheinen sich auszukennen. Sie laden ihr Gepäck auf die Wüppen, wie sie die Karren mit Insidermiene nennen, und folgen zu Fuß der breiten Straße, die auf den in Sichtweite liegenden Hauptort zuführt. Er heißt genauso wie die Insel.
Für alle, die nicht laufen können oder wollen, stehen ein paar Pferdekutschen bereit, denn Juist will autofrei und beschaulich sein. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob mir das allgegenwärtige Hufgeklapper nicht ebenso auf die Nerven geht wie die fliegenübersäten Hinterlassenschaften der so eigenwillig riechenden Tiere. Vielleicht sind mir Pferde auch einfach nur zu groß.
Meine ungeliebte Begleiterin hingegen mustert die Zossen erleichtert und sucht sich ein Gespann aus.
»Das da drüben!« Sie schunkelt los.
Der Kutscher ihres Zielobjekts wirft einen abschätzenden Blick auf ihre beiden Koffer und schaut weg.
»Ich laufe lieber!«, rufe ich ihr hinterher.
»Spinnst du? Das ist doch viel zu weit!«
Ich frohlocke mit unbewegter Miene. Zum Glück hat sie keine Ahnung. Juist ist mit siebzehn Kilometern zwar die längste aller Sandbänke im ostfriesischen Wattenmeer, trotzdem überschaubar. Auf meinem Faltplan sieht die Insel aus wie eine schmale Kante, die irgendwann in grauer Vorzeit vom Festland abgebrochen und nach Norden weggetrieben ist. Gerade mal neunhundert Meter misst sie an der breitesten Stelle. Ungefähr mittig liegt Juist-City mit dem Fähranleger und ein Stückchen links davon die zweite nennenswerte Siedlung namens Loog. Daneben erstreckt sich in beide Längsrichtungen nahezu unbewohnte Landschaft, die westlich über den Hammersee hinaus bis zum Billriff reicht und gen Osten im Nationalparkgebiet Kalfamer endet. An der Grenze zur Schutzzone im Nordosten, nur wenige Hundert Meter Luftlinie entfernt vom Flughafen, thront die Klinik in den Dünen.
Wenn ich der Deichstraße bis zur Flugplatzstraße folge und den Abzweig hoch zur Klinik nehme, sind es von hier aus etwa vier Kilometer bis dorthin. Mit den Koffern und meiner Wunde als Handicap brauche ich schätzungsweise eine Stunde dafür. Entschlossen, das zu schaffen, wische ich Wiebkes Einwand mit einer Handbewegung weg und drehe mich um.
»Außerdem sind wir viel zu spät dran! Wir hätten vor drei Stunden einchecken müssen!«
»Eben!«, rufe ich über die Schulter zurück und sehe aus dem Augenwinkel, dass sie ihre Koffer bereits in die Kutsche hievt. Der Fahrer macht keine Anstalten, ihr zu helfen. Ich vermute, dass ihn das nicht vor ihrem Redeschwall retten wird. »Dann kommt es jetzt auch nicht mehr darauf an. Außerdem will ich zur Bank!«
In Norddeich hatte ich das nicht mehr geschafft, bevor wir auf die Frisia-Fähre umgestiegen sind, und ich habe nicht vor, Wiebke ihr Geld noch einen Tag länger zu schulden.
Der Kutscher lässt ihr keine Zeit für eine Erwiderung, gibt dem Fuchs ein Kommando und fährt an. So zügig ich kann, laufe ich los. Nach ein paar Schritten sehe ich bloß noch zwei Schemen, die sich schneller als gedacht entfernen. Wiebke fuchtelt mit den Armen, als könnte sie mich damit überzeugen, dass ich einen Fehler mache.
Bewegungsraum der Rehabilitationsklinik Dunenburg, Juist
Für heute hat die Körpertherapie ein Ende. Lysander berührt schon die Tür, um den Bewegungsraum zu verlassen, ist jedoch nicht schnell genug.
»Entschuldige, hast du mal einen Moment Zeit?« Die schmale Kleine mit den dunklen Bindfädenhaaren steht hinter ihm. Mascha Holm, wenn er sich richtig erinnert.
Verdammt noch mal, geh, befiehlt er sich und verharrt.
»Ich mein, ich darf doch Du sagen, oder?«
Er schweigt. Aber das reicht nicht. Es reicht nie. Er macht immer denselben Fehler.
»Ich würde gern … könnten wir vielleicht … einen Spaziergang machen? Ich muss dringend mit jemandem reden.«
Seine Brauen ziehen sich zusammen und ebenso seine Eingeweide. »Warum ausgerechnet mit mir?«
Sie nestelt an einer Strähne herum und hat sichtlich Hemmungen, ihm direkt in die Augen zu sehen.
»Weil du nicht so bist wie die anderen.« Es klingt wie ein Geständnis.
»Aha. Und wie bin ich dann?« Er ahnt bereits, was kommt, und möchte am liebsten schreien. Stattdessen atmet er hörbar aus. Auch das schreckt sie nicht ab.
»Na, irgendwie … vertrauenswürdig. Du hältst dich aus allem raus. Lässt einen in Frieden, machst dich nicht lustig … Du weißt schon.«
»Hm. Und da hast du dir gedacht, dem kannst du was anvertrauen?« Er sagt es absichtlich spöttisch.
»Ja«, druckst sie und schaut auf ihre Schuhe bleibt aber stehen.
Lysander überlegt, wie er ihr auf die Schnelle möglichst schonend sagen kann, dass er kein Interesse hat. Weder an ihr als Person noch an ihrem Geheimnis.
Sie blickt hoch und sieht ihn bedrückt an. »Bitte, schick mich nicht weg.«
Der Mann, der er früher war, hätte das auch nicht getan. Er hätte sich wenigstens angehört, was ihr auf dem Herzen liegt. Der Rest, der heute davon übrig geblieben ist, muss sich jedoch schützen.
»Tut mir leid«, sagt er, »ich habe wirklich ein strammes Programm vor mir.«
»Dann morgen?«
Schon wieder ein Fehler. Er ist einfach noch viel zu nett, als dass sie locker lassen würde. Er legt sich gerade ein paar Worte zurecht, mit denen er sie harsch abbügeln will, da fällt ihm etwas ein. Er kann den Spieß umdrehen und ihre Anhänglichkeit genauso gut für sich nutzen. Zwar sträubt sich sein Gewissen, am Ende siegt der Selbsterhaltungstrieb.
»In Ordnung«, sagt er und geht.
Kurplatz, Juist
Obwohl es auf sechs Uhr zugeht, hat die Sonne noch Kraft. Ich spüre sie auf den Lidern, während ich mit geschlossenen Augen auf der begehrten Terrasse des Café Baumann’s am Kurplatz sitze und hoffe, dass ihre Strahlen tief in meinen Körper dringen und es schaffen, meinen erstarrten Kern zu schmelzen. Behutsam taste ich nach dem doppelten Wodka, setze das Glas an. Der letzte Schluck brennt sich meine Speiseröhre hinab in den Magen. Nach dem Schock über meinen Kontostand war der Wodka bitter nötig und, da ich schon einmal mit dem Ruinieren zugange war, habe ich mir aus purem Trotz auch noch ein knusprig zartes Geflügel-Ananas-Baguette nebst einer Tasse Kaffee gegönnt, die ich mir ebenfalls nicht leisten kann. Immerhin, meine erste Nahrungsaufnahme heute.
Wie eine normal begüterte Juist-Touristin lege ich einen frischen Zwanziger aus dem Bankautomaten an der Wilhelmstraße auf den Tisch und verlasse das Café, um zum Anleger zurückzugehen. Manche der kleinen Läden schließen bereits. Geübte Hände schieben Ständer mit Strandmatten, Strohhüten, Postkarten und Souvenirs zurück in das Dunkel der Geschäfte. Viel habe ich bislang nicht gesehen, aber so verwaist, wie die Straßen sind, zieht das Leben ohnehin erst mit der Hauptsaison in ein paar Tagen ein.
Inzwischen ist der Anleger ausgestorben. Nur an der Mole daneben dümpeln ein paar Sportboote und Jachten. Möwen so rund wie überfütterte Katzen laufen am Kai Patrouille und puhlen mit spitzen Schnäbeln in den Steinfugen herum. Aus der Nähe wirken sie wie aus Pappmaché gebastelt.
Weit und breit ist keine Kutsche mehr zu sehen. Gut. So komme ich nicht in Versuchung, mich gleich heute in den totalen Bankrott zu werfen. Ich ziehe meine Koffer hinter mir her und schlage den Weg ein, den Wiebkes Fahrer genommen hat.
Zwanzig Minuten später bin ich erledigt. Der Schweiß rinnt mir aus allen Poren, mein Shirt klebt am Rücken, meine Haare locken sich feucht im Nacken. Immer wieder rutschen Steinchen zwischen die Rollen meiner Koffer und blockieren sie. Wütend gebe ich ihnen einen Tritt und lasse mich entkräftet am Rand einer Düne auf den Hintern fallen, was ich wegen der Wunde am Po sofort bereue. Der Schmerz treibt mir die Tränen in die Augen.
»Du Idiotin!«, schelte ich mich. »Du hast wirklich ein Bescheuertenpatent! Verreck doch am besten gleich hier, du schaffst es sowieso nie mehr auf die Füße, du …«
Abrupt halte ich inne und horche auf. Jetzt bilde ich mir schon ein, Hufe klappern zu hören. Leise. Wie aus einer anderen Zeit. Halluzinationen. Klar, bei Wodka und Kaffee statt Wasser. Morgen steht’s in der Zeitung: Patientin kam nie in Klinik an, weil sie auf dem Weg dorthin in vorsommerlicher Jahrhunderthitze verdurstete …
Für eine Zigarette würde ich jetzt töten. Einen dämlicheren Zeitpunkt zum Aufhören hätte ich mir nicht aussuchen können.
Das Geräusch nähert sich.
Meine Einbildung wird zu einem Fleck am Horizont. Ich sitze erhöht und kann die strauchbewachsene Senke hinter mir überblicken. Von dort bewegt sich etwas auf mich zu, das mit jedem Meter schärfere Konturen gewinnt.
Ich glaube es kaum, als ich es erkenne. Es ist eine Kutsche. Gezogen wird sie von einem Pferd, wie ich es noch nie gesehen habe. Es sieht aus wie ein Kaltblüter, ist dafür aber eine Spur zu gedrungen. Sein kompakter Leib ist weiß und von großen schwarzen Flecken übersät. Die blond-schwarze Mähne und der Schweif sind mit Lederbändern zu Zöpfen geflochten, die wie dicke Taue an ihm herabhängen und ihm die gezähmte Wildheit eines Indianers verleihen.
Der Wagen dahinter ist aus Holzbohlen gezimmert und trägt einen Kutscher, der mir in seinem marineblauen Rollkragenpullover nicht minder verwegen vorkommt. Sein Schädel ist voll heller Stoppeln, die ungefähr genauso lang sind wie sein unrasierter Bart. Seine Kraft scheint der seines Pferdes in nichts nachzustehen. Nicht unbedingt der Mensch, dem eine erschöpfte Frau in der Einöde begegnen möchte.
Als er auf meiner Höhe ist, hält er die Kutsche an. Sie ist leer. Das Pferd tänzelt, als wäre es ungehalten über die Rast. Trotz seines geringen Stockmaßes könnte es mir locker vom Kopf fressen.
»Moin.« Der Mann verzieht keine Miene, blickt mich unverwandt an.
»Hallo.« Das klang schon mal besser.
Ohne mich aus den Augen zu lassen, deutet er mit dem Kinn neben sich.
Ich schüttle den Kopf. »Kein Geld.«
»Deswegen machst du so’n Scheiß?«
Meine Schultern zucken wie von selbst. Es gab Zeiten, da habe ich mich gefreut, wenn jemand Fremdes mich geduzt hat. Jetzt komme ich mir vor wie pickelige dreizehn, obwohl ich fast dreimal so alt bin.
»Steig auf«, sagt er, und es klingt wie ein Angebot, das ich nicht ablehnen sollte.
Ich zögere trotzdem. Können meine Probleme noch größer werden? Vermutlich ja.
»Kost nix.« Er springt ab und schnappt sich meine Koffer.
»Warum?«, frage ich matt.
»Weil du aussiehst, als würdest du gleich hier krepieren. Darum.«
Mühsam hieve ich mich auf den Bock. Alles tut weh. Keine Ahnung, wie Rentnertouristen da je raufkommen sollen.
»Ich fahr nicht jeden«, sagt er, als hätte er meine Gedanken gelesen. »Schon gar nicht zur Klinik.«
Nur leicht zieht er an den Zügeln, und die Kutsche ruckelt los. Wir rollen schweigend, ich starre über die Felder und Wiesen in die Weite, und es vergeht eine Ewigkeit, bis er wieder spricht.
»Meine Leute suche ich mir aus. Auf Dösköppe habe ich keine Lust, egal ob Kliniker oder Touristen.«
Na, da bin ich gespannt. Ich blicke ihn nur schräg von der Seite an und warte auf die Fortsetzung.
»Mit dir isses was anderes. Wirkst nicht dösig, nur neben der Spur. War mir gleich klar, wie du vom Schiff gekommen bist.«
Ich bin mir todsicher, dass ich ihn am Anleger nicht gesehen habe. Trotz eingeschränkter Wahrnehmung. Das Gespann hätte ich mir gemerkt. Ein Blick nach unten zeigt mir, dass es selbst bei nur einer Pferdestärke nicht klug ist, spontan vom Bock zu springen. Mit gebrochenen Knöcheln bin ich vollkommen wehrlos. Mal abgesehen von den Koffern, in denen sich fast alles befindet, was ich noch habe. Mir wird ganz mau.
»Das ist kein guter Ort«, sagt er.
»Welcher Ort? Die Klinik?«
Er brummt nur, was ich als Ja werte. Danach versinkt er wieder in Schweigen.
»Wenn die mir nicht helfen können, dann keiner.«
Ein paar Schwalben sausen über unsere Köpfe hinweg in die Dünenfelder. Er blickt ihnen nach und schnaubt. »Die können sich doch selbst nicht helfen. Fliegen alle wie die Vögel. Keiner von denen ist länger als sechs Monate da. Die sind schon wieder weg, bevor sie richtig angekommen sind.«
»Sprechen Sie von den Therapeuten? Die Therapeuten werden alle nach sechs Monaten entlassen?«
»Kannst jeden Kutscher fragen. Irgendwann sitzen sie viel schneller wieder auf dem Bock, als sie gedacht haben, und jammern einem die Ohren voll.«
»Kommen die denn ausschließlich vom Festland?«
»Die ganze Besatzung. Nicht ein Job für die Hiesigen. Für die sind wir nur Inselaffen.«
Das ist es also. Der blanke Neid. Hätte ich mir denken können, dass es um so was geht.
Der Wagen hüpft über eine Erhebung, und ich verlagere meine Sitzposition, bis der Schmerz in ein dumpfes Pochen übergeht.
»Da stimmt was ganz und gar nicht.« Er sagt es sachlich, nicht eine Spur mystisch.
Genau das jagt mir einen Schauer über den schwitzigen Rücken. »Woran machen Sie das fest?«
Er klopft auf seinen Bauch und streicht sich dann mit der kräftigen Hand über die Nase. »Ich kann das riechen.«
Irritiert werfe ich ihm einen Blick von der Seite zu. So viel Esoterik hätte ich diesem Baum von Kerl gar nicht zugetraut. Ein Spinner also. Klar, er trägt ja auch einen Rollkragenpullover, obwohl es bullewarm ist. Wenigstens riecht er nicht so streng wie sein Gaul, dessen Geruch das Einzige ist, was ich im Moment noch als real erlebe.
»Okay«, sage ich und gehe zum Schein auf ihn ein. »Und was soll ich Ihrer Meinung nach jetzt tun?«
Statt einer Antwort hebt er den Kopf und deutet mit dem Stoppelkinn nach vorn. Der Weg steigt an, und wir fahren eine Anhöhe hoch, hinter der sich eine dünenumsäumte Ebene öffnet. Ich erkenne ein Dach. Es gehört zum Herzstück der Klinik, einer mächtigen alten Jugendstilvilla, deren Anblick sich wie ein Plakat über sechs Stockwerke nach unten entrollt, je näher wir kommen. Von ihr gehen sternförmig sechs postmoderne Glastrakte ab, die in das umliegende Gelände hineinragen und mich, seit ich das Luftbild im Prospekt gesehen habe, an die Arme eines Kraken erinnern.
Das Abendlicht lässt die Fenster der Villa gleißen. Darüber zeigt sich der Himmel in einem verwaschenen Blau, das von rosa beleuchteten Wolkentupfern durchsetzt ist. Wieder sausen Schwalben darunter hinweg, diesmal Richtung Seeseite, dem Wind entgegen.
Ich habe das Gefühl, ein Trugbild zu sehen, so friedlich und feierlich wirkt der Komplex im Gegensatz zu meiner tosenden inneren Verwahrlosung. Mit einer unerträglichen Selbstgewissheit strahlt er mir seine Mission entgegen. Rehabilitationsklinik Dunenburg – Heilkurort für die Seele, prangt über dem Portal. Klingt verheißungsvoll. Für mich ist es jedoch das Sinnbild meiner Kapitulation.
Mein Fahrer bedenkt mich mit einem langen Blick.
»Gib gut auf dich acht.« Er senkt die Stimme. »Und komm zu mir, wenn was is.«
Ich fröstle trotz der lauen Luft.
Wir rollen über die Zufahrt auf eine gepflasterte Freifläche, die so protzig groß ist, dass ich an den ehemaligen Paradeplatz vor Münsters Schloss denken muss. Erst nach etlichen Metern kommen wir unter dem gläsernen Vordach des Eingangs zum Stehen. Es ist niemand zu sehen. Keine Spaziergänger in Zwangsjacken, aber auch kein Mensch, der mich willkommen heißt. Das Pferd trippelt unruhig.
»Ruhig, Quincy«, mahnt der Kutscher den Hengst. »Er spürt es auch.«
Ich versteinere sofort. Quincy? Aus welchem Film hat er das denn? Plötzlich bin ich mir sicher, dass sich der Mann einen bösen Spaß mit mir erlaubt. Sofort klettere ich vom Bock. Er steigt ebenfalls ab und stellt mir die Koffer vor die Füße. Ich bedanke mich nur, weil ich gut erzogen bin, und will schleunigst verduften, da spüre ich seine Pranke auf der Schulter.
»Frag nach Berno Hansen«, sagt er zum Abschied. »Und gebe Gott, dass du es nie tun musst.«
Wie angenagelt stehe ich neben meinen Koffern auf dem Terrakottapflaster und höre, wie die Kutsche losfährt – und nach ein paar Metern noch einmal stoppt. Seine Augen bohren Löcher in meinen Rücken. Ich sehe weiter nach vorn. Was für eine billige Anmache. Und dann auch noch unter dem Deckmantel religiösen Geschwafels. Ob er sich Hoffnungen macht? Am Ende des Tages läuft es immer auf das Gleiche hinaus. Hätte ich mir denken können.
Endlich setzt sich das Pferd erneut in Bewegung. Vor Erleichterung atme ich wieder. Dünsteten da nicht seine Knödel in Riechweite, könnte ich mir einreden, nur schlecht zu träumen. Mit flatterndem Magen starre ich auf den Eingang der Klinik. Ich habe keine Vorstellung, was mich da drinnen erwartet. Denke ich wirklich, dass ein Psychodoktor mir helfen kann? Vor allem, wobei? Mein altes Leben will ich nicht mehr. Ein neues übersteigt meine Vorstellungskraft. Also, was, zum Teufel, mache ich hier? Vielleicht sollte ich mich umdrehen und abhauen, solange mich noch keiner entdeckt hat. Ein Zimmer im Ort nehmen und morgen mit der ersten Fähre zurückfahren.
Bloß wohin?
Die Erinnerung daran, dass ich keine Wahl habe, holt mich auf den Boden zurück. Verdammt, hat der Kerl mich angekratzt mit seiner Spökenkiekerei. Ich wette, er hat nicht zum ersten Mal den Beschützer gespielt, um sich gleich darauf als Kurschatten anzudienen. Wo kam der denn auf einmal so praktisch im passenden Augenblick daher, mitten in der Pampa? Ich schüttle den Kopf über mich selbst und lege meinen Fluchtreflex an die Kette. Nicht schon wieder wegrennen.
Wie aufs Stichwort gleiten die gläsernen Flügel der Eingangstür beiseite, und ein Trupp von Leuten marschiert mit Zigaretten und neugierigen Seitenblicken an mir vorbei. Sie reden über das Abendessen und schlendern lachend nach rechts über den Vorplatz zu einem Unterstand. Die offizielle Raucherecke, wie es scheint.
Na prima. Ich hatte gehofft, das ganze Gelände wäre tabu. Andererseits kommt es jetzt auch nicht mehr darauf an, wie dick die Schlinge um meinen Hals ist. Ich umklammere die Griffe meines Trolleys und gehe hinein.
Eingangshalle der Rehabilitationsklinik Dunenburg, Juist
Der weiche Teppich im Windfang schluckt das Geräusch meiner Schritte. Eine weitere Tür gleitet zur Seite, und ich stehe im warmen Licht der Abendsonne. Sie ergießt sich durch das gläserne Dach des Rings, der sich wie ein Wintergarten um die sandfarben gekalkten Mauern der Villa schmiegt. Erst blendet sie mich, dann gewöhnen sich meine Augen an die Helligkeit. Überall stehen riesige Kübel mit Feigenbäumen und Dattelpalmen, die fast die Decke berühren. In den beigen Sofas und Sesseln dazwischen sitzen hier und da einzelne Gestalten, die sich in Bücher vertieft haben. Andere unterhalten sich oder beschäftigen sich gruppenweise mit einem Gesellschaftsspiel. Ich sehe kein einziges Smartphone. Immer wieder brandet Gelächter auf, ertönen Rufe oder Anfeuerungen. Vor dem Eingang zur Villa, der mit Kübelpflanzen vom Rest des Wintergartens abgetrennt ist, plätschert ein Springbrunnen. Fehlen nur noch exotische Vögel, die die wohltemperierte Luft mit heiseren Schreien füllen.
Das hatte ich nicht erwartet.
Irritiert über die Abwesenheit all dessen, was ich mit einer Klinik verbinde, steuere ich auf den Empfang zu, der links von mir als cremeweißer, gewölbter Halbkreis auf einer erhöhten Ebene thront. Die Frau dahinter, ein mütterlich runder Typ mit dunkelblond gefärbten Haaren, ist schätzungsweise Ende fünfzig und erinnert mich an die Klementine aus der Waschmittelwerbung meiner Kindertage. Sie wirft einen Blick auf ihre Uhr und mustert mich mit gerunzelter Stirn. Rita Kalo, steht auf dem Schild an ihrer Rüschenbluse. Wahrscheinlich geht sie in Gedanken schon ihre Standpauke durch.
»Ich hab’s nicht eher geschafft«, sage ich schnell. »Ich hatte unterwegs einen Zusammenbruch.«
Ihre Gesichtszüge entspannen sich einen Hauch. Vielleicht ist sie ja ganz herzlich, wenn man nicht gerade fünf Stunden zu spät kommt.
»Geben Sie mir bitte Ihre Papiere.«
Die Szene im Zug noch plastisch vor Augen, kämpfe ich gegen ein Déjà-vu, diesmal gibt es zum Glück nichts zu beanstanden. Sie notiert meine Daten und reicht mir etwas, das sich wie ein Radiergummi anfühlt.
»Ich werde jemanden rufen, der Sie zu Ihrem Zimmer bringt. Dort finden Sie eine Mappe mit allen nötigen Informationen. Wenn Sie heute noch etwas vorhaben, beachten Sie bitte die Schließzeit um dreiundzwanzig Uhr.«
»Kann ich noch etwas zu essen bekommen?« Mein Magen meldet erstaunlicherweise wieder einen leise bohrenden Hunger an. Scheinbar wirkt die Seeluft schon.
»Abendbüfett nur bis sieben.«
Doch ein Terrier. Mir wird ganz elend.
Auf der Uhr hinter ihr ist es keine zehn Minuten nach. Ich überlege, wie ich sie erweichen kann.
Da passiert ein Mann die Rezeption. Er geht nicht, er schreitet. Kerzengerade, die Schultern gestrafft, trägt er das Kinn mit dem grauen Spitzbart eine Spur zu hoch. Seine Gegenwart verändert die Atmosphäre im Raum. Sie ist jetzt spürbar gespannt. Die Spieler kommen mir erheblich stiller vor als noch vor einer Minute, und Klementine sortiert plötzlich konzentriert ihren Papierkram.
Niemand außer mir sieht ihn an. Wahrscheinlich schießt der Blitz durch seine bebrillten Augen und erschlägt mich auf der Stelle, wenn er es bemerkt. Aber er beachtet weder mich noch sonst jemanden, blickt geradeaus auf ein nur für ihn erkennbares Ziel und durchmisst die Halle mit ausgreifenden Schritten, denen sein schätzungsweise halb so alter Begleiter der kürzeren Beine wegen kaum folgen kann. Während des Laufens redet der Jüngere ununterbrochen auf ihn ein.
Kurz bevor sie den Springbrunnen erreichen, greift Graubart in die Tasche seines makellos weißen Kittels. Es überrascht mich, dass er einen trägt. Immerhin gibt sich hier alles Mühe, gerade nicht wie ein Krankenhaus zu wirken. Außerdem dachte ich, Kittel wären für Seelenflicker schon lange nicht mehr zeitgemäß. »Zu viel lieber Gott und Über-Ich«, hatte ein befreundeter Journalist mal gewitzelt, der für eine Liste die besten Ärzte und Therapeuten finden sollte.
Graubart drückt dem anderen, ohne ihn auch nur anzusehen oder sein Tempo zu verlangsamen, etwas in die Hand, das eine Medikamentenschachtel sein könnte. Wie gegen eine unsichtbare Wand gelaufen, bleibt der junge Mann stehen und schließt den Mund. Offenbar ist es nicht das, was er sich vom bekittelten Meister erhofft hatte. Der setzt seinen Weg so ungerührt fort, als hätte er ein lästiges Insekt von seinem kahlen Schädel geschnippt, und nimmt die fünf Stufen hoch zum Eingang der Villa. Der Jüngere starrt ihm hinterher, wie er durch das eingefasste Portal verschwindet. Es dauert einen Moment, bis er es schafft, sich abzuwenden und wieder in Bewegung zu setzen.
Als hätte jemand den Finger von der Pausetaste genommen, kommt auf einmal wieder Leben in den Wintergarten. Auch die Kalo findet ihre Stimme wieder. Ich hatte sie ganz vergessen.
»Ach ja, wenn Ihr Therapeut es genehmigt, kriegen Sie bei mir auch eine Telefonkarte, die wir hier aufladen können.« Sie sagt es so beiläufig, als hätten wir die ganze Zeit nett miteinander geplaudert.
»Warum das? Ich meine, warum brauche ich dafür eine Erlaubnis?«
Und wozu gibt es Handys?
Zu einer Antwort kommt sie nicht.
»Rita, meine gute Seele, rufen Sie mir schnell eine Kutsche?«
Neben mir liegen mit einem Mal wie aus dem Nichts gewachsen feingliederige Hände auf der Theke.
Klementines Gesichtsausdruck ist nicht wiederzuerkennen. Was ich eben noch als die verhärteten Züge einer Frau gewertet habe, die nicht mehr viel vom Leben erwartet, hat sich in ein weich gezeichnetes David-Hamilton-Bild verwandelt. Sie lächelt! Und legt sich die Hände an die Wangen, um die Röte zu verbergen.
Neugierig wende ich den Blick von ihr ab und dem Mann an meiner rechten Seite zu. Er fängt ihn auf und zwinkert mich an. Mein erster Gedanke ist, dass sein Gesicht überhaupt nicht zu dem vollen, fast weißgrauen Schopf passt. Es ist zu jung. Glatte, elastische Haut, Grübchen auf den Wangen, wenig Falten, wenn auch ein bisschen viel Schatten um die Augen. Anfang bis maximal Mitte vierzig. Wahrscheinlich überarbeitet. Ein frischer Minzduft geht von ihm aus und kitzelt mich in der Nase, mehr Weichspüler als Aftershave. Er sieht aus wie ein erfolgreicher Feuilletonist, ist in dieser Umgebung aber wohl eher einer der Klinikärzte. Auf jeden Fall ein reinrassiger Schwiegermuttertyp. Mit seinem Lächeln reißt er die Frauen bestimmt reihenweise zu Boden.
Die Kalo hält sich denn auch nur mit Mühe auf ihrem Drehstuhl und grient, was die erschlafften Gesichtsmuskeln hergeben. »Sie wissen doch, dass der Chef das nicht gern sieht.«
»Ach, Rita, diesmal ist es wirklich ein Notfall. Ich stehe heute Morgen vom Frühstück auf und knicke um. Den ganzen Tag humple ich schon herum wie ein alter Dackel.« Dabei sieht er sie auch an wie einer, den Kopf leicht schräg gelegt.
Kriegt er sie wirklich so billig rum?
»Sie wissen genau, dass ich Ärger bekomme, Doktor Seitz. Wir dürfen ihm keine Angriffsfläche bieten.« Unruhig sieht sie sich um, als spürte sie den Blick des Allmächtigen im Nacken. Wenn sie damit den Kerl meint, der eben durch die Halle stolziert ist, kann ich sie verstehen.
»Das bleibt unter uns«, sagt er und reibt die Rechte in einer nervös wirkenden Geste am Oberschenkel des vorgeblich verletzten Beins entlang. »Wenn Sie es ihm nicht sagen. Und …« Er dreht sich zu mir um und lächelt mich mit hochgezogenen Brauen an. Seine Augen haben die Farbe von dunklem Waldhonig. Sie lächeln nicht mit. Etwas Gehetztes glitzert darin.
Ich schüttle nur den Kopf.
»Na also. Unsere junge Unbekannte hält auch dicht.« Dass er mich nicht knufft, ist alles.
Rita Kalo sieht mich kurz an, als hätte ich einen Joint in der Hand und einen Legalize-it-Sticker am Revers. »Warum rufen Sie die Kutsche nicht selbst?«
»Weil mein Büro neben seinem ist.« Dem Tonfall nach sagt er es ihr zum tausendsten Mal, obwohl sie es genau weiß. »Und er ist gerade hochgegangen, oder etwa nicht?«
Entweder der Mann hat hellseherische Fähigkeiten, oder das Spiel genau beobachtet und im Hintergrund auf seine Chance gelauert.
Die Kalo seufzt tief und vernehmlich. »Also gut. Ich sage dem Kutscher, dass Sie draußen vor der Düne warten. Schaffen Sie das mit Ihrem Fuß?«
Seitz haucht ihr einen Kuss über die Theke. »Danke, Rita. Sie sind ein Schatz.«
Eine Erfahrung, die ich nicht teile. Vielleicht fehlt mir dafür das entscheidende Detail.
Rita Kalos glühende Wangen verraten mir, dass ihr Blutdruck gerade wieder gefährlich steigt.
Seitz wendet sich zum Gehen, hält noch einmal inne und wühlt in seiner Jeanstasche. Kurz darauf fördert er einen verformten Marsriegel zum Vorschein, den er mir in die Hand drückt. Eigentlich mache ich mir nichts aus Schokolade, besonders dann nicht, wenn sie körperwarm ist und aussieht, als hätte ein Elefant darauf seinen Nachmittag verbracht, sage aber vor lauter Überraschung trotzdem Danke.
»Sie werden sich schon an die Regeln gewöhnen«, flüstert er mir zu und kommt dabei meinem Ohr so nah, dass er es fast berührt. Mein Nacken fängt an zu kribbeln. »Man muss nur wissen, wie man sie auslegt.« Er reibt sich die Hände an der Jeans ab, streift sein Jackett über und geht langsam zum Ausgang. Das rechte Bein zieht er nach. Verdammt gute Show.
An Kalos Seitenblick erkenne ich, dass ich bei ihr jetzt völlig verschissen habe.
»Bitte unterschreiben Sie mir noch eben die Aufnahmepapiere«, sagt sie mit zuckersüßem Lächeln. »Und wenn Sie etwas brauchen, können Sie sich immer gern an mich wenden.«
Ihre Worte klingen dünn.
Na großartig. Du mich auch.
Trakt Alpha, Rehabilitationsklinik Dunenburg, Juist
»Hallo, ich bin Schwester Agatha und habe heute Nachtdienst. Na, dann wollen wir mal.«
Für eine Erwiderung bleibt mir keine Zeit. Mit mehr Kraft, als ich ihr zugetraut hätte, schnappt sich das Persönchen den größeren meiner beiden Koffer und düst davon. Ich kann ihr auf den Scheitel gucken, was mir selten vergönnt ist. Energisch fegt sie mit ihren geraden Stäbchenbeinen an der Villa vorbei, und ich muss mich ranhalten, um sie einzuholen. Verwaltung, lese ich gerade noch auf einem Schild neben dem Portal. Über den Rücken hinweg wirft Agatha mir eine Umfeldbeschreibung zu.
»Da sind die Therapiezimmer drin, und über den Zugang im Keller kommt man ins Thermalbad, das zwischen Trakt Beta und Gamma unter dem Park liegt. Haben Sie das schon gesehen? Es hat ganz tolle Oberlichter.« Sie wartet meine Antwort nicht ab, dirigiert mich nach rechts Richtung Alphatrakt, der von hier aus am weitesten entfernt liegt. »Auf der Rückseite der Villa ist die Kantine, im Wintergarten. Casino sagen wir hier dazu, klingt mondän, nicht?«
Oder nach gnadenloser Selbstüberschätzung, was ich mit einem vom Kutscher abgeguckten Brummen zum Ausdruck bringe.
»Von da aus hat man einen ganz fantastischen Blick auf den Park. Architektonisch ist die Klinik mit der alten Dunenburg etwas ganz Besonderes. Wo der Name herkommt, dürfen Sie mich aber nicht fragen, ich bin nicht von hier.«
Was sie nicht sagt. Erinnert mich an Berno Hansens Worte. Interessiert mich momentan allerdings nicht die Bohne. Was mich wirklich beschäftigt, ist, dass ich an diesem Tag nicht einem Menschen begegnet bin, der zu meiner Gefühlslage passt. Kein gutes Zeichen.
»Vielleicht weil das Ding so groß ist. Irgendwie beeindruckend. Liegt ja auch in den Dünen. Na, jedenfalls gehen davon alle sechs Trakte ab. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon und Zeta.«
Schwester Agatha redet in einer Tour und zieht mich mit ihrer Stimme hinter sich her wie einen Esel am Nasenring. Mag sein, sie fürchtet, dass ich sonst zusammenbreche. Zu Recht wahrscheinlich.
»Jeder Trakt hat zwei Stockwerke. In Alpha und Beta auf der Nordostseite sind die Patienten untergebracht, also auch Sie. Nur zwanzig Zimmer pro Etage plus das Schwesternzimmer. Alles schön klein und übersichtlich, nicht so anonym wie in diesen Großkliniken. Sie werden sich bestimmt wohlfühlen. In Gamma ist die Sauna und gegenüber, im Westen, sind dann die Physiotherapie, die Ergotherapie und die Gymnastikräume. Alles, was man sonst noch so braucht, Bibliothek, Internetplatz, Tischtennisraum und so weiter, finden Sie in Delta und Epsilon. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Zeta können Sie sowieso gleich wieder vergessen, da wohnt das Personal.«
Schon passiert. Ich höre einfach nicht mehr hin, lasse den Wortstrom an mir vorbeifließen und schaue durch die bodentiefe Verglasung des Wintergartens nach draußen. Auf den Scheiben tummeln sich jede Menge Insekten, schwarze Punkte im Gegenlicht, die den Blick auf den Park dahinter trüben. Vereinzelt kommen uns Patienten entgegen. Fast alle wirken in sich gekehrt, nur hier und da treffen sich unsere Augenpaare. Die meisten gucken rasch wieder weg.
Vor einem mannshohen Busch, der kurzzeitig die Aussicht verdüstert, wirft das Glas mein Spiegelbild zurück. Wäre ich nicht so müde, hätte ich wahrscheinlich einen Satz nach hinten gemacht. Ich sehe verboten aus. Wie eine wandelnde Untote, mit hohlen Wangen und Augen, die sich in den Schädel zurückgezogen haben. Mir wird gleichzeitig heiß und kalt, und ich bewege mich bloß deshalb noch, weil ich gleich eine Tür hinter mir schließen kann.
Der Weg bis zu meinem Zimmer kommt mir endlos vor, dabei sind wir keine zwei Minuten unterwegs. Inzwischen muss ich mich bei jedem Schritt mächtig konzentrieren, damit ich mir meinen kleinen Trolley nicht ständig in die Hacken ziehe, und zwinge mich dann in einen automatischen Rhythmus, den ich wahrscheinlich bis Tibet laufen könnte.
»Da sind wir. Station Alpha.« Agatha stoppt ihr Bandwurmgerede mitten in meine Apathie hinein und sieht mich fragend an. »Oben oder unten?«
»Hm?«
»Wie lautet denn Ihre Zimmernummer?«, fragt sie, die ich für den Privatgebrauch künftig nur noch Schwadronata nennen werde.
Ich lenke den Fokus auf das Ding, das sie hier Schlüssel nennen und das ich die ganze Zeit über mit der freien Hand umklammere wie den Knopf für den Schleudersitz. Es ist ein rundes, bauchiges Stück Plastik, so groß wie ein Euro und mit aufgedrucktem Alphazeichen. »Einfach die Zimmernummer vor das Schloss halten«, hatte die Kalo gesagt. Tatsächlich. Auf der Rückseite ist eine Zahl eingraviert.
»Neun.«
»Also Erdgeschoss. Mit Alpha haben Sie aber richtig Glück!« Schon wieder ist sie mir zehn Schritte voraus. »Der Patiententrakt liegt am nächsten zum Meer. Alle Zimmer haben eine wunderschöne Aussicht auf den Park, und Ihres liegt am äußersten Ende. Wenn die Düne nicht wäre, könnten Sie fast ins Wasser greifen.«
Oder das Wasser nach mir.
Trakt Alpha, Zimmer 9, Rehabilitationsklinik Dunenburg, Juist
»Und denken Sie an die Blutabnahme morgen früh. Um halb sieben. Wir erwarten Sie nüchtern und pünktlich!« Agathas Stimme dringt dumpf und anklagend durch die Tür, die ich ihr soeben vor der Nase zugemacht habe.
Nüchtern. Klar, kein Problem mit nur einem Marsriegel als Abendmahl. Über das Hungergefühl bin ich inzwischen sowieso längst wieder weg. Allerdings hätte ich nichts dagegen, mich auf der Stelle sinnlos zu betrinken und mir den Hals kratzig zu rauchen. In der Klinik ist natürlich offiziell nichts aufzutreiben, und Juist-City ist im Moment so gut erreichbar wie der äußere Ring unseres Sonnensystems.
Eigentlich alles genau so, wie meine Ärztin es mir eingehämmert hat. In reiner Seeluft an Leib und Seele genesen, so stand es auch auf der Homepage. Ich weiß schon jetzt, dass mein Vorsatz, mir hier Rotwein und Nikotin abzuerziehen, auf eine harte Probe gestellt werden wird, denn durch das auf Kipp geöffnete Fenster dringt verräterisch der Duft brennenden Tabaks. Ich kämpfe gegen den Impuls, meinen offenbar auf die Regeln scheißenden Nachbarn anzuschnorren. Einzig der Gedanke, dass ich dann auch noch den letzten Rest meiner Würde los wäre, hält mich davon ab.
Inzwischen hat Agatha gemerkt, dass sie keine Antwort mehr erhalten wird, und tritt endlich den Rückzug an. Mit einem Ohr an der Tür verfolge ich, wie das Flappen ihrer Birkenstocksandalen im Gleichklang mit ihrem ärgerlichen Gemurmel verebbt. Ich seufze, weil ich weiß, dass es so nicht geht, doch ich konnte sie keine Sekunde länger ertragen.
Der Qualm schlängelt sich jetzt in dünnen Fäden an dem fahlen Vorhang vorbei in mein Zimmer. Ich gehe zum Fenster, und obwohl ich es extra laut zuknalle, nagt die Versuchung weiter an mir. Mit pantomimisch übertriebener Aufmerksamkeit wende ich mich meinem Zimmer zu, um das Verlangen auszublenden. Auch keine gute Idee.
Das also ist Alpha 9. Willkommen im Raumschiff Dunenburg. Die Besatzung ist leider komplett irre, aber lassen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht anmerken, dass Sie das wissen. Und nun guten Flug!
Wenn ich Angst kriege, werde ich blödsinnig und tue so, als wäre alles nur ein Film. Dieser hier ist gar nicht lustig.
Beklommen nehme ich das Zwielicht in mich auf, das durch Terrassentür und Fenster dringt. Noch immer zu viel, um das abgeschabte Parkett zu verheimlichen. Darauf steht in der Mitte des Raums ein buckliger Sessel. Die Bodenregale und das Bett sehen aus, als würden sie sich vor ihm an die Wände drücken. Ich schiebe dieses Monster so weit wie möglich an die Seite. Alles ist viel zu wuchtig für den Raum. Trotzdem erfasst mich ein Gefühl tiefer Leere, wenn ich die kahlen Wände und Borde sehe. Der tote Fernsehbildschirm spiegelt schwach mein blasses Gesicht.
Das Zimmer ist erheblich schlimmer, als ich erwartet hatte. Ohne jede Seele. Hier fühlt es sich wie Klinik an, wie Einsamkeit und Krankheit.
Ich wappne mich für das Bad. Auf dem Weg dorthin laufe ich gegen eine verchromte Säule, die ich bis eben noch gar nicht wahrgenommen hatte. Sie steht genau im kürzesten Laufweg zwischen Bett und Nasszelle und stützt ein über dem Schrank in den Raum hineingezogenes Kofferregal wie ein Hochbett. Unten wäre für die Trolleys auch kein Platz.
Ich reibe mir die Schulter und will nur noch eins – raus an die Luft und runter zum Strand. Sollen die Koffer doch warten. Mit dem Öffnen der Glastür schwappt mir das ferne Rauschen des Meeres entgegen. Mir ist, als könnte ich das Salz auf der Zunge schmecken.
Auf der Terrasse zögere ich. Die hintere Tür lässt sich von außen nicht verriegeln. Aber was soll man mir noch nehmen? Das halbe Dutzend Bücher, das ich in der wahnwitzigen Hoffnung mitgeschleppt habe, wenigstens wieder lesen zu können, wo an Schlaf schon seit Monaten nicht mehr zu denken ist? Oder die Klamotten, die ich eingepackt habe, um mich unsichtbar zu machen zwischen all den angeschlagenen Persönlichkeiten in verschiedenen Stadien der Verzweiflung? Egal. Ich setze darauf, dass sie alle mehr als genug mit sich und der Aufgabe beschäftigt sind, für das tägliche Rennen wieder sattelfest zu werden, um sich für meinen Kram zu interessieren.
»Zuziehen reicht.«
Ich fahre zusammen und blicke in die Richtung, aus der die Stimme verklungen ist. Links neben mir ragt ein Kopf aus Alpha 8, das Gesicht halb verdeckt von kinnlangen dunklen Spaghettihaaren.
»Habe ich laut gesprochen?« Ich mache mir keine Mühe, meinen Ärger zu verbergen.
»Entschuldigung. Tut mir leid. Ehrlich. Ich wollte dich nicht erschrecken. Und ich kenne das Stirnrunzeln. Am Anfang war ich auch so skeptisch.«
»Ach, und dann hat sich das gelegt?«
»Ja. Hier geht keiner an deine Sachen. Mir ist in drei Wochen nichts weggekommen.«
»Na, dann liegt’s vielleicht an deiner positiven Ausstrahlung.«
Irritiert schaut sie mich an, dann senkt sie den Blick.
»Schon gut«, lenke ich ein. »War alles ein bisschen viel heute.«
Vorsichtig wagt sie sich aus der Deckung, tritt aus ihrem Zimmer heraus. »Verstehe ich. Hier sind wirklich alle ganz nett. Na ja, bis auf wenige Ausnahmen. Die gibt’s wohl überall. Ich bin übrigens Mascha. Mascha Holm.«
Sie ist ungefähr so groß wie ich, aber deutlich schmaler. Fast anorektisch wirken ihr dünnes Gelenk und die magere Hand, die sie mir über die kniehohe Terrassenmauer hinweg mit einem schüchternen Lächeln entgegenstreckt.
Das ändert alles. Ich ergreife sie, weil Mascha mir plötzlich schutzbedürftig vorkommt, und sage ihr meinen Namen, obwohl ich mir nach Wiebke Zurückhaltung geschworen habe. Irgendwie rührt mich ihre Statur. Sie hat etwas von einem unschuldigen kleinen Jungen. Verpackt allerdings in eine knallenge Jeans und eine veilchenfarbene Bluse, die einen schmalen Streifen heller Haut über ihrer Hüfte durchblitzen lässt.
»Okay. Ich geh dann mal, Mascha. Wir sehen uns.«
»Pass auf dich auf«, sagt sie und sieht mit einem Stirnrunzeln zu, wie ich auf den Rasen trete, zu dem sich meine Terrasse öffnet. Herrje. Warum meinen heute bloß alle, sie müssten mir eine Warnung mit auf den Weg geben?
Park und Strand der Rehabilitationsklinik Dunenburg, Juist
Der Klinikpark, der das gesamte Klinikareal umschließt, ist weitläufiger, als ich vermutet habe. Nach Osten wird er durch einen kleinen Mischwald begrenzt, der knapp hundert Meter vor meinem Zimmer beginnt, nach Norden von bewachsenen Dünen.
Ich laufe ein paar Schritte bis zum Ende von Trakt Alpha und passiere dabei das letzte Apartment. Die Terrasse sieht verlassen aus. Keine Wäsche, die über dem Mäuerchen trocknet, dafür ein Liegestuhl, der zusammengeklappt an der Wand lehnt, als hätte ihn ewig niemand benutzt. Merkwürdig. Ich hätte schwören können, dass der Zigarettenqualm von dort gekommen ist. Fenster und Tür sind jedoch zu, die geschlossenen Vorhänge trotzen meinem neugierigen Blick.
Hinter dem Gebäude öffnet sich das Gelände nach Norden. Sandige Pfade schlängeln sich über Rasenflächen hinweg labyrinthartig in kleine Buschgruppen hinein. Die untergehende Sonne wirft ihre Strahlen zwischen den Ästen hindurch und versprengt Lichtpunkte im Unterholz. In unregelmäßigen Abständen laden hölzerne Sitzbänke mich ein, der Erschöpfung endlich nachzugeben. Doch meine größere Sehnsucht gilt dem Meer, zu dem ich einen Durchgang suche.
Ich halte mich rechts und gelange zu einer Bank, die hinter verwildertem Gestrüpp verborgen ist. So etwas zieht mich magisch an. Ich steuere auf sie zu, und als hätte ich es geahnt, führt von hier aus ein verborgener, nur wenig ausgetretener Pfad direkt zu den Dünen.
Je weiter ich ihm folge, desto mehr lichtet sich das Buschwerk, und der Boden geht in Sandhügel über, auf denen sich Krähenbeerteppiche angesiedelt haben. Schmetterlinge flattern an mir vorbei, unter denen ich nur die Pfauenaugen benennen kann und die ich so nah am Meer nicht vermutet hätte. Dann entdecke ich die Ursache. Ein riesiger violett blühender Sommerflieder ist über und über von den bunt flatternden Insekten bedeckt und leuchtet in der tief stehenden Sonne. Ich bleibe stehen und spüre meine Kehle enger werden. Wie lange ist es her, dass ich so etwas Schönes wahrgenommen habe?
Es dauert, bis ich mich losreißen und meinen Weg entlang der mannshohen Hügel des Dünenbands fortsetzen kann. Bald werde ich ein zweites Mal belohnt und stoße auf einen Spalt zwischen den Sandbergen. Wie ein Fenster gibt er den Ausblick auf metallicblaues Wasser frei. Lichtreflexe tanzen darauf. Sofort packt mich die Magie der anrollenden Wellen mit einer Intensität, als wäre ich wieder ein Kind. Hastig streife ich meine Ledersandalen ab, kremple die Hosenbeine bis zu den Knien hoch und betrete den Holzsteg, der durch die Dünen zum Strand führt.
Ich kann es kaum erwarten, die Sandkörner unter meinen Füßen zu spüren. Ich renne los, stoppe am Ende der Holzplanken jedoch abrupt.
Vor mir liegt ein breites, feinsandiges Band. Von hier bis zum Wasser sind es mindestens zweihundert Meter. Rechts kann ich den Strand bis zum Ostende der Insel verfolgen. Links, in Richtung der Orte, erstreckt er sich, so weit mein Blick reicht. Und was ich dort sehe, hat mich stutzen lassen. In der Ferne, jenseits einer mir nicht erkennbaren Trennlinie, tummelt sich menschliches Strandleben. Ich dagegen stehe in einer Bannmeile – naturbelassen und bar jeglicher touristischer Nutzung. Keine Strandkörbe und keine Imbissbuden, nicht einmal Mülleimer finden sich hier. Lediglich ein altes Volleyballnetz schaukelt im Wind, begleitet vom leisen Quietschen seiner rostigen Befestigungsschlaufen. Abgesehen von ein paar reglosen Gestalten, die bäuchlings auf Handtüchern liegen und ihrer Hautfarbe nach so aussehen, als hätten sie sich mithilfe von Brandbeschleunigern zu Tode geröstet, sieht die Ödnis vor dem Klinikgelände aus wie evakuiert.
Ich zögere. Soll ich mir das antun? Mein Bauch sagt mir, dass mein geplanter Spaziergang wohl eher ein Spießrutenlauf wird als die ersehnte Erholung, sobald ich das Treiben im Westen erreiche. Die Laufrichtung, aus der ich komme, wird mich sofort enttarnen.
Noch während ich mit mir ringe, wenigstens bis zum Wasser zu gehen, vibriert es in meiner Jeans. In dunkler Vorahnung hole ich das Smartphone aus der Tasche. Eine Nachricht ist eingegangen. Natürlich ist sie von Marty, dem Menschen, an den ich jetzt als Allerletztes erinnert werden möchte.
Langsam bewege ich meine Füße vom Steg und halte auf die auslaufenden Wellen zu. Ich komme nicht weit. Mein Kopf blockiert. Den ganzen Tag über ist es mir halbwegs gelungen, ihn aus meinen Gedanken zu verbannen, sobald er sich hineinzuschleichen versucht und sich sein Gesicht vor meinem geistigen Auge zu manifestieren begonnen hatte. Jetzt ist alles wieder da, und ich habe keine Kraft mehr mich zu wehren. Ich lasse mich in den Sand fallen, will die Nachricht nicht lesen, nicht erinnert werden und öffne sie trotzdem.
Er erkundigt sich, ob ich gut angekommen bin. Aus jedem seiner Worte trieft der Vorwurf, dass ich mich nicht gemeldet habe. Sofort mache ich mich steif. Am liebsten würde ich das Handy im weiten Bogen ins Meer werfen. Aber erstens komme ich nicht bis dahin, weil mich noch einige Meter von der Wasserlinie trennen und ich schon über weit geringere Distanzen beim Jugendsportabzeichen gescheitert bin. Zweitens macht es nichts besser.
Ihm zu antworten, kommt nicht infrage. Ich packe das Handy weg. Auf halbem Weg zur Hosentasche halte ich inne. Meine Augen haben eben etwas wahrgenommen, das mein Hirn erst jetzt erreicht. Marty hatte die WhatsApp schon um kurz vor sieben abgeschickt. Erhalten habe ich sie erst jetzt, fast eine Stunde später, hier am Strand. Das bedeutet, dass ich in der Klinik keinen Empfang habe. Deshalb also der Witz mit den Telefonkarten, die man wahrscheinlich völlig problemlos vom Therapeuten »verschrieben« kriegt, wenn man nur bereit ist, ein kleines Vermögen dafür zu zahlen. Geld vor Genesung. Das Gleiche wie überall.
Keine Ahnung, warum ausgerechnet diese Erkenntnis mich wieder in die Senkrechte treibt. Es ist wohl der berühmte Tropfen, der das Fass an diesem Tag zum Überlaufen bringt. Oder das Meer, das mir rauschend seine Energie zuschaufelt. Zusammen mit der Erinnerung, dass ich mal jemand war und hierhergekommen bin, um wieder jemand zu werden. Wenn ich jetzt aufgebe und mich der Verzweiflung überlasse, haben sie endgültig gewonnen, die Schaffner, die Kalos und die Wiebkes dieser Welt und all die anderen Buchhalter des Wahnsinns.
Von einer wilden Wut getrieben springe ich auf und marschiere los nach Westen. Soll doch glotzen, wer glaubt, er wäre auf der sicheren Seite.
Strand, Juist
Zügig laufe ich gegen meinen inneren Aufruhr an und verfolge die Möwen, wie sie im Sinkflug durch die Wasseroberfläche brechen und mit zappeligen kleinen Fischen im Schnabel Kurs auf den blassgoldenen Himmel nehmen. Kaum spüre ich das Wasser an den Füßen, werde ich klarer. Es ist kalt und erdet mich, macht meine Schritte gleichmäßiger und lässt meine Anspannung im Rhythmus der Wogen allmählich abfließen. Ausläufer der Wellen umschließen meine Knöchel und ziehen beim Zurückweichen den feuchten Sand unter meinen Fußsohlen mit sich. Ich drehe mich um und schaue zu, wie das Wasser die entstandenen Abdrücke gleich wieder löscht.
Ein paar Schritte weiter zucke ich zurück. Gerade noch kann ich verhindern, meinen Fuß aufzusetzen. Erschrocken starre ich auf das fleischfarbene Etwas im Sand. Erst auf den zweiten Blick erkenne ich zwischen Muscheln, Algen und Treibholz, was es ist – ein abgetrennter Kopf. Sieht aus wie der von Ken, dem Dauerfreund von Plastik-Barbie. Er lächelt immer noch, auch ohne seinen Astralkörper. Ich bringe es nicht über mich, auf ihn zu treten, und mache einen Bogen. Mein Puls beruhigt sich nur mäßig.
Eine halbe Stunde später erreiche ich den offiziell zum Baden zugelassenen Strandabschnitt und betrete ihn, als wäre nichts dabei.
Blicke folgen mir, der Exotin, die sich an den halb nackten Leibern der Sonnenanbeter vorbeibewegt, während die noch die letzten warmen Strahlen einzusaugen versuchen.
Die meisten von ihnen sind bereits in Aufbruch begriffen, raffen ihre Sachen zusammen, packen grelle Schirme, bunt gemusterte Badehosen und blanke Busen ein. Der Rest hockt sich zwischen den Strandkörben so dicht auf der Pelle, dass für Intimabstand kein Platz ist.
Was hier an Muscheln lag, ist unter dem Andrang, der tagsüber geherrscht haben muss, zermahlen oder in Burgen und Gräben verbaut worden. Der Sand drum herum sieht aus wie planiert. Diverse Schilder von Hunde verboten bis Achtung, gefährliche Strömung! scheinen ausschließlich als praktische Halter für Taschen, Strandsegelverpackungen und trocknende Handtücher zu dienen. Ich mag mir nicht vorstellen, was in wenigen Tagen hier los sein wird, wenn die Saison beginnt, und bin froh über die Einsamkeit des Strands vor der Klinik, auch wenn sie mich brandmarkt.
Am Ende zahlt sich meine Strategie aus, einfach stoisch weiterzulaufen. Gelegentlich muss ich einem Frisbee ausweichen, bevor es mir den Kopf rasiert. Eine knappe Stunde später ist der Strand wie leer gefegt und wird nur noch von Möwen bevölkert, die den Sand dort, wo die Kühltaschen standen, nach Krümeln durchpflügen. Erst als das Billriff in Sichtweite kommt, drehe ich um und mache mich auf den Rückweg. Ein gutes Stück, bevor ich wieder am Klinikabschnitt bin, setze ich mich in den abgekühlten Sand und schaue dem Mond dabei zu, wie er an Farbe gewinnt und genauso einsam in der Luft hängt wie ich.
Ein Geräusch lässt mich hochfahren.
Eindeutig ein Stöhnen.
Wie stürzendes Geröll bricht es in meine stille Versenkung. Erst leise, dann immer eindringlicher.
Ich bin doch nicht so allein, wie ich dachte. Dem Schreck folgt die Neugier. Aus der letzten Strandkorbgruppe neben mir dringt verräterisches Keuchen. Helle Laute fallen unregelmäßig darin ein. Wegen des Schattens der Markise sehe ich keine Gesichter, nur zwei Beinpaare und einen nackten Hintern, der sich rhythmisch bewegt. Er leuchtet weiß im schwindenden Licht. Der Rest ist gut gebräunt.
Vor dem Korb ist eine Decke ausgebreitet, daneben läuft, halb unter Kleidungsstücken verborgen, eine Flasche Rotwein aus und befleckt den Sand. Was für ein Frevel.
Die beiden sind so beschäftigt, dass sie mich nicht bemerken. Ob es Psychos sind? Ich ducke mich und schleiche mit abgewandtem Blick vorbei.
Die Frau schreit. Reflexhaft zucke ich herum. Dann wende ich mich ab und renne. Meine Zunge schmeckt bitter. Musste das sein? Ich hatte mich gerade ein bisschen gesammelt. Das Meer wollte ich sehen, sonst nichts.
Erst am Klinikstrand werde ich langsamer. Mit gesenktem Kopf stapfe ich zum Holzsteg zurück. Am Rand meines Blickfelds nehme ich wahr, dass in einiger Entfernung zum Aufgang ein paar Leute sitzen. Sie lachen leise und reichen Flaschen herum. Ich ignoriere sie und konzentriere mich stattdessen darauf, nicht auf eine der Muscheln zu treten, die mit ihren aufgesperrten Mäulern auf meine Füße lauern. Durch den dunklen Filter der beginnenden Nacht kann ich nur noch ihre Schemen ausmachen.
Ich dagegen bin zu einer Muschel geworden, die sich wohl nie wieder öffnen wird.
Park der Rehabilitationsklinik Dunenburg, Juist
Oben angelangt, reibe ich mir die Füße ab, an denen der Sand klebt. Dann ziehe ich meine Sandalen an und sehe mich ratlos um. Setz mich irgendwo aus, und ich verhungere. Meine Orientierung ist ungefähr so gut ausgeprägt wie die Sehfähigkeit eines Maulwurfs. Glücklicherweise entdecke ich dort, wo ich Alpha vermute, ein paar helle Kegel und gehe ihnen entgegen.
Kurz bevor ich die versteckte Bank erreiche, stoppe ich jäh. Schon seit ein paar Schritten mahle ich mit dem Kiefer. Jetzt realisiere ich, warum.
Da sitzt jemand, vornübergebeugt. Den breiten Schultern nach zu urteilen, ein Mann. Unschlüssig verharre ich. Ich muss an ihm vorbei, weil ich mich mit den offiziellen Wegen noch nicht auskenne. Aber ich will niemandem begegnen. Schon gar nicht allein in einem zwielichtigen, menschenleeren Park. Abgesehen vom entfernten Rauschen der Brandung hinter mir, ist es vollkommen still. Die Gruppe am Strand ist für Hilferufe zu weit weg.
Besser kein Risiko eingehen. Ich finde einen anderen Weg. Vorsichtig setze ich einen Fuß zurück. Ich bin überzeugt, kein Geräusch verursacht zu haben, doch die Gestalt auf der Bank fährt mit einem Satz hoch und sieht in meine Richtung, als hätte sie meine Anwesenheit instinktiv erfasst.
Unsere Blicke treffen sich.
Sofort rutscht mir das Herz in die Hose. Die Augen des Mannes sind so weit aufgerissen, dass mich ihr Weiß trotz des schwachen Mondlichts anspringt. Die Pupillen schwimmen darin wie verlorene Seelen. Wirre kurze Haare umrahmen das starre Gesicht. Es ist kantig und grob zerfurcht, voller tiefer Schatten. Die Art, wie er mich mit halb geöffnetem Mund anglotzt, reglos und ohne zu blinzeln, lässt meine Poren schrumpfen und jagt mir jedes Härchen in die Höhe.
Der ist nicht vor dir erschrocken, schießt es mir durch den Kopf, der ist irre.
Ich zögere keine Sekunde länger, drehe mich um und renne zurück zum Strandaufgang. Die Büsche prügeln mir ihre kleinen Ruten ins Gesicht. Ich achte nicht auf sie, laufe einfach weiter zum Wäldchen. Vor der letzten Düne schwenke ich nach rechts und flüchte halb blind vor Panik an der Baumlinie entlang. Weiter in dieser Richtung müsste ich zur Wiese vor meinem Zimmer gelangen. Falls nicht, habe ich ein Problem.
Abgebrochene Ästchen bohren sich durch die Ritzen meiner Sandalen. Als ich endlich das Gras erreiche, kann ich kaum noch atmen. Erst auf meiner Terrasse drehe ich mich um.
Hinter mir ist nichts als Schwärze.
Mit letzter Kraft drücke ich die Tür nach innen auf und stolpere in mein Zimmer. Sofort verriegle ich alles und reiße die Vorhänge zu. Meine Hände zittern mit meinen Beinen um die Wette, während ich mich im Dunkeln zum Bett taste. In voller Montur werfe ich mich darauf und ziehe mir die Decke über den Kopf.