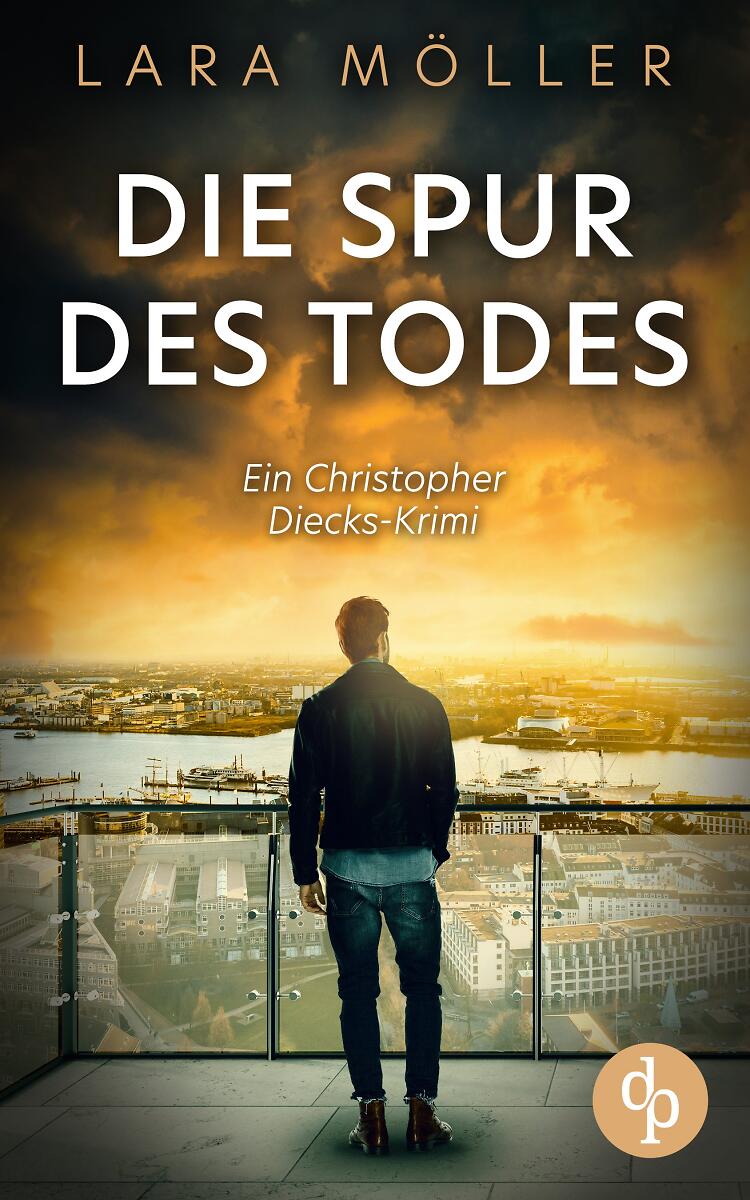Prolog
15. August 2014
Im Waggon herrschte Partystimmung und ein babylonisches Sprachgewirr. Es roch nach verschüttetem Bier. Eine Gruppe Jugendlicher grölte Fragmente eines nicht identifizierbaren Liedes. Die Mädchen in kurzen Röcken und knappen Oberteilen, die Jungen in Jeans und Marken-Shirts.
Christopher stand im Gedränge und blickte in den dunklen Tunnel hinaus. Er sehnte sich nach einer Dusche und seinem Bett.
Wenige Minuten später spuckte die S-Bahn an der Station Reeperbahn fast ihren gesamten menschlichen Inhalt aus.
Er folgte dem Menschenstrom, ging die Treppe hinauf und stellte fest, dass er auf der falschen Straßenseite gelandet war. Er hätte den linken Ausgang nehmen müssen. Seit Jahren ging er nach links. Warum …?
Jemand stieß ihn von hinten an. Durfte man nicht mal zwei Sekunden in Ruhe stehen bleiben, um sich zu orientieren?
Plötzlich wurde er schmerzhaft im Genick gepackt.
„Ein Mucks, und ich knall dich ab!”, zischte ihm eine Stimme ins Ohr. Ein harter Gegenstand bohrte sich in seine rechte Seite.
Kapitel 1
Zwei Jahre zuvor
Seine Nachbarin schlug die Wohnungstür so kräftig zu, dass Christopher es bis in die Küche hörte. Verwundert stellte er die Kaffeekanne ab und lauschte. Ihre Schritte entfernten sich schnell. Klangen gehetzt.
Jenny Schumann war eine unscheinbare junge Frau, die lediglich ein hervorstechendes Merkmal besaß: Sie passte nicht nach St. Pauli. Es gab Menschen, die den Stadtteil überstreiften wie einen Handschuh; andere wurden mit dem bunten, lauten, manchmal streng riechenden Treiben nie warm. Jenny bewegte sich wie ein Fremdkörper durch die Straßen. Mit hochgezogenen Schultern und gesenktem Blick huschte sie an Touristen, Obdachlosen und St. Paulianern vorbei wie eine scheue Katze auf der Suche nach einem Versteck. Sie wohnte seit drei Monaten auf derselben Etage wie er, und Christopher fragte sich mittlerweile, was sie den ganzen Tag trieb. Er ging zwei Jobs mit unterschiedlichen Arbeitszeiten nach. Wenn er nicht im Restaurant seines Stiefvaters kellnerte, schleppte er Möbel für ein Umzugsunternehmen. Trotzdem bemerkte er Jennys ungewöhnliches Kommen und Gehen. Sie verließ die Wohnung meist nur für wenige Stunden. Sehr früh oder spätabends wagte sie sich aus dem Haus. Offensichtlich besaß sie wenige Kleidungsstücke, die sie jedoch geschickt kombinierte. Nicht, dass er ihr hinterherspioniert hätte. Er besaß lediglich ein Auge für Details und ein gutes Gedächtnis. Außerdem faszinierten ihn Geheimnisse, und die blonde, blasse, höfliche Jenny mit dem stets angestrengt wirkenden Lächeln gab ihm Rätsel auf.
Er nahm seinen Kaffeebecher mit ins Wohnzimmer und trat ans Fenster. Sein Blick wanderte über die Umgebung und fiel auf einen dunkelhaarigen Mann in einer braunen Jacke, der den Hamburger Berg entlangschlenderte. Er kam auf die Reeperbahn zu und filmte dabei seinen Weg mit einem Camcorder. Kein ungewöhnlicher Anblick. Viele Touristen hielten ihre Ausflüge auf den Kiez filmisch fest. Beim Hotel Hamburg-New York, das gegenüberlag, blieb der Mann stehen. Kurz studierte er einen Aushang neben der Eingangstür, wandte sich um und richtete den Camcorder auf Christophers Haus. Der vierstöckige, dunkelrote Bau mit dem weißen Stuck und den winzigen Balkonen gehörte zwar zu den schöneren Gebäuden in der Straße, gefilmt wurde er allerdings selten.
Er verfolgte, wie der Mann die Straße überquerte. Für einige Sekunden verschwand er im Hauseingang, tauchte wieder auf und entfernte sich nach rechts, weg von der Reeperbahn. Während er ging, verstaute er den Camcorder in der Jackentasche. Merkwürdiges Verhalten für einen Touristen.
Christopher trank den Kaffee aus und machte sich für die Arbeit fertig. Seinem Stiefvater Henry gehörte ein Restaurant in Altona. Bei diesem herrlichen Wetter verdiente er mit dem Kellnern deutlich mehr als mit der Arbeit für das Umzugsunternehmen. Die sommerlichen Temperaturen versetzten die Gäste in Spendierlaune, das wirkte sich positiv auf die Trinkgelder aus.
Als er nach einer hektischen Schicht gegen Mitternacht aus der S-Bahn stieg und im Menschengewimmel heimwärts ging, war sein Portemonnaie prall gefüllt. Auf dem Hamburger Berg tobte das Leben. Hier feierten all jene, denen die Reeperbahn zu kommerziell geworden war. Musik dröhnte aus offenen Kneipentüren und Fenstern. Auf den Bürgersteigen standen unzählige Tische, Bänke und Stühle.
Er wechselte auf die Fahrbahn, die wie üblich inoffiziell zur Fußgängerzone erklärt worden war. Ein Taxi bahnte sich im Schritttempo einen Weg an den Menschen vorbei. Christopher ließ den Wagen passieren, während er seinen Hausschlüssel aus der Hosentasche hervorkramte.
In der Wohnung schlug ihm die stickige Wärme des Tages entgegen. Trotz des Geräuschpegels öffnete er alle Fenster. Begleitet vom Musikmix, dem Lachen und Stimmengewirr, zog er sich um und aß eine Kleinigkeit. Beim Zähneputzen stellte er sich ans offene Wohnzimmerfenster und blickte hinunter auf das nächtliche Treiben. Wer brauchte einen Fernseher, wenn das Unterhaltungsprogramm direkt vor der eigenen Haustür ablief? Kurz vor eins schloss er die Fenster und ging schlafen. Zum Glück lag das Schlafzimmer im hinteren Teil der Wohnung. Zwei geschlossene Türen und ein Flur verwandelten den Klangteppich von der Straße in ein einschläferndes Murmeln.
Am folgenden Nachmittag, auf dem Rückweg vom Einkaufen, entdeckte Christopher wieder den Mann mit dem Camcorder. Zumindest war er sich sicher, denselben Kerl vor sich zu haben. Die Haare und die Jacke passten. Diesmal lehnte er neben dem Eingang eines Tattoostudios und blickte konzentriert auf sein Handy. Während Christopher mit seinen Einkaufstüten die Straße überquerte, bemerkte er, wie der Mann das Handy hob und auf das Haus richtete. Oder auf ihn? Er sah prüfend über die Schulter. Der Beobachter hielt das Handy ans Ohr. Er schien zu telefonieren.
Als Christopher eine halbe Stunde später aus dem Haus kam, um zur Arbeit zu fahren, war der Mann verschwunden.
Eine weitere stressige Schicht im Restaurant lenkte seine Gedanken von dem Vorfall ab. Müde, doch zufrieden mit seiner Trinkgeldausbeute, schloss er gegen Mitternacht die Haustür auf. Der Monat war erst zur Hälfte vorbei, und auf seinem Konto lag bereits die Miete für den nächsten Monat. Es blieb sogar ein Wohlfühlpolster für unvorhergesehene Ausgaben. Sein Stiefvater plante ihn für die kommenden Wochenenden fest ein. Wenn sich das schöne Wetter hielt und die Trinkgelder weiter flossen, würde er demnächst ein paar Tage freinehmen können.
Die Haustür fiel hinter ihm ins Schloss und sperrte den Lärm der Feiernden aus. Er hob die Hand an den Lichtschalter, als die Treppenhausbeleuchtung scheinbar von selbst anging. Von oben hörte er schnelle Schritte. In der ersten Etage kam ihm Jenny entgegen, eine Reisetasche über der Schulter. Sie rannte ihn fast um.
„Vorsicht.” Christopher lachte. „Sonst endet der Urlaub, bevor er begonnen hat.”
„Wie bitte?” Sie sah ihn erschrocken an, als hätte er sie bei etwas Unanständigem ertappt.
„Na, die Reisetasche.”
„Ach so.” Jennys Körpersprache drückte Nervosität und Anspannung aus. „Ja, ich muss los.” Sie schob sich an ihm vorbei.
„Wo soll es denn hingehen?” Um diese Zeit?
„Zu Freunden”, rief sie ihm über die Schulter zu.
Kurz darauf fiel eine Tür zu. Allerdings war es nicht die schwere Eingangstür, sondern die Tür zum Innenhof. Verwundert blickte er Jenny nach.
Am Sonntag hatte Christopher tagsüber frei. Er nahm sein Frühstück mit auf die breite Fensterbank im Wohnzimmer, streckte die Beine aus und lehnte sich gegen ein weiches Kissen. Unten auf der Straße ging es geruhsam zu. Tische, Stühle und Bänke waren verschwunden. Vor dem Hotel spritzte eine Frau den Bürgersteig mit einem Gartenschlauch ab. Beim Sexkino weiter die Straße hinunter lungerte dieselbe Vierergruppe herum, die dort jeden Sonntag abhing: zwei Männer und zwei Frauen in ungepflegter Kleidung, die sich mit fahrigen Bewegungen und osteuropäischem Akzent in einer aggressiv wirkenden, doch durchaus liebevoll gemeinten Weise anpöbelten. Sie besaßen keinen Lautstärkeregler und unterhielten die gesamte Nachbarschaft mit ihren sinnlosen Geschichten. Dabei konnte die Stimmung jederzeit kippen. Harmlose Gespräche endeten schlagartig in körperlichen Auseinandersetzungen, die in tränenreiche Freundschaftsbekundungen übergingen. Oder andersherum.
Nach einem Blick auf die Uhr beendete er das Frühstück und schnappte sich seine Sporttasche. Er war zum Fußballtraining verabredet.
Heute saß der Mann, den er mittlerweile „Beobachter“ getauft hatte, auf dem Fahrersitz eines silbernen Viertürers und las Zeitung.
Er beschloss, den Typen genauer in Augenschein zu nehmen. Als er scheinbar zufällig auf der Fahrbahn an dem Wagen vorbeiging, hob der Mann den Blick und sah ihn an. Anfang vierzig, rundes, harmlos wirkendes Gesicht, dunkle Schatten unter den braunen Augen. Gleich darauf widmete sich der Beobachter wieder seiner Zeitung.
Christopher ging weiter. Bis zur S-Bahn-Station kämpfte er gegen den Drang an, umzudrehen und den Fremden zu fragen, warum er vor den Häusern anderer Menschen herumlungerte.
Beim Fußballtraining erzählte er seinem besten Freund Jacobi von der Geschichte. Der konnte sich ebenfalls keinen Reim darauf machen. Ihre Mutmaßungen reichten vom Stalker bis zum Geheimagenten. Jacobi riet ihm, sich von dem Typ fernzuhalten.
Zwei Stunden später kam Christopher verschwitzt und erschöpft um die Ecke in den Hamburger Berg. Der silberne Viertürer stand an derselben Stelle. Keine Spur von dem Beobachter. Die Zeitung lag zusammengefaltet auf dem Armaturenbrett. Sie bedeckte teilweise einen runden schwarzen Gegenstand. Eine Webcam, deren Kameraauge auf den Eingang von Christophers Wohnhaus gerichtet war. Es reichte! Er zog sein Handy aus der Hosentasche und wählte 110.
„Hey, was machst du da?” Aufgeregt kam der Beobachter aus dem Eingang des Hotels Hamburg-New York gelaufen.
Eine freundliche Frauenstimme teilte Christopher mit, dass alle Leitungen belegt seien und man sich so schnell wie möglich um sein Anliegen kümmern werde.
„Ich rufe die Polizei.” Er kannte jeden Kneipenbesitzer auf dem Hamburger Berg. Mit dem Besitzer des Hotels Hamburg-New York war er per Du. Falls der Beobachter ihn angriff, käme ihm bestimmt jemand zu Hilfe.
„Das ist nicht nötig.” Der Mann blieb stehen und hob beschwichtigend die Hand. „Ich kann alles erklären.”
Die freundliche Frauenstimme bat ihn um Geduld. „Ich höre”, antwortete er, ohne aufzulegen.
„Ich bin Privatdetektiv. Ich ermittle in einem Fall.”
„Sicher.” Der schlechteste Privatdetektiv der Welt oder was? Er musterte den dicklichen Mann in der brandneuen Jeans und der glänzenden Lederjacke. Die Kleidung wirkte unpassend. Nicht authentisch.
„Hier.” Sein Gegenüber zog einen Ausweis und eine Visitenkarte aus der Jackentasche und reichte ihm beides.
„Privatdetektei Martin Kleemeyer.” Christopher hob die Augenbrauen. Visitenkarten ließen sich in jedem Copyshop oder am Automaten drucken. Ausweise konnte man fälschen.
Die Warteschleife wurde unterbrochen. Eine männliche Stimme meldete sich. „Sie haben den Notruf der Polizei gewählt, wie können wir Ihnen helfen?“
In kurzen Sätzen erklärte Christopher, worum es ging. Martin Kleemeyer, wenn er denn so hieß, musterte ihn mit finsterem Gesichtsausdruck.
Als er schließlich auflegte, schüttelte sein Gegenüber den Kopf. „Das wäre nicht nötig gewesen.“
Christopher reichte Ausweis und Visitenkarte zurück. „Ein Polizeibeamter ist auf dem Weg.“ Die Davidwache lag in der Nähe. Es würde hoffentlich nicht lange dauern.
Die Minuten verstrichen in angespannter Stille. Der Beobachter trat von einem Bein auf das andere, sah mehrmals auf die Uhr. „Das ist albern. Wir sollten …“ Er hielt inne. Gab einen missmutigen Laut von sich.
Ein Polizist näherte sich ihnen gemächlichen Schrittes. Er mochte Anfang fünfzig sein und strahlte Ruhe und Gelassenheit aus. „Guten Tag zusammen. Haben Sie die Polizei gerufen?“
„Ja, das war ich.“
„Sie sind Herr Diecks?“
„Richtig. Dieser Mann beobachtet mein Haus und behauptet, Privatdetektiv zu sein. Ich finde das äußerst verdächtig.“
„Ich bin Privatdetektiv.“ Der Beobachter reichte dem Beamten Ausweis und die Visitenkarte.
„Das lässt sich leicht überprüfen.“ Der Polizist gab den Namen und die Ausweisnummer des Beobachters an seine Dienststelle durch. Die Antwort folgte schnell. „Tja, Herr Diecks, das hat tatsächlich seine Richtigkeit. Herr Martin Kleemeyer ist eingetragener Geschäftsführer der Privatdetektei Kleemeyer.“
„Sag ich doch die ganze Zeit. Darf ich endlich zurück an die Arbeit oder gibt es weitere Bedenken hinsichtlich meiner Qualifikationen?“ Ein strafender Seitenblick traf Christopher.
Der Polizist lächelte. „Auf dem Kiez geht es manchmal ungewöhnlich zu. Nehmen Sie Herrn Diecks seine Vorsicht nicht übel. Ich nehme an, es ist alles geklärt?“
Christopher nickte.
Nachdem sich der Polizeibeamte verabschiedet hatte, fixierte ihn Martin Kleemeyer mit einem bohrenden Blick. „Wann hast du mich bemerkt? Gestern?”
„Freitag.” Er überging die Tatsache, dass der Mann ungebeten zum Du übergegangen war. „Sie haben mit einem Camcorder gefilmt.”
Der Privatdetektiv fluchte. Wie er sich darüber ärgerte, entdeckt worden zu sein, war amüsant. „Können wir uns irgendwo in Ruhe unterhalten?”
„Warum?“
„Ich möchte ein paar Dinge erklären.“
„Meinetwegen.“ Er deutete die Straße hinunter. „Der Goldene Handschuh hat geöffnet.”
Der Goldene Handschuh hatte immer geöffnet. Vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.
Kurz darauf saßen sie an einem Ecktisch im hinteren Teil der Kneipe. Christopher hatte sich eine Apfelschorle bestellt, von der er einen großen Schluck nahm. Fußball machte durstig. In der gemütlich-rustikalen Atmosphäre der Kneipe konnte man sich schwer vorstellen, dass in den Siebzigerjahren ein dreifacher Frauenmörder im Goldenen Handschuh seine Opfer angesprochen hatte. „Also?“ Er sah sein Gegenüber auffordernd an.
Martin Kleemeyer räusperte sich. „Ein Klient hat mich damit beauftragt, jemanden zu finden.”
„Diese Person wohnt in meinem Haus?”
„Richtig.”
„Weiß die Person, dass sie gesucht wird? Ich meine, wird sie nach Beobachtern Ausschau halten?”
„Davon gehe ich aus.”
„Sollten Sie in dem Fall nicht subtiler vorgehen? Oder jemanden schicken, der weniger wie ein kostümierter Anzugträger aussieht?”
„Du hast ein ganz schön freches Mundwerk, Freundchen! Wie alt bist du überhaupt?”
„Neunundzwanzig.”
„Sicher?”
„Ziemlich.”
Martin Kleemeyer musterte ihn skeptisch und hob den Zeigefinger. „Ich bin subtil.”
„Wir können gern rausgehen und die Kassiererin vom Sexkino fragen, wie lange Sie auf Beobachtungsposten sind. Oder den Besitzer vom türkischen Kiosk.” Dessen Laden befand sich im Erdgeschoss von Christophers Haus. „Auf dem Hamburger Berg interessieren sich die Leute für die Geschehnisse in ihrer Straße. Wäre ich es nicht gewesen, hätte Sie bald jemand anders angesprochen. Der vielleicht nicht die Polizei, sondern seine muskelbepackten Kumpels gerufen hätte.”
Martin Kleemeyer nickte nachdenklich. Er zog ein Foto aus der Innentasche seiner Jacke und legte es auf den Tisch.
Die junge Frau auf dem Foto war Jenny Schumann, mit adretter Kurzhaarfrisur und strahlendem Lächeln. Sie trug ein schulterfreies rotes Cocktailkleid. Von ihrem Begleiter war lediglich ein Arm zu sehen, der um ihre Taille lag. Den Rest des Fotos hatte jemand abgeschnitten.
„Valerie Steiner”, erklärte der Privatdetektiv. „Mein Klient hat sie vor einem Jahr kennengelernt, sich Hals über Kopf in sie verliebt und den Fehler begangen, ihr seine Kreditkarte anzuvertrauen. Valerie hat ihn wie eine Weihnachtsgans ausgenommen und sich aus dem Staub gemacht. Mein Klient möchte einen Skandal um jeden Preis vermeiden, deshalb hat er darauf verzichtet, die Polizei einzuschalten.”
„Ach.” Christopher betrachtete das Foto. Das würde Jennys Verhalten erklären, ihre Nervosität und Anspannung. „Kommt sie aus Hamburg?”
„Nein. Ein Kollege von außerhalb hat ihre Spur bis hierher verfolgt und den Fall an mich abgegeben.”
Er studierte das Foto eingehender. Die Männerhand, die aus dem Anzugärmel lugte, wirkte faltig und fleckig. „Ihr Klient ist wesentlich älter als Jenny, stimmt’s? Verheirateter Geschäftsmann auf der Suche nach einem Abenteuer?”
Martin Kleemeyer hob die Augenbrauen. Treffer ins Schwarze. Er reichte das Foto zurück.
„Sie ist gestern in den Urlaub gefahren.”
„Was?”
Christopher erzählte von der nächtlichen Begegnung im Treppenhaus. „Jenny ist weg.“
„Scheiße! Hat sie irgendetwas darüber gesagt, wohin sie fährt? Vielleicht Andeutungen gemacht? Gestern, in den Tagen davor?”
„Nein. Wir haben nie viel miteinander gesprochen. Sie war sehr auf ihre Privatsphäre bedacht.”
„Verdammt!” Martin Kleemeyer stand abrupt auf. „Ich muss telefonieren!” Er zog sein Handy aus der Hosentasche und marschierte zum Ausgang.
Christopher blickte dem Mann amüsiert nach. Valerie Steiner, die Kreditkartenbetrügerin, die als Jenny Schumann nach Hamburg flieht, um auf St. Pauli unterzutauchen. Martin Kleemeyer, der Privatdetektiv, der sie aufspüren soll. Ein verheirateter älterer Mann, der um seinen guten Ruf fürchtet. Eine Geschichte wie aus einem Fernsehkrimi. Ob er das alles glauben sollte? Ganz sicher war er sich da nicht.
Er trank die restliche Apfelschorle und wollte gerade aufstehen, als Martin Kleemeyer zurückkam.
„Hier.” Der Privatdetektiv zückte seine Visitenkarte. „Du hast ein gutes Auge für Details und ein kluges Köpfchen. Falls du an einem Job interessiert bist, ruf mich an. Jemanden wie dich kann ich brauchen.”
Er betrachtete verblüfft das Pappkärtchen.
„Denk zumindest darüber nach. Darf ich dich anrufen, falls ich noch Fragen zu Valerie Steiner habe?”
„Sicher.” Er nannte seine Handynummer, die sein Gegenüber auf einen Bierdeckel kritzelte.
„Danke.” Der Privatdetektiv reichte ihm zum Abschied die Hand und ging.
Christopher betrachtete skeptisch die Visitenkarte. Er sollte wildfremde Menschen ausspionieren, Ehebrechern nachstellen und Kriminelle überführen?
Kein normaler Mensch tat so etwas!
Kapitel 2
09. August 2014
Manchmal fragte sich Christopher, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn Valerie Steiner ein anderes Haus in einer anderen Straße als Versteck gewählt hätte. Oder wenn Martin Kleemeyer nicht der schlechteste Privatdetektiv der Welt gewesen wäre. Was, im Nachhinein betrachtet, nicht stimmte. Es war einfach eine ungünstige Woche für ihn gewesen. Martin besaß einen scharfen Verstand und eine Kombinationsgabe, die genauso beeindruckend war wie seine scheinbar endlose Geduld. Nächtelang ein leer stehendes Gebäude beobachten, in der Hoffnung, die gesuchte Person würde sich dort zeigen? Kein Problem. Endlose Listen mit Telefonverbindungen nach einer einzigen Nummer durchforsten? Alles klar. Zum hundertsten Mal einen Stapel Fotos durchgehen auf der Suche nach der einen Unregelmäßigkeit? Mühelos. Tobenden Schuldnern gerichtliche Verfügungen überreichen? Äh … nein.
Aufträge, die potenziell mit körperlichen Auseinandersetzungen enden konnten, überließ Martin großzügig Menschen mit solideren Konfliktlösungsstrategien. Sprich, Christopher oder einem der beiden anderen Detektive, die für ihn arbeiteten. Auf dem Gebiet der Deeskalation war Martin Kleemeyer eine Niete. Obwohl Vater einer heftig pubertierenden Tochter und eines fünfjährigen Sohnes, fehlte ihm ausgerechnet dafür die nötige Gelassenheit. Also machte er von seiner Position als Chef Gebrauch und delegierte Konfliktgespräche nach unten.
Nach zwei Jahren als Möchtegern-Philip-Marlowe von Hamburg stand für Christopher eine Sache zweifelsfrei fest: Die Arbeit eines Privatdetektivs hatte mit dem, was man im Fernsehen sah, wenig gemein. Er verbrachte seine Zeit weder damit, illegal Wohnungen zu verwanzen, noch hinter flüchtenden Verbrechern herzurennen, vor ihnen zu fliehen oder am laufenden Band verprügelt oder beschossen zu werden. Die Situationen, in denen ihm jemand Gewalt angedroht hatte, ließen sich an einer Hand abzählen. Inzwischen verstand er auch die Herausforderungen einer unauffälligen Observierung. In jeder Straße gab es mindestens eine neugierige alte Schachtel, die den ganzen Tag am Fenster klebte und nichts Besseres zu tun hatte, als Menschen zu beobachten und die Kennzeichen von Falschparkern zu notieren. Im vergangenen Jahr hatte ihm eine misstrauische Rentnerin sogar die Polizei auf den Hals gehetzt. Martin wäre vor Lachen fast vom Stuhl gefallen.
Zu seiner Verteidigung konnte Christopher lediglich anbringen, dass es ein Detail gab, das ihm die Observierungen erschwerte. Es hing weder mit Unfähigkeit noch mit Tollpatschigkeit zusammen. Seinen Kopf zierte ein roter Haarschopf, ein weithin sichtbares Signalfeuer, das es ihm erschwerte, wie ein Chamäleon mit der Umgebung zu verschmelzen. Deshalb nahm er in Kauf, dass Martin ihn selten bei der Verfolgung beweglicher Ziele einsetzte und ihn lieber in Fahrzeugen positionierte. Oder hinter einem Schreibtisch, um Telefon- und Internetrecherche zu betreiben. Bislang reichte die Zahl der Fälle nicht aus, um ihn in Vollzeit zu beschäftigen. Martin buchte ihn nach Bedarf, ein Arrangement, mit dem sie beide gut lebten.
Drei Jobs zu jonglieren, verlangte Christopher einiges an Organisations- und Improvisationstalent ab, doch die Vorteile überwogen. An einem Tag räumte er für ein Umzugsunternehmen eine Wohnung aus, am nächsten Tag kellnerte er im Restaurant seines Stiefvaters (mittlerweile Ex-Stiefvaters) und am dritten Tag ging er Martin in der Detektei zur Hand. Große Sprünge waren bei seinem Lebensstil nicht möglich, doch das störte ihn selten. Brauchte er einen Kurzurlaub, konnte er in wenigen Minuten am Hafen sein. Oder er fuhr mit der S-Bahn nach Klein Flottbek und ging hinunter an den Elbstrand. Sah den großen Pötten zu, die von der Nordsee her den Fluss hochgeschleppt wurden.
Dort war er auch gestern gewesen. Zusammen mit Jacobi und fünfzehn oder zwanzig anderen. Sie hatten eine feuchtfröhliche Grillparty veranstaltet und eine Minute nach Mitternacht mit Sekt und Bier auf Jacobis einunddreißigsten Geburtstag angestoßen. Anschließend waren sie auf den Kiez gefahren. Danach hatte er irgendwann den Faden verloren.
Christopher schob die Bettdecke zurück. Er öffnete vorsichtig ein Auge und kniff es sofort wieder zu. Die Jalousie war nicht heruntergelassen. Einige Minuten später unternahm er den nächsten Versuch. Diesmal gelang es ihm, beide Augen zu öffnen. Angespornt durch den Erfolg, setzte er sich langsam im Bett auf. Die Welt drehte sich einige Male, ehe sie sich in ihrer üblichen Lage einpendelte. Hinter seinen Schläfen pochte der Schmerz. Der letzte Jägermeister war eindeutig schlecht gewesen. Christopher schmeckte den Likör noch immer auf seiner pelzigen Zunge. Sein T-Shirt roch nach Schweiß, Grillanzünder und Bier. Er verzog das Gesicht und fuhr sich durchs Haar. Feiner Sand blieb zwischen seinen Fingern hängen. Piksende Andenken an eine trunkene Runde Strandfußball. Irgendjemand war dabei im Wasser gelandet. Er erinnerte sich verschwommen an das Ereignis, aber nicht daran, wer es gewesen war.
Er sollte die Bettwäsche wechseln.
Später.
Sehr viel später.
Christopher wankte in den Flur. Aus dem Bad drangen eindeutige Geräusche. Jacobi ließ sich die vergangene Nacht durch den Kopf gehen. Er hielt inne und horchte auf seinen Magen. Dieser fühlte sich zwar flau an, machte aber keinerlei Anstalten, ebenfalls in die Retrospektive zu gehen.
Die Klospülung wurde betätigt. Sobald das Rauschen des Wassers aufhörte, klopfte er an die angelehnte Tür. „Jacobi?”
Die Antwort war ein unverständliches Grummeln.
Christopher öffnete. Jacobi kniete vor der Toilette, die Arme auf der Klobrille verschränkt, den blonden Haarschopf über der Kloschüssel. Er trug lediglich Jeans und eine einzelne Socke.
„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.”
„Leck mich”, erklang es dumpf aus den Tiefen der Toilette.
„Ich muss pinkeln.”
„Viel Spaß.”
Als sein Freund keinerlei Anstalten machte, sich zu bewegen, drehte Christopher die Dusche auf, stellte sich vor die Wanne und tat, was er tun musste. Danach überließ er Jacobi seinem Elend und tappte in die Küche. Er füllte ein Glas mit Wasser, fand zwei Alka-Seltzer und warf eines ins Glas. Während er der Tablette beim Sprudeln zuschaute, versuchte er, sich keine allzu komplizierten Gedanken zu machen. Um die würgenden Geräusche aus dem Badezimmer zu übertönen, schob er eine CD in den CD-Player. Begleitet von fröhlichen Irish-Folk-Klängen, setzte sich Christopher an den Tisch und leerte das Glas in einem Zug. Die salzige Flüssigkeit schmeckte widerlich. Er schluckte gegen die aufsteigende Übelkeit an. Ein dünner Schweißfilm bildete in seinem Nacken. Er schloss die Augen. In der Dunkelheit drehte sich die Welt.
Er erwachte mit dem Kopf auf der Tischplatte. Eine Violine fiedelte schrill im Stakkato. Die CD hatte sich festgefressen und hüpfte auf derselben Stelle. Christopher löste seine verschwitzte Wange vom Tisch und brachte den CD-Player zum Schweigen. Die Uhr über der Tür zeigte kurz vor Mittag. Er hatte keine Ahnung, wie lange sein Schläfchen gedauert hatte, doch er fühlte sich besser. Er stellte das Glas in die Spüle und wollte gerade nach Jacobi sehen, als es irgendwo klingelte. Er horchte und ordnete irgendwo als sein Schlafzimmer ein. Sein Smartphone bimmelte sich die winzigen Schaltkreise aus dem Leib. Schließlich verstummte es. Gleich darauf klingelte sein Festnetztelefon. Er ahnte, dass er es bereuen würde, nahm es aber trotzdem aus der Ladestation.
„Diecks”, krächzte er. Er räusperte sich und versuchte es noch einmal.
„Bist du nüchtern genug, um Kartons zu schleppen?”, fragte Friedrich Scholz, sein Chef des gleichnamigen Umzugsunternehmens.
Christopher trat sich in Gedanken vors Schienbein. „Ich hab heute frei”, jammerte er.
„Jochen hat sich in dem Chaos den Knöchel verstaucht. Wir müssen bis morgen fertig werden!”
An diesem Wochenende stand eine Entrümpelung in Bramfeld an. Ein demenzkranker Rentner und sein Sohn hatten in einem zugemüllten Haus gewohnt. Der Sohn war vor zwei Wochen nach einem Herzinfarkt gestorben. Im Wohnzimmer. Der alte Mann lebte mittlerweile in einem Pflegeheim. Die zweifelhafte Ehre, das Haus räumen zu lassen, wurde einer Nichte aus Stade zuteil.
„Mein Magen ist nicht in der Verfassung für verschimmelte Lebensmittel, Kakerlaken und Ratten.” Allein bei dem Gedanken wurde ihm übel.
„Red keinen Unsinn. Vielleicht läuft dir der eine oder andere Käfer über den Weg. Ich brauche dich! Heute und morgen. Ich zahle dir den üblichen Wochenendzuschlag und einen großzügigen Bonus.”
„Wie großzügig?”
„Hundert Euro.”
Christopher unterdrückte ein Stöhnen. Sein Konto brauchte das Geld. Sein Kopf und der Rest seines Körpers brauchten ein weiches Bett in einem abgedunkelten Raum.
„Bist du eingeschlafen?”
„Hundertfünfzig.”
„Halsabschneider.”
„Du zahlst das Taxi.” Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln würde er fast eine Stunde bis nach Bramfeld brauchen.
„In Ordnung.”
„Schick mir die Adresse auf mein Handy.” Er beendete das Gespräch und stellte das Telefon zurück in die Ladestation. Einen Moment lang stand er im Flur und massierte sich das Nasenbein. Warum ließ er sich immer wieder breitschlagen?
Im Badezimmer stank es nach Kotze. Jacobi lag zusammengerollt neben der Toilette, den Duschvorleger als improvisiertes Kissen unter dem Kopf. Er hielt die Augen fest geschlossen. Christopher öffnete das Fenster und stupste seinen Freund mit dem Fuß an. „Hey, Cobi.”
Keine Reaktion.
Er wiederholte den Vorgang. Diesmal war die Antwort ein schwaches „Lass mich in Ruhe”.
„Friedrich hat angerufen. Ich muss zur Arbeit.”
„Toll.”
„Du kannst hier nicht liegen bleiben.”
„Ich möchte sterben.”
„Nicht auf den kalten Fliesen.” Christopher beugte sich vor, was seinem Kreislauf überhaupt nicht gut bekam, und packte seinen Freund unter den Achseln. Irgendwie gelang es ihm, Jacobi zurück ins Wohnzimmer zu schleppen und aufs Sofa zu bugsieren. Er zerrte die Wolldecke unter Jacobis Beinen hervor, was grummelnden Protest auslöste, und deckte ihn zu.
Die erfrischende Dusche musste er auf den Abend verschieben. Der altersschwache Boiler im Bad brauchte zu lange, um auf Touren zu kommen. Also beließ er es bei einer Katzenwäsche. Danach ging er ins Schlafzimmer und holte einen Stapel Arbeitskleidung aus dem Kleiderschrank. Eine fleckige graue Cargohose, ein verwaschenes, ehemals schwarzes T-Shirt, auf dessen Brust in graustichigem Weiß das Wort Superheld prangte, und dicke Socken.
In einer Nische neben dem Fenster bewahrte er seine Sicherheitsschuhe auf, in denen er eine Staubmaske, eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe verstaut hatte. Er zog die Schuhe an und packte die Arbeitsausrüstung in eine Umhängetasche. Anschließend sammelte er einige Dinge zusammen, die Jacobi brauchen würde: einen Eimer, einen feuchten Lappen, eine Packung Zwieback, Wasser, ein Glas, das zweite Alka-Seltzer und Jacobis Smartphone.
Sein Freund beobachtete mit einem dunkelbraunen, leicht glasigen Auge, wie Christopher die Sachen auf dem Couchtisch aufreihte. „Ruf mich an, falls irgendwas ist. Wenn du mir das Sofa vollkotzt, trete ich dir in den A…, verstanden?”
Jacobi grunzte.
Christopher nahm seine Sonnenbrille, die gestern irgendwie ihren Weg an einen der Garderobenhaken gefunden hatte, und verließ die Wohnung.
Um die Ecke gab es einen Taxistand. Er ging das kurze Stück der Reeperbahn entlang und entdeckte vor einem der Geschäfte einen grauhaarigen Mann in abgetragener Kleidung, der Plastikflaschen aus Tüten in einen Rucksack umlud. Zu seinen Füßen saß ein kleiner Schnauzer, der die Umgebung wachsam im Auge behielt.
„Moin, Rudi.”
Rudi hob den Kopf und verzog sein wettergegerbtes Gesicht zu einem Lächeln, das etliche Zahnlücken sehen ließ. „Moin, mien Jung. Na, wie guckst du denn aus der Wäsche? Gestern ordentlich einen gehoben?”
„Kleine Feier mit Freunden.” Christopher ging in die Hocke und kraulte Tessa, die ihn freudig begrüßte.
„Muss auch mal sein. Und nu? Katerfrühstück bei deiner Mieze?” Rudi lachte heiser über seinen Witz.
Christopher war auf diese Art von Humor noch nicht eingestellt. „Deine Sprüche werden auch immer platter!”
Die Reaktion darauf war erneutes Lachen.
„Ich muss arbeiten. Hab mich für zwei Tage zum Kartonsschleppen verpflichtet.”
„Oh.” Ein mitleidsvoller Blick aus trüben blauen Augen traf ihn. „Dat Wochenende is’ wohl hin, was?”
„Sieht so aus.”
„Na, denn man tau.”
Christopher strich Tessa übers Köpfchen und gab Rudi einen freundschaftlichen Klaps. „Tschüss.”
„Tschüss, mien Jung.”
Er schleppte sich zum ersten Taxi in der Warteschlange, nahm auf der Rückbank Platz und las dem Taxifahrer die Zieladresse vor. Danach öffnete er das Fenster.
Einen Chauffeur zu haben, war ein seltener Luxus.
Christopher rutschte tiefer in den Ledersitz und dachte an Rudi. Er war einer von den Guten, denen das Leben übel mitgespielt hatte. Die falsche Frau geheiratet, Scheidung, Auszug aus dem gemeinsamen Haus, Kontakt zu den Kindern verloren, Arbeit futsch, Depressionen, Mietrückstände, Straße. Kein Alkohol, darauf legte Rudi großen Wert. Mit Anfang sechzig sah er aus wie Mitte siebzig. Verbraucht von einem Jahrzehnt auf Platte. Trotzdem schaffte er es, Optimismus und Fröhlichkeit zu verbreiten.
Anfangs hatte Christopher versucht, zu helfen. Ihm eine feste Bleibe zu besorgen, eine Arbeit. Bis Rudi klarstellte, dass er keine Hilfe wollte. Die Vorstellung, in ein geordnetes Leben zurückzukehren, Regeln zu befolgen, Erwartungen zu erfüllen, überforderte ihn. Für Christopher war es schwierig gewesen, das zu akzeptieren. Wie konnte jemand freiwillig ein Leben auf der Straße führen, während es Möglichkeiten gab, das zu ändern? Warum beharrte Rudi stur darauf, sein eigenes Ding durchzuziehen?
An dieser Stelle schmunzelte Christopher gewöhnlich.
Wie oft hatte er selbst ähnliche Sätze zu hören bekommen? Wie lange hatte er seinen eigenen Weg gegenüber Menschen verteidigt, die ihm vorwarfen, er würde sich unter Wert verkaufen?
Christopher hatte Abitur gemacht, weil es von ihm erwartet worden war. Niemand in seiner Familie besaß einen niedrigeren Schulabschluss. Es wäre undenkbar gewesen, mit dieser Tradition zu brechen. Also hatte er einen hervorragenden Realschulabschluss und drei Jahre seines Lebens zugunsten eines mittelmäßigen Abiturs geopfert. Seine Durchschnittsnote von 2,9 hatte keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Jacobi war für seine 3,1 gefeiert worden wie ein König. Der Erste aus dem Filipowicz-Clan mit Abitur.
Christopher hingegen hatte die geballte Enttäuschung seiner Eltern zu spüren bekommen. Seit der Scheidung waren sie sich selten bei einer Sache so einig gewesen.
Damit aus dem Jungen trotzdem etwas wurde, hatte sein Vater seinen guten Draht zur Personalabteilung seiner Firma genutzt und ihm einen Ausbildungsplatz verschafft. Unter dem wachsamen Blick seines Erzeugers hatte Christopher die Ausbildung zum Speditionskaufmann absolviert. Seine Leistungen waren gut gewesen, aber nie gut genug für seine Eltern. An dem Tag, an dem er sein Prüfungszeugnis in der Hand gehalten hatte, war er endgültig fertig damit gewesen, die Dinge zu tun, die man von ihm erwartete. Er hatte den Übernahmevertrag seiner Ausbildungsfirma abgelehnt, sich einen Job im Restaurant seines Stiefvaters besorgt und die Rettung der Familienehre seinem jüngeren Bruder überlassen. Seine Eltern trugen ihm diese Entscheidung bis heute nach. Wenn Rudi also beschloss, sein Leben fernab gesellschaftlicher Gepflogenheiten zu führen, würde er das respektieren.
Das Taxi bog in eine ruhige Straße mit Ein- und Zweifamilienhäusern ein. Alles war wohlgeordnet, die Hecken geschnitten, die Gärten liebevoll gepflegt.
Ein harter Kontrast zur Reeperbahn. Christopher versuchte vergeblich, sich vorzustellen, in einem dieser Häuser zu wohnen wie sein jüngerer Bruder Elias mit seiner Familie.
In einiger Entfernung stand ein leuchtend roter Lkw des Umzugsunternehmens Scholz. Bald darauf sah Christopher den großen, an der Oberseite offenen Container, der im Garten eines Einfamilienhauses stand und den Rasen ruinierte. Nach den Maßen zu urteilen, sechsunddreißig Kubikmeter. Ausreichend Raum für den Inhalt einer Zweizimmerwohnung. Friedrich hatte die ganz große Mülltonne ausgepackt. Aus einem Fenster im ersten Stock des Gebäudes flogen wie am Fließband leere Kartons, Kleidung und unidentifizierbares Zeug in die Stahlbox. Ein untersetzter Mann mit dunklem, grau meliertem Haar, Bauchansatz und Brille stand vor dem Haus und überwachte das Geschehen.
Friedrich Scholz.
Als der Taxifahrer hielt, kamen gerade zwei von Christophers Kollegen aus dem Haus, jeder mit einem Karton beladen. Friedrich nahm den Inhalt in Augenschein und schickte die Männer zum Container. Im Lkw wurden ausschließlich brauchbare Dinge gesammelt, die sich an Antiquitätenhändler oder Secondhandläden verkaufen ließen.
Christopher bat den Taxifahrer, zu hupen. Auf das Signal hin wandte Friedrich den Kopf.
„Der Herr zahlt”, erklärte Christopher und stieg aus.
Friedrich musterte ihn durch seine mehrere Millimeter dicken Brillengläser und schüttelte den Kopf.
„Die Jugend von heute.”
„Ich kann auch wieder fahren. Ein wenig körperliche Arbeit täte deinem Waschbärbauch bestimmt gut.”
„Ich geb dir gleich Waschbärbauch!“, drohte Friedrich. „Mach dich nützlich, du wirst hier nicht fürs Rumstehen bezahlt!”
„Jawohl, Chef.”
„Du kannst Timo und Jonas im ersten Stock zur Hand gehen. Zeitschriften, Bücher, Kleidung, Elektroschrott, Teppiche, alles raus. Persönliche Gegenstände wie Fotoalben, Briefe oder Dokumente sammeln wir in der Küche. Wenn ihr bis zu den Möbeln vorgedrungen seid, gebt mir Bescheid. Der alte Mann hat früher Antiquitäten gesammelt. Unter dem ganzen Kram könnten wahre Schätze schlummern.”
Christopher nickte, während sein überfordertes Gehirn versuchte, die Informationen zu verarbeiten. Er verstaute seine Umhängetasche im Lkw und ging zum Haus.
In Erwartung des Schlimmsten trat er über die Türschwelle. Der Eingangsbereich und der lange Flur waren bereits geräumt. Olivgrüne Tapete wellte sich an den Wänden. An zahllosen Haken und Nägeln hatte offenbar eine Bildergalerie ihren Platz gehabt. Links lag die Küche. Schmutzränder an den Wänden zeichneten die ehemaligen Positionen der Möbel und Spüle nach. Der Fußbodenbelag war herausgerissen worden. Darunter lagen dunkle Dielen. In einer Ecke standen zwei Kartons. Einer war leer, der andere gefüllt mit gerahmten Bildern und einer Schachtel voller Briefe und Postkarten. Die Tür zur leeren Speisekammer stand offen. Jemand hatte das vor Staub und Dreck fast blinde Küchenfenster geöffnet, um frische Luft in den Raum zu lassen. Trotzdem roch es ekelhaft süßlich-vergoren.
Am Ende des Flurs befand sich das, was wohl einmal der Wohn- und Essbereich gewesen war. Bei einem Blick durch die offene Tür sah er lediglich Kartons, Müllsäcke, wahllos abgestelltes Mobiliar und etliche Fernseher. Dort war der Sohn des Hausbesitzers gestorben. Bei der Vorstellung überlief ihn ein Schauder.
Er trat näher und machte sich mit einem knappen „Moin!” bemerkbar.
„Hey, Topher. Gut, dass du da bist!“ Jörg, der jüngste Sohn von Friedrich Scholz, hob zur Begrüßung einen Klappstuhl hoch, der vor einem hüfthohen Stapel Zeitschriften stand. Der Stapel kam ins Rutschen und ergoss sich einem Wasserfall gleich über den Boden. Jörg rollte genervt die Augen. „Ich hasse diesen Mist! Das geht die ganze Zeit so!”
„Man sollte eine Lenkrakete auf diese Dreckshütte abfeuern und sie dem Erdboden gleichmachen“, drang von irgendwo hinter einem rustikalen Vitrinenschrank die Stimme von Jörgs älterem Bruder Michael. Christopher ließ die beiden weiterarbeiten und ging zur Treppe. Die Stufen knarrten unter seinem Gewicht. Auf der obersten Stufe blieb er fassungslos stehen. So etwas hatte er noch nicht gesehen.
Aus drei Räumen quoll das Ergebnis jahre- oder gar jahrzehntelanger Sammelwut. Kleidung, zusammengerollte Teppiche, Tüten über Tüten, Kartons, Bücher, unidentifizierbares Zeug. Als wäre eine Sperrmüllbombe explodiert. Der schmale Flur war durch zwei Vitrinen und ein Regal kaum passierbar. Überall standen Dekoartikel. Kitschige Glas- und Keramikfiguren, Stoffpüppchen und Schmuckkästchen. Keine Spur von den Zimmertüren. Wie sollten sie dieses Gerümpel in zwei Tagen aus dem Haus schaffen?
Ein unangenehmes Aroma stieg ihm in die Nase. Feuchte Wände, ungewaschene Kleidung, abgestandene Luft, Verwahrlosung. Kaum vorstellbar, dass zwei Menschen jahrelang in diesem Müll gehaust hatten. Er nahm eine Reihe von Fotos mit seinem Smartphone auf. Jacobi würde ihm diese Geschichte sonst nie glauben.
In einem der Räume wurde gearbeitet.
Christopher trat ein und fand sich in einem Schlafzimmer wieder. Jedenfalls deutete ein Ansatz von Bettrahmen darauf hin. Jonas und Timo standen auf einer freien Fläche und knabberten an dem Gerümpel wie effiziente Mäuse an einem Stück Käse. Jonas griff wahllos nach Gegenständen und reichte sie an Timo weiter, der sie aus dem Fenster und in den Container beförderte.
„Moin!“
Jonas hielt inne. Er musterte Christopher, betrachtete das T-Shirt mit dem Superhelden-Aufdruck und begann zu lachen.
Timo grinste breit. „Das letzte Bier war wohl schlecht, was?“
„Hör bloß auf!”
„Hübsches T-Shirt“, bemerkte Jonas. „Abschiedsgeschenk von Caro?”
„Das ist von Tine.” Seiner vorletzten Freundin. Wäre es von Caro gewesen, hätte er es längst verbrannt.
„Hier.“ Timo warf ihm eine Rolle robuster Müllsäcke zu. „Du kannst im Badezimmer anfangen.“
„Welches Badezimmer?“
„Zweite Tür rechts. Viel Vergnügen.”
Nach einem skeptischen Blick auf seine grinsenden Kollegen machte er sich auf den Weg.
Der Anblick des Badezimmers war ein weiteres Foto wert. Stapelweise Heckenscheren, Rechen, Schaufeln, Hacken, Spaten, Spaliere. Einige der Utensilien in ihrer Originalverpackung, andere völlig verrostet. Die Badewanne war bis zum Rand mit Elektrogeräten gefüllt. Radios, Rasierapparate, Föhne, Toaster, Teile von Lautsprechern und Stereoanlagen. Sogar einen Staubsauger entdeckte er. Alles schwamm in einer müffelnden braunen Brühe. Christopher seufzte und zog seine Putzhandschuhe an. Er füllte drei Müllsäcke, bevor er den Wasserspiegel erreichte. Die letzten Teile hob er mit einer Schaufel aus der Wanne.
Friedrich erschien in der Tür. Er begutachtete den tropfenden Wasserhahn und verstopften Abfluss und machte auf seinem Protokoll eine Notiz für den Klempner.
Während die Rolle mit den Müllsäcken stetig dünner wurde, erschien nach und nach der geflieste Fußboden. Christopher schleppte ein Dutzend Säcke zum Container. Danach brauchte er eine Pause. Sein Magen knurrte, und hinter seinen Schläfen pochte der Kopfschmerz.
Auf der Ladefläche des Lkw standen Kästen mit Wasser und eine Kühlbox, in der belegte Brote lagen.
Er trank eine halbe Flasche stilles Wasser und nahm sich je ein Brot mit Käse und mit Salami. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite fand er unter einem Baum ein schattiges Plätzchen. Er setzte sich auf eine niedrige Grundstücksmauer und beobachtete kauend die Schaulustigen, die ihrerseits die Hausräumung verfolgten. Endlich eine Abwechslung im öden Alltag. Er machte ein Foto vom Haus samt Lkw und Container.
Das typische Klack-Klack-Klack eines Skateboards näherte sich. Ein Junge rollte auf ihn zu. Vielleicht dreizehn oder vierzehn, blond, schlabberiges T-Shirt, neongelbe Turnschuhe, bunt karierter Rucksack. Die beutelige Hose wurde allein durch Hoffnung und ein Aussetzen der Schwerkraft über dem dürren Hintern gehalten. Der Junge bremste und zog einen Fotoapparat aus der Hosentasche. Er machte einige Bilder vom Messie-Haus, steckte den Fotoapparat ein und rollte mit kräftigen Fußstößen den Weg zurück, den er gekommen war. An der nächsten Straßenecke stoppte er neben einem silbergrauen Wagen. Das Fenster auf der Fahrerseite wurde abgesenkt. Der Junge reichte den Fotoapparat in den Wagen, nahm etwas entgegen und verschwand in der Seitenstraße. Mit gerunzelter Stirn beobachtete Christopher, wie der silberne Wagen abbog und davonfuhr. Kein Hamburger Kennzeichen. Das HH hätte er selbst aus dieser Entfernung erkannt. Er blickte dem Fahrzeug nach und versuchte vergeblich, sich einen Reim auf die Sache zu machen.
Bis zum Ende dieses Arbeitstages half er seinen Kollegen im Schlafzimmer. Das Sortieren und Umschichten nahm die meiste Zeit in Anspruch. Hinter einem Vorhang verbarg sich eine Nische, aus der ein penetranter Schimmelgeruch drang. Koffer in unterschiedlichen Stadien der Auflösung stapelten sich bis unter die Decke. Vorsichtshalber setzten sie spezielle Atemmasken und Schutzbrillen auf. Sie öffneten jeden Koffer, falls darin wichtige Unterlagen oder persönliche Gegenstände lagen. Die gesamte Außenwand war schwarz. Das Mauerwerk musste seit geraumer Zeit undicht sein. Allmählich tauchten Möbel auf aus diesem Ozean des Chaos. Kommoden und Nachtschränkchen, die Schubladen zum Bersten gefüllt. Sie zerlegten das Doppelbett und die großen Staukästen und wuchteten die Überreste aus dem Fenster. Es war schon etwas unverfroren, an einem Samstagabend schwere Holzkästen aus dem ersten Stock zu werfen.
Wie auf Kommando stand Friedrich in der Tür.
„Seid ihr bescheuert?”, polterte er los. „Um diese Uhrzeit solchen Lärm zu machen? Wenn sich die Nachbarn bei der Polizei beschweren, können wir einpacken. Schaltet eure Köpfe ein, Jungs!”
Betretenes Schweigen folgte.
„Entschuldige”, antwortete Christopher. „Kommt nicht wieder vor.”
„Das will ich meinen!” Friedrichs Blick glitt durch den Raum. „Schafft den restlichen Krempel runter und macht Feierabend. Über die Treppe. Sonst gibt’s ein paar hinter die Löffel!”
Während die Treppenstufen hörbar unter den schweren Schritten ihres Chefs knarrten, tauschten seine Kollegen und Christopher vielsagende Blicke. Wer für Friedrich Scholz arbeiten wollte, brauchte ein dickes Fell.
Christopher fuhr mit Friedrich und Jörg im Lkw zurück. Der anstrengende Tag steckte ihm in den Knochen. Eine heiße Dusche und ein ordentliches Abendessen war alles, was er wollte. Vorher half er Jörg und Friedrich noch, die leichteren Möbel, antiken Lampen und Säcke mit brauchbaren Gegenständen ins Lager der Möbelspedition zu tragen. Den schweren Kleiderschrank und zwei massive Eichenholzkommoden ließen sie auf der Ladefläche stehen.
Jörg fuhr ihn freundlicherweise nach Hause.
Kurz nach halb neun erreichten sie den Hamburger Berg. Jörg hielt direkt vor Christophers Haus.
„Dass du hier wohnen kannst. Mich würde der Trubel wahnsinnig machen.”
„Mir gefällt’s. Auf Pauli wird’s nie langweilig.”
„Und die Wege sind kurz, was?” Jörg deutete feixend auf das Sexkino.
„Genau.”
„Soll ich dich morgen früh abholen?”
„Ist das kein Umweg für dich?” Natürlich war es ein Umweg.
„Die paar Minuten kann ich verschmerzen. Zwanzig nach neun?”
„Klingt gut. Danke.”
„Kein Problem.”
Auf der Treppe fiel Christopher sein Hausgast ein. Hoffentlich hatte sich Jacobi mittlerweile berappelt. Um den Krankenpfleger zu spielen, fehlte ihm die Energie.
Im Wohnzimmer roch es nach Pizza. Die Wolldecke lag zusammengefaltet auf dem Sofa, der Couchtisch war abgeräumt. Im Badezimmer stand das Fenster auf Kipp.
Sein Smartphone vibrierte in der Hosentasche.
Ich schulde dir eine Pizza.
Er antwortete.
Salami. Und nicht den billigen Dreck!
Als ob du den Unterschied kennst.
Christopher grinste. Er schaltete das Smartphone aus und den Boiler ein.