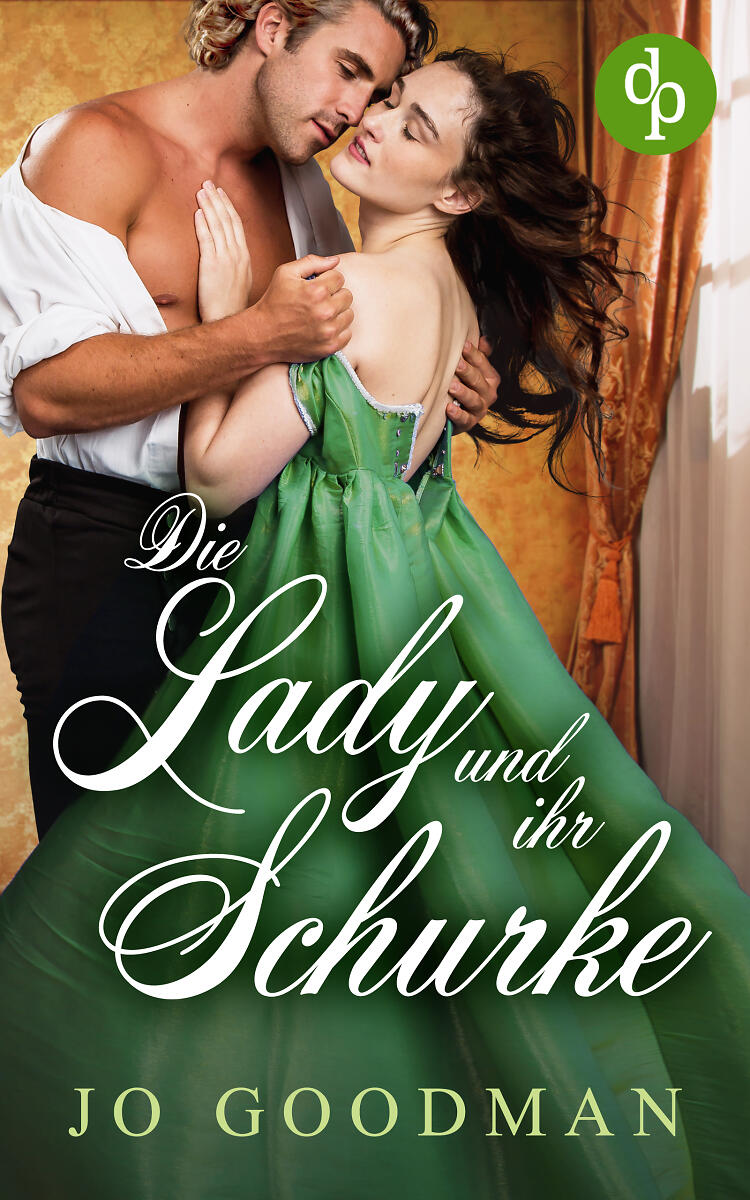Prolog
London, Oktober 1820
Sie kamen, um den Kleinen zu holen. Das war Colin klar, der mit acht Jahren alt genug war, um unter dem Verlust zu leiden, und noch zu jung, um die Trennung zu verhindern. Er hatte den Moment erwartet, ohne wirklich darauf vorbereitet zu sein. Und er hatte versäumt, seine Brüder darauf vorzubereiten.
Greydon hätte ohnehin nichts begriffen. Er war das Baby, das die Leute haben wollten. Kein Wunder, sie hatten sich in sein rundes Gesichtchen, sein seliges Lächeln verliebt. Der fünf Monate alte Grey war noch zu klein, um die Situation zu begreifen. Er wusste nicht, dass er eine Familie hatte, wenn auch eine kleinere als noch vor zwei Monaten. Der Säugling lachte glucksend mit zahnlos rosigem Mund und ruderte mit Armen und Beinen. Jeder erlag seinem Liebreiz, der ihm so natürlich war wie Trinken und Schlafen.
Und als Grey in den Armen der fremden Frau zufrieden brabbelte, fiel es Colin schwer, seinem kleinen Bruder nicht den Vorwurf zu machen, ein Verräter zu sein.
Colin stand neben der Tür im Büro des Heimleiters und hielt seinen anderen Bruder an der Hand. Decker war erst vier, blieb aber vertrauensvoll neben Colin stehen und beobachtete aufmerksam, wie das Ehepaar aus Amerika seine Entscheidung traf.
Die nächsten Minuten zogen sich quälend dahin, bis der Heimleiter auf die beiden Jungen deutete und das Ehepaar mit sachlicher Gleichgültigkeit fragte: »Wollen Sie einen oder vielleicht beide dazu?«
Der fremde Mann wandte den Kopf und schien die Kinder jetzt erst zu bemerken. Die Frau blickte nicht einmal in ihre Richtung.
»Sie sind Brüder«, erklärte der Heimleiter. »Colin. Decker. Kommt her und sagt Greydons neuen Eltern guten Tag.«
Colins Hoffnung, das Paar würde sich doch nicht für Grey entscheiden, schwand bei den Worten des Heimleiters. Gehorsam trat er vor und zog Decker mit sich. »Guten Tag, Sir«, grüßte er höflich und streckte dem Fremden die Hand hin.
Nach einer verdutzten Pause lachte der Mann freundlich, ehe er Colins Hand nahm und seinen Gruß erwiderte. Die kleine Kinderhand verschwand in der großen Hand des Fremden. So sehr Colin sich in späteren Jahren auch bemühte, er konnte sich nicht an die Gesichtszüge des Mannes erinnern. Doch der warme, feste Händedruck blieb ihm im Gedächtnis, ebenso das tiefe, melodische Lachen und der Hoffnungsschimmer, der einen Moment in seinem Kinderherz aufgeflammt war.
Der Fremde wandte sich an seine Frau, die dem Baby in ihren Armen wieder ein Lächeln entlockte und seinem unschuldigen Charme bereits verfallen war. Das Paar würde den Säugling mühelos als eigenes Kind ausgeben können. Niemand in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis würde erfahren, dass es sich um ein Adoptivkind handelte.
»Ich fürchte nein«, sagte der Mann schließlich und ließ Colins kleine Hand los. »Meine Frau wünscht sich ein Baby.« Da ihm die aufmerksamen Blicke zweier kindlicher Augenpaare unangenehm waren, fügte er ungehalten an den Heimleiter gerichtet hinzu: »Sie hätten die Kinder nicht hierher bringen dürfen. Wir waren von Anfang an nur an einem Säugling interessiert, das habe ich deutlich zum Ausdruck gebracht.«
Der Heimleiter ließ sich von der Zurechtweisung nicht beeindrucken, er gab sie lediglich weiter, als er zu den Jungen herumfuhr und sie wegschickte. Sein barscher, vorwurfsvoller Tonfall erweckte den Anschein, ihre Gegenwart sei keineswegs seine Idee gewesen, sondern die der Kinder.
Colin ließ Deckers Hand los. »Es ist alles in Ordnung«, sagte er leise zu ihm. »Geh. Ich komme gleich nach.«
Deckers große blaue Augen flogen unsicher zwischen Colin und dem Heimleiter hin und her. Dann rannte er aus dem Büro, nicht wegen der strengen Miene des Heimleiters, sondern weil Colin ihn dazu aufgefordert hatte.
»Ich möchte mich von meinem kleinen Bruder verabschieden.« Colins Stimme klang hell und kindlich, doch der Blick seiner dunklen Augen war ernst und beinahe erwachsen. Er rührte sich nicht vom Fleck, als habe er Wurzeln geschlagen.
Der Heimleiter war im Begriff, hinter dem Schreibtisch hervorzutreten und Colin eigenhändig aus dem Büro zu befördern.
Der Fremde hob abwehrend die Hand. »Ja, natürlich«, sagte er. »Liebes? Der Junge möchte sich von seinem Bruder verabschieden.«
Widerstrebend wandte die Frau den Kopf. Ihr warmes Lächeln erstarb, als sie auf Colin herabsah. Der verträumte Ausdruck in ihren blauen Augen verhärtete sich. »Nein!«, versetzte sie heftig. Ein grauer Schleier bildete sich am Rand ihrer Pupillen wie die beginnende Eisschicht am Ufer eines gefrierenden Sees. »Ich will nicht, dass der Junge mein Baby anfasst. Schau ihn dir an! Man sieht doch, dass er kränkelt. Vielleicht steckt er das Kind an.«
Colin war, als habe sie ihm ins Gesicht geschlagen. Die Worte der Frau jagten einen Schauer durch seinen ausgemergelten Körper. Er spürte, wie ihm die Hitze in die Wangen stieg, teils aus Wut, teils aus Scham. In diesem Augenblick hätte er sich nicht rühren können, selbst wenn er gewollt hätte.
»Ist der Junge etwa krank?«, fragte der Mann den Heimleiter. »Er ist so mager.«
»Er isst schlecht«, entgegnete der Heimleiter. Der Blick, mit dem er Colin maß, verdunkelte sich und enthielt eine deutliche Warnung. »Er hat keinen Appetit. Meine Frau glaubt, der … ehm … Vorfall … hat ihn mehr mitgenommen als die anderen beiden. Es wäre denkbar, da er der Älteste ist.«
Colin unterbrach das Gespräch der Erwachsenen und meldete sich tapfer wieder zu Wort. »Ich möchte meinen Bruder noch einmal in den Arm nehmen.« Damit streckte er die Hände nach dem Baby aus.
Der Fremde ermahnte seine Frau sanft. »Liebes? Was soll denn schon passieren?«
Sie zögerte lange. Colin sah, wie ihr Blick zur Tür flog, als spiele sie mit dem Gedanken zu fliehen. Schließlich legte sie ihm das Baby in die Arme mit einer schroffen Mahnung, es nicht fallen zu lassen.
Colin drückte seinen jüngsten Bruder an die magere Brust und wiegte ihn wie so oft in den vergangenen drei Monaten. Er wandte den Erwachsenen den Rücken zu und entfernte sich ein paar Schritte, ohne auf das hörbare Japsen der Frau zu achten. Er zupfte die Decke des Babys zurecht und nestelte am Kragen seines Batisthemds. »Ich finde dich«, sagte er leise, wobei er kaum die Lippen bewegte. »Das verspreche ich dir, ich finde dich.«
Greydon krähte vergnügt und trommelte mit seiner winzigen Faust gegen Colins Schulter.
»Nun ist es genug«, sagte der Mann. Seine Frau trat einen Schritt vor.
Der Heimleiter wandte sich an Colin. »Gib Greydon zurück.«
Noch ehe Colin gehorchen konnte, wurde ihm sein Brüderchen aus den Armen gerissen. Diesmal wartete er nicht, bis er fortgeschickt wurde. Colin hatte es sehr eilig, das dunkel getäfelte Büro des Heimleiters zu verlassen. Er hielt sich aufrecht mit durchgedrücktem Rücken, nur seine Unterlippe bebte merklich, als er das Zimmer durchquerte. Und er hörte die Worte der Frau kaum, deren Bedeutung er zu diesem Zeitpunkt ohnehin nicht wirklich begriff.
Sie kraulte das Baby unterm Kinn und sagte leise: »Ich glaube nicht, dass mir der Name Greydon gefällt.«
***
Nur drei Wochen später verließ auch Decker Cunningtons Arbeitshaus für Findlinge und Waisenkinder. Colin hatte gehofft, noch etwas länger mit Decker zusammen sein zu können. Aber ein vierjähriges Waisenkind fand in der Regel ziemlich rasch ein neues Zuhause. Hätten die Kinder ihr Schicksal in diesem frühen Alter bereits begriffen, hätten sie sich mit der Aussicht trösten können, in eine Lehre zu gehen oder als Hausangestellte Beschäftigung zu finden, wodurch ihnen ein wesentlich günstigeres Schicksal beschieden war, als im Waisenhaus der Cunningtons zu bleiben, bis sie im Alter von zwölf Jahren gnadenlos auf die Straßen Londons gejagt wurden. Ein Junge, der sich alleine durchs Leben schlagen musste, geriet nur allzu leicht an eine Diebesbande, von der er in der Kunst des Trickdiebstahls unterwiesen wurde, wenn er sich flink und geschickt anstellte. Geriet er allerdings an einen Zuhälter, wurde ihm beigebracht, seinen Körper feilzubieten, bis er entweder zu alt war oder von einer Krankheit vorzeitig dahingerafft wurde.
Colin, der seinem Bruder keines der beiden Schicksale wünschte, tröstete sich mit dem Gedanken, dass Deckers Fortgang aus dem Waisenhaus zu seinem Besten, wenn auch schmerzhaft für ihn als den Ältesten war. Er wünschte sich inständig, sich für seinen Bruder freuen zu können, doch im Grunde seines Herzens war er eifersüchtig und neidisch. Und er hatte Angst. Nun war er ganz allein.
Die Eheleute, die Decker unter einer Reihe anderer Kinder aussuchten, fand Colin sympathischer als das amerikanische Ehepaar, das sich für Grey entschieden hatte. Die Frau war nicht hübsch, hatte aber ein gütiges Lächeln und eine stille Art und verstand es rasch, Deckers ängstliche Scheu zu beschwichtigen. Ihr Ehemann war zurückhaltend, aber höflich und ein wenig unbeholfen, wie er auf Deckers unermüdliche Fragen reagieren sollte, bis seine Frau gutmütig meinte: »Antworte ihm einfach, mon cher. Sprich mit dem Kind, wie du mit mir sprichst.« Danach redete der Mann mit einem volltönenden Bariton, einer Stimme, die Vertrauen einflößte. Colin wünschte sich schuldbewusst, an Deckers Stelle zu sein.
Der Heimleiter wiederholte sein Angebot. »Vielleicht haben Sie auch an Deckers Bruder Interesse?«
Die gütigen Augen der Frau richteten sich auf Colin. Trauer und Schmerz spiegelten sich in ihrem Blick. Und als Colin Mitleid darin erkannte, errötete er beschämt. »Wenn wir könnten, würden wir beide mitnehmen«, sagte die Frau zum Heimleiter. »Mais ce n’est pas possible.«
Der Ehemann nickte. »Ja, meine Frau meint es ehrlich«, bestätigte er. »Wir würden auch ihn nehmen, wenn wir könnten. Aber das Kind muss gesund und kräftig sein. Vor uns liegt eine lange und beschwerliche Reise.«
Colin schlüpfte leise aus dem Büro des Heimleiters. Auf dem schwach erleuchteten Flur holte er tief und abgehackt Luft und schluckte gegen den harten, schmerzenden Knoten in seiner Kehle an. Wenn er die Augen schloss, sah er den mitfühlenden Blick der Frau. Er wollte ihr Mitleid nicht; sie sollte ihm lieber dankbar sein. Oder glaubte sie etwa, der stämmige kleine Körper ihres neuen Sohnes sei eine Laune der Natur?
Es war kurz vor dem Nachtmahl und Colins Magen knurrte hörbar. Es war lange her, seit er dieses Geräusch von sich gegeben hatte. In den Monaten seit ihrer Ankunft im Waisenhaus hatte er sich angewöhnt, nur das Nötigste zu essen, damit seine kleinen Brüder satt wurden.
Er hatte für die beiden getan, was ihm möglich war. Nun musste er an sich selbst denken.
***
Unterernährt und geschwächt, mit glanzlosen, dunklen Augen wie Kohle im mageren Gesicht, vertrug Colin anfangs die größeren Essensportionen schlecht. Ältere Jungen, die es sich zweimal überlegt hatten, sich mit ihm anzulegen, als er seine beiden Brüder beschützte, sahen in ihm nun eine leichte Beute. Und bald bekam er kaum mehr zu essen als in der Zeit, da er seine kleinen Brüder durchfütterte, manchmal sogar weniger.
Zehn Tage nachdem Decker abgeholt worden war, zog Colin sich einen hartnäckigen Husten zu und hielt die anderen Zöglinge in dem zugigen kalten Schlafsaal, in dem die Pritschen nur wenige Zentimeter voneinander entfernt standen, mit seinen ständigen Hustenanfällen wach. Er presste sich beide Hände vor den Mund, um das Husten zu unterdrücken, doch das nützte wenig. In der dritten Nacht hatten Jamie Ferguson und John Turley sich einen Plan zurechtgelegt. Als Colin wieder zu husten begann, standen sie lautlos auf, warfen ihm eine Decke über den Kopf und schlugen mit den Fäusten auf ihn ein. In der folgenden Nacht mussten sie keine Gewalt mehr anwenden. Sie legten ihm ein Kissen übers Gesicht und hielten es fest, bis seine Gegenwehr erlahmte.
Es war Mrs. Cunningtons Idee, Colin könne sich zum Schornsteinfeger eignen. Er war hoch aufgeschossen, hatte schmale Schultern und noch schmalere Hüften und würde sich mühelos in engen Kaminschächten bewegen können.
Erleichtert, Colin endlich loszuwerden, ließ der Heimleiter sich nicht zweimal bitten und schickte den Jungen zu einem Schornsteinfeger in die Lehre, wo er tatsächlich geschickt und wendig durch die engen Schächte kletterte. Doch er hatte keine Ausdauer, ermüdete schnell und machte schlapp. Sein hellblondes Haar war mit einer fettigen Rußschicht überzogen. Colins fiebrig gerötete Gesichtsflecken waren unter Ruß und Asche verborgen und die Blutergüsse, die er von den regelmäßigen Prügeln seines Lehrherrn davontrug, waren von Dreck und Kohlenstaub ohnehin nicht zu unterscheiden.
Nach wenigen Wochen wurde er wieder zu den Cunningtons zurückgeschickt, da er die Voraussetzungen für eine Schornsteinfegerlehre nicht erfüllte. Mr. Cunnington versetzte ihm schallende Ohrfeigen, während seine Frau Zeter und Mordio schrie. Colin brummte zwei Tage der Schädel.
»Mir gefällt die Vorstellung ganz und gar nicht, ihn im Haus zu haben, bis er zwölf ist«, lamentierte Mrs. Cunnington. Sie legte ihren Stickrahmen beiseite, faltete die Hände im Schoß und sah ihren Ehemann erwartungsvoll an. »Dieser Vorwurf in seinen Augen. Ist dir das aufgefallen?«
Ja, es war ihm aufgefallen. Der Heimleiter fuhr fort, seine Pfeife zu reinigen.
»Als sei es unsere Schuld, dass seine Eltern umgekommen sind. Dabei haben wir mehr als unsere Pflicht getan. Das weiß jeder.« Mrs. Cunnington hatte die Angewohnheit, mindestens ein Wort in jedem Satz besonders hervorzuheben, um ihre Meinung deutlicher zum Ausdruck zu bringen. »Ich finde, die Leute hätten bessere Vorsorge für ihre Kinder treffen müssen. Schließlich konnten sie es sich leisten, das sah man doch auf den ersten Blick.«
Mr. Cunnington legte den Reiniger beiseite und begann die Pfeife zu stopfen. Er war genauso enttäuscht wie seine Frau. Das Heimleiterehepaar hatte sich Hoffnungen gemacht, Verwandte von Colin, Decker und Grey ausfindig zu machen. Sie hatten sogar Anzeigen in den großen Londoner Zeitungen geschaltet und aus eigener Tasche bezahlt, in denen die drei Brüder sowie die Umstände des plötzlichen Ablebens ihrer Eltern beschrieben wurden. Doch hatte sich niemand gemeldet, der Anspruch auf die Vormundschaft der Jungen erhob oder irgendwelche Hinweise über lebende Verwandte der Kinder gegeben hätte.
Aus den feinen Kleidern der Kinder und Colins höflichen Umgangsformen hatten die Cunningtons den Schluss gezogen, die Kinder wären wohlhabender Herkunft. Im Burnside Inn an der Poststraße im Norden von London wusste niemand etwas über die Familie zu berichten, die hier eingekehrt war und eine Mahlzeit zu sich genommen hatte. Eine halbe Stunde nachdem sie die Herberge verlassen hatten, wurde ihre Kutsche von Wegelagerern überfallen. Normalerweise endeten solche Überfälle nicht mit Mord und Totschlag, doch es gab immer Ausnahmen. Im Falle der Eltern der Kinder und ihres Kutschers machten die Banditen eine Ausnahme. Die Behörden wussten nicht, was sie mit drei verwaisten Kindern anfangen sollten, und lieferten sie im Waisenhaus ab.
Die Cunningtons befragten Colin nach seiner Familie und seiner Erziehung, fanden seine Erzählungen freilich reichlich fantastisch und gelangten bald zu der Einsicht, dass ein Achtjähriger noch nicht in der Lage war, die Wahrheit zu erkennen. Die erhöhte Aufmerksamkeit der ersten Tage schwand und die drei Kinder wurden nicht besser und nicht schlechter behandelt als die anderen Insassen des Waisenhauses.
Als der Heimleiter fertig war, seine Pfeife zu stopfen, zündete er sie an und paffte mehrmals, bis sie ordentlich zog. Dann seufzte er. »Du hast natürlich Recht«, meinte er. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, seiner Frau stets zuzustimmen, auch wenn er anderer Meinung war. In diesem Fall aber meinte er es ehrlich. »Er kann nicht hier bleiben. Er ist zu schwach, um zu arbeiten, und mit seiner Schwindsucht steckt er womöglich die anderen an.«
Mrs. Cunningtons Augen weiteten sich. »Schwindsucht?« Sie mussten Colin schleunigst loswerden. Der Junge durfte keinesfalls unter ihrem Dach sterben. Die anderen Kinder könnten krank werden. Auch sie und ihr Ehemann waren nicht vor Ansteckung geschützt. Das Waisenhaus könnte geschlossen werden und sie würden ihre Existenz verlieren. »Meinst du wirklich, er hat die Schwindsucht?«
Mr. Cunnington zuckte die Achseln und paffte Rauchwolken in die Luft.
Mrs. Cunnington war der Meinung, ihr Mann habe sich bereits einen Plan zurechtgelegt, sonst würde er nicht so gelassen reagieren. »Erzähle mir von deinem Plan.«
***
Jack Quincy sprach am nächsten Tag bei den Cunningtons vor. Er war ein Riese von einem Mann und sein Bass dröhnte tief und hohl. Arme und Beine waren dick wie Baumstämme. Sein Händedruck war kraftvoll und warm, seine Umgangsformen eher derb. Jacks Nase war mehr als einmal gebrochen und jedes Mal schief zusammengewachsen. Böse Zungen behaupteten, Jack Quincy warte auf einen Schlag, der ihm die Nase wieder zurechtrückte.
Als er in das Büro des Heimleiters stapfte, umweht vom Geruch nach frischem Wind und Salzwasser, zog Colin den Duft nach Abenteuer tief in seine Lungen ein.
Jack Quincy wartete nicht, bis der Heimleiter ihm die Hand reichte. Er packte sie, drückte zweimal zu und sagte ohne Vorankündigung: »Wo ist der Junge, von dem Sie mir erzählt haben?«
»Hinter Ihnen«, erwiderte Mr. Cunnington und schaute über Quincys Schulter zu Colin. »Wollen Sie sich setzen und über die Bedingungen sprechen?«
Quincy musterte Colin flüchtig. »An dem ist aber nicht viel dran«, bemerkte er trocken.
»Er isst nicht«, erklärte der Heimleiter. »Wenigstens nicht viel. Dadurch kommt er Sie nicht teuer.«
»Dadurch kippt er jeden Moment aus den Pantinen.« Jack verengte die Augen und stieß einen wulstigen Finger in Richtung des Heimleiters. »Selbst die Fische würden dieses Klappergestell als Köder verschmähen. Was versuchen Sie mir da anzudrehen, Cunnington?« Seine Stimme war laut geworden. »In zwei Stunden legt mein Schiff ab und Sie sagten, Sie hätten einen geeigneten Jungen für mich. Was soll ich mit dieser Bohnenstange anfangen?«
Mr. Cunnington straffte indigniert die Schultern. Die grobschlächtige Art des Yankees fand er abscheulich. »Er ist genau das, was ich Ihnen versprochen habe.«
»Er ist krank. Sie haben nichts davon gesagt, dass er krank ist.« Wie aufs Stichwort musste Colin husten. Quincy warf ihm einen Blick über die Schulter zu und musterte das abgezehrte Gesicht, die dunklen Schatten unter den Augen, die hohlen Wangen und bleichen Lippen. »Hat er die Schwindsucht?«
»Es ist nur eine harmlose Erkältung.«
Quincy trat auf Colin zu und hob ihm das Kinn. »Ist das wahr?«
Colin, der befürchtet hatte, der Riese würde ihm die Kieferknochen brechen, wunderte sich über die erstaunlich sanfte Berührung des Mannes. Seine Lungen drohten zu platzen, als er mühsam den Husten unterdrückte. »Es ist wahr, Sir«, sagte er. »Kein Doktor hat je etwas erwähnt.«
Quincy durchschaute Colins Spiel. Seine Worte waren nicht gelogen. Doch die Wahrheit war, dass kein Doktor ihn je untersucht hatte. »Willst du mit mir kommen, Junge?« Quincy hielt Colins spitzes Kinn immer noch hoch und registrierte den Mumm und die Entschlossenheit im Blick des Jungen. »Na?«
»Colin, Sir«, antwortete er ernsthaft. »Ich heiße Colin Thorne. Ja, ich will mit Ihnen kommen.«
»Obwohl du weißt, dass ich dich über die Reling der Sea Dancer befördere, wenn du nicht arbeiten kannst?«
Colin bemühte sich, einen kräftigen Eindruck zu machen, und hielt sich kerzengerade. »Dieses Risiko gehe ich ein, Sir.«
Jack Quincy ließ Colins Kinn los. »Wie viel wollen Sie für ihn?«, fragte er den Heimleiter.
»Drei Pfund Sterling.«
»Das ist ein Vermögen«, knurrte Quincy.
Angst krallte sich um Colins Herz. Wenn Cunnington nicht mit sich handeln ließ und Quincy sich weigerte, den Preis zu bezahlen, was dann? »Wenn Sie gestatten, Sir«, meldete er sich ungefragt zu Wort. »Es wäre mir eine Ehre, Sie in voller Höhe zu entschädigen. Mit Zinsen, falls Sie es wünschen.«
Quincy blinzelte. »Bei Gott, er redet wie ein verdammter Bankier«, sagte er mehr zu sich als an Cunnington gerichtet. »Wie alt bist du, Junge?«
»Zehn«, antwortete Colin und überkreuzte heimlich zwei Finger.
»Zwölf«, sagte Cunnington gleichzeitig.
Jack Quincy knurrte übellaunig und glaubte keinem. »Zum Teufel, was soll’s! Ich brauche den Jungen für diese Fahrt.« Er öffnete seinen Wollmantel, griff in seine Innentasche und holte drei Sovereigns hervor. Eine der Münzen ließ er geschickt durch seine Finger gleiten, ehe er sie alle drei auf den Schreibtisch legte. »Bedienen Sie sich.«
Mr. Cunnington beeilte sich, die Goldmünzen einzusammeln. »Hol deine Sachen, Colin, und warte auf Mr. Quincy am Haupttor.«
Colin zögerte, warf Quincy einen fragenden Blick zu und fürchtete beinahe, mit seinem Bündel vor dem Tor zu stehen, ohne dass ihn jemand mitnahm.
Jack Quincy rieb sich das Kinn, um sein Schmunzeln zu verbergen. Der kleine verhungerte Kerl hatte etwas an sich, das ihm gefiel. »Nun lauf schon, Junge. Ich lass dich nicht im Stich.«
Colin machte kehrt und verließ das Büro mit gestrafften Schultern und hoch erhobenen Hauptes.
Quincy schaute ihm nach. Als er Colin außer Hörweite wusste, wandte er sich an den Heimleiter. »Eines sage ich Ihnen, Cunnington: Wenn der Junge stirbt, bevor die Sea Dancer in Boston anlegt, komme ich wieder und nehme das gesamte Waisenhaus auseinander.«
»Er schafft es bis Boston. Danach allerdings …« Seine Stimme verlor sich und er zuckte die Achseln.
»Danach ist es nicht mehr wichtig.«
Die Sea Dancer verließ den Hafen von London mit einer Verspätung von drei Stunden. Aus Furcht, die Cunningtons könnten ihre Meinung ändern oder Jack Quincy könne sich den Handel noch einmal überlegen, stand Colin beim Warten Höllenqualen aus.
Der Knoten in seiner Magengrube löste sich erst, als Englands Küstenlinie in der Ferne verschwand.
Eine halbe Ozeanüberquerung später traf Mr. Elliot Willoughby aus Rosefield in London ein und erkundigte sich nach dem Weg zu Cunningtons Arbeitshaus für Findlinge und Waisenkinder. Der Rechtsanwalt war allem Anschein nach daran interessiert, Auskünfte über den Verbleib von drei Kindern einzuholen, deren Familienname Thorne lautete.
Kapitel 1
London, Juni 1841
Das Grollen des Donners scheuchte ihn aus dem Bett. Colin hatte nicht tief geschlafen, nur ein wenig gedöst, dennoch hatte er keine große Lust, sich aus der Bettdecke zu schälen und den prallen Schenkel von sich zu schieben, der quer über seinen Beinen lag.
Auf bloßen Füßen tappte er zum Fenster und zog den vergilbten Vorhang zurück. Ein Netzwerk greller Blitze durchzuckte den Himmel und tauchte seinen nackten Körper für wenige Sekunden in gleißende Helligkeit. Colin legte die flache Hand gegen die Glasscheibe. Als kurz darauf der nächste Donnerschlag erdröhnte, spürte er die Vibration bis in den Arm hinauf.
Er griff nach seiner Hose, die über der Armlehne des einzigen Stuhls hing, und schlüpfte hinein. Wieder zuckte ein Blitz über den Himmel und erhellte das Zimmer. Colin schaute zum Bett und vergewisserte sich, dass die Frau schlief. Umso besser, dachte er, während er das Fenster entriegelte und aufstieß. Vielleicht würde ihm ihr Name noch einfallen.
Er zog die feuchtwarme Nachtluft tief ein, setzte sich seitlich aufs Fensterbrett, zog ein Knie an und schlang die Hände darum. Die ersten dicken Regentropfen klatschten an seine linke Schulter und liefen ihm den Arm bis zum Ellbogen entlang.
Colin lehnte den Kopf gegen den Fensterrahmen. Der nächste Donnerschlag vibrierte durch seinen ganzen Körper. Er spürte das Kribbeln in den Fußsohlen, die Beine hinauf und in seiner Brust. Er dachte an den Geruch des Meeres. Obwohl er erst seit acht Tagen an Land war, wollte er seit sechs Tagen wieder auf dem Schiff sein.
Der Regen fiel nun heftiger. Die Stiche der dicken schweren Regentropfen waren freilich harmlos im Vergleich zu dem, was Colin am Ruder der Remington Mystic auszuhalten hatte. Dort stach die sprühende Gischt nadelspitz auf ihn ein und die mannshohen Brecher, die über den Bug krachten, rissen selbst erfahrene Seeleute in die Tiefe der aufgewühlten See, wenn sie nicht auf der Hut waren.
Das Zimmer, in dem Colin sich in der Herberge einquartiert hatte, wies auf die Landstraße, die zu dieser Stunde menschenleer war. Colin war vor Einbruch der Nacht mit der letzten Postkutsche aus London angekommen. Er und Aubrey Jones waren die einzigen Fahrgäste. Aubrey hatte dem Mädchen, das ihnen das Abendessen servierte, schöne Augen gemacht und war kurz danach mit ihr in seinem Zimmer verschwunden. Colin erwartete die Nacht alleine zu verbringen, doch wie der Zufall es wollte, hatte das Serviermädchen eine Schwester, mit der Colin sich vergnügte.
»He du«, meldete sich eine verschlafene Stimme vom Bett. »Geh vom Fenster weg. Du holst dir den Tod und mir ist kalt.« Als Colin nicht einmal den Kopf in ihre Richtung wandte, richtete sie sich halb auf und tätschelte das leere Bett neben sich. »Sei lieb und komm zu Molly, Schätzchen.«
Molly. So hieß die Kleine. »Leg dich wieder schlafen«, entgegnete er weder freundlich noch bittend. Colin Thorne war daran gewöhnt, Befehle zu erteilen.
»Kein Grund, mich anzuschnauzen«, versetzte Molly, die nicht auf den Mund gefallen war. »Oder hast du nicht genug von unseren Spielchen und geisterst deshalb mitten in der Nacht herum? Komm, ich hab noch mehr zu bieten, wenn du nichts dagegen hast.« Sie gähnte mit offenem Mund.
Wenn sie nur nicht so viel reden würde, dachte Colin. Sein Blick löste sich von der menschenleeren Straße und wanderte durchs Zimmer, nicht etwa zu Molly, sondern zum Badezuber, der vor Stunden für ihn vorbereitet worden war, ohne dass er Gelegenheit gehabt hätte, sich ins warme Wasser zu setzen. Nun hatte er das dringende Bedürfnis zu baden. »Wenn du nichts dagegen hast«, versetzte er, »kannst du mir das Badewasser wärmen.«
Molly fuhr hoch, ohne sich die Mühe zu machen, ihre Nacktheit zu bedecken. Ihre schweren Brüste wogten, als sie ihre Entrüstung zum Ausdruck brachte. »Wirfst du mich etwa aus deinem Bett?«
So etwas schien ihr noch nie passiert zu sein. »Du hättest dich wieder schlafen legen sollen, als ich es dir sagte«, meinte Colin gleichmütig und wandte sich ab. Aus dem Augenwinkel nahm er unten im Vorgarten eine Bewegung wahr. Die Gestalt war verschwunden, als er sich vorbeugte. Ein nächtlicher Gast? wunderte er sich. Aber er hatte weder Pferde noch Wagen bemerkt. Unten fiel die schwere Eingangstür ins Schloss und bestätigte ihm die Ankunft eines späten Gastes. Vermutlich ein Reisender, der vom Gewitter überrascht worden war. Colin hätte ihm sagen können, dass kein Grund zur Sorge bestand. Der Regen ließ bereits nach und das Gewitter zog in südöstlicher Richtung ab.
Molly schien gute Lust zu haben, Colin aus dem offenen Fenster zu werfen, besann sich aber eines Besseren. Schließlich hatte er sie noch nicht bezahlt.
»Auf dem Nachtschränkchen«, meinte er.
»Gedanken lesen kannst du also auch.« Molly sammelte die Münzen ein, die er für sie hingelegt hatte, und sprang aus dem Bett. Mit den Geldstücken in der Faust begann sie sich anzuziehen. »Meine Schwester sagte mir, warum du und dein Freund hier seid«, erklärte sie. »Und ich dumme Gans hatte Mitleid mit einem Mann, der dem Tod ins Auge blickt. Eins kann ich dir sagen, mich kümmert es keinen Pfifferling, ob Seine Lordschaft dir eine Bleikugel in den Kopf oder ins Herz jagt.«
»Solange sie nur trifft«, ergänzte Colin trocken.
»Da hast du verdammt Recht.«
Colin sprang federnd vom Fenstersims. Er spürte Mollys zornigen Blick auf sich, als er zur Tür ging. Doch als er sich wieder umdrehte, las er Bedauern und vielleicht sogar Sehnsucht darin. Seine dunklen Augen verengten sich, als er Mollys hübsches herzförmiges Gesicht betrachtete. Hatte die Kleine sich etwa in ihn verliebt?
»Bilde dir bloß nichts darauf ein«, zischte sie.
Der Anflug eines Lächelns huschte über Colins Züge. »Wer kann denn hier Gedanken lesen?«
Molly blieb die Antwort im Halse stecken. Er hatte kein Recht, sie so anzusehen und ihr Gedanken zu verbieten, die sie noch gar nicht zu Ende gedacht hatte. Es war dieses flüchtige Lächeln, das ihr den Atem nahm. Oder auch das kurze Aufflackern von Interesse, das seine Augen noch mehr verdunkelte, Augen, die schwarz blitzten wie polierter Onyx. Es sollte ihr nur recht sein, wenn er sie hinauswarf. Würde sie die ganze Nacht mit ihm verbringen, wäre sie am nächsten Morgen krank vor Liebe.
»Hochnäsiger Mistkerl«, brummte sie in sich hinein, knöpfte den Rock zu und schlüpfte in die Bluse, ohne sie zuzubinden. Er sollte ruhig einen letzten Blick auf etwas bekommen, was sie ihm nie wieder geben würde, wenigstens nicht, wenn er nicht darum bat.
Colin war im Begriff, die Tür für sie zu öffnen, als es klopfte. Der zaghafte Versuch eines Klopfens. Colin wusste, dass es nicht Aubrey sein konnte. Sein Bootsmann hatte Fäuste wie Hämmer. Sein Klopfen hätte die Tür erzittern lassen.
Da Colin nicht reagierte, wiederholte sich das schüchterne Klopfen. Er warf Molly einen fragenden Blick zu, die verdutzt mit den Schultern zuckte. Colin legte einen Finger an die Lippen. Molly nickte stumm.
Colin bückte sich nach seinen Stiefeln neben der Tür und holte aus dem rechten einen Dolch aus dem Lederfutteral, wiegte ihn prüfend in der Hand und öffnete die Tür einen Spalt.
Die Gestalt auf dem Flur war völlig durchnässt. Von dem bodenlangen Kapuzenumhang tropfte Wasser auf die Holzdielen. Der Körper unter dem Wollumhang schlotterte.
»Was wünschen Sie?«, fragte Colin barsch. Es war zu düster, um die Gesichtszüge des Fremden zu erkennen.
»Der Wirt sagt, ich finde Captain Thorne hier.« Die Stimme klang heiser, wurde vom Aufeinanderschlagen klappernder Zähne begleitet und gehörte zweifellos einer Frau.
Colin öffnete die Tür weiter und gewährte der ungebetenen Besucherin einen Blick auf den Dolch in seiner Hand. Als sie sichtlich erschrak, wusste er, dass sie keine Bedrohung darstellte, und ließ sie eintreten. An Molly gewandt sagte er: »Vielleicht solltest du dich jetzt endlich um warmes Wasser kümmern.«
»Ich bin also entlassen, wie?«, entgegnete sie schnippisch. »Und es ist auch schon für Ersatz im Bett gesorgt. Soll sie dir doch das verdammte Wasser heiß machen.«
Die Fremde meldete sich zu Wort. »Ich wüsste nicht, aus welchem Grund.«
Colin fing geschickt die Tür auf, die Molly hinter sich zuwerfen wollte. »Sie waren nicht gemeint«, sagte er. »Seit Stunden will ich ein heißes Bad nehmen und werde ständig unterbrochen.« Seine Besucherin wandte den Kopf zum Bett und zog vermutlich die richtigen Schlüsse. »Wie Sie sehen, sind Sie nicht die erste Unterbrechung.«
Colin erwartete eine Entgegnung. Seine Besucherin schien jedoch in den Anblick der zerwühlten Bettlaken und Kissen versunken zu sein. Colin legte ihr die flache Seite seiner Klinge unters Kinn, ließ sie das kühle Metall spüren und zog ihre Aufmerksamkeit wieder auf sich. »So ist es besser«, meinte er.
Die Dolchspitze vibrierte leicht, da die Frau immer noch vor Kälte schlotterte. Seine dunklen Augen verengten sich. Die durchnässte Kapuze hing ihr zu weit ins Gesicht, um ihre Züge zu erkennen. »Nehmen Sie den Umhang ab.«
Sein Befehlston schreckte sie aus ihrer Lethargie auf. »Ich behalte ihn lieber an, vielen Dank.«
»Das war nicht als Vorschlag gemeint.«
Sie hob die Hände und hielt in der Bewegung inne. Colin durchtrennte die Seidenschleife mit einem raschen Schnitt. Die Kapuze fiel ihr in den Rücken und der Umhang öffnete sich. »Tun Sie, was ich sage, wenn ich es sage«, meinte er ungerührt. »Dann kommen Sie mit heiler Haut und heilen Kleidern aus diesem Zimmer.«
Sie nickte knapp und wich seinem forschenden Blick aus, ohne zu erröten. Sein Blick war ihr zwar unbehaglich, doch er hatte nichts Dreistes an sich, schien eher ein sachliches Taxieren. Sie kam sich vor wie ein exotisches Insekt unter dem Vergrößerungsglas eines Forschers.
Colin ließ das Messer sinken. Mit einer blitzschnellen Drehung des Handgelenks schleuderte er die Klinge, die durch die Luft kreiselte, ehe sie im hölzernen Kopfteil des Bettes stecken blieb. Seine ruckartige Bewegung ließ die Besucherin kaum merklich zusammenzucken, wie Colin verblüfft feststellte. »Ziehen Sie den Umhang aus.«
Diesmal gehorchte sie und ließ den Umhang von den Schultern gleiten. Statt den durchnässten Wollmantel aus der Hand zu geben, hielt sie sich krampfhaft daran fest.
Colin trat an den Stuhl, griff nach seinem Hemd, schlüpfte in die Ärmel und steckte die Hemdschöße in den Hosenbund. Die Besucherin hielt den Blick abgewandt.
»Ich nehme an, Sie sind nicht eine von Mollys Schwestern«, meinte er.
»Wer?« Dann verstand sie. »Nein. O nein. Ich kenne die Dame nicht.«
Colin nahm die restlichen Kleidungsstücke vom Stuhl, warf sie aufs Bett, setzte sich und streckte die Beine von sich. Die Fremde stand immer noch abgewandt, unschlüssig, ob sie gehen oder bleiben sollte. Colin studierte die Silhouette ihrer zierlichen Gestalt. Ihre gespannten Schultern und das gereckte Kinn wiesen auf ihre Entschlossenheit hin, ihren Auftrag oder was immer sie zu ihm geführt hatte auszuführen.
Ihre Zähne hörten auf zu klappern und ihre Gesichtszüge entspannten sich. Er glaubte zu erkennen, dass sie an ihrer Unterlippe nagte.
Er ließ ihr Zeit. Er war nicht müde. Colin kam mit wenig Schlaf aus. Und diese seltsame, unverhoffte Begegnung schien ihm amüsanter als die Vorstellung, dass Aubrey sich vermutlich mit Molly und deren Schwester vergnügte.
Colin beobachtete, wie sein ungebetener Gast tief Luft holte und langsam ausatmete. Dann hängte sie den Umhang an den Türhaken, strich ihn glatt und drückte Wasser aus dem Saum. Sie hatte also vor, eine Weile zu bleiben.
»Ich mache das Wasser für Ihr Bad heiß«, meinte sie leise.
Er wollte sagen, sein Bad könne warten, doch sie schöpfte bereits Wasser aus dem Bottich in den Kessel über dem Kaminfeuer. Dann kniete sie sich auf die Steineinfassung und legte Späne zurecht. Nach einigen erfolglosen Versuchen gelang es ihr, Feuer zu machen.
Colin verfolgte ihre Bewegungen aufmerksam. Sie war klein und zierlich gebaut, hatte dünne Arme, zarte Schultern und eine hoch angesetzte, schmale Taille. Ihr Haar hatte die Farbe bittersüßer Schokolade, wie er im Widerschein der Flammen feststellte. Im fahlen Kerzenschein hatte er es für beinahe schwarz gehalten. Nun sah er die rötlich-goldenen und kaffeebraunen Farbtupfer, die ihrem Haar diesen tiefen Glanz verliehen. Sie trug es nach hinten gekämmt zu einem lockeren Zopf geflochten, der ihr bis zur Rückenmitte reichte. Eine eher praktische Frisur als der Mode gehorchend. Viele Frauen flochten ihr Haar nachts zu Zöpfen, nachdem sie es mit den obligaten hundert Bürstenstrichen gepflegt hatten. Er sah dieser Tätigkeit gerne zu, im Bett liegend und auf die jeweilige Dame wartend, zählte die Bürstenstriche mit und sah zu, wie das Haar knisternd tanzte und flog, wenn es von der Bürste bearbeitet wurde. An den glatten hellen Wangen seiner Besucherin bebten umbrabraune Löckchen.
Sie richtete sich langsam auf, wischte sich die Hände am Rock ab und blickte unsicher in Colins Richtung. Er beobachtete sie aus verengten, prüfenden Augen. Sie räusperte sich.
»Sie werden sich fragen, wer ich bin«, erklärte sie endlich.
»Nein«, entgegnete er leichthin. »Ich denke, das weiß ich bereits, Miss Leyden.« Sie bekam große Augen, was seine Annahme bestätigte. Hatte sie blaue oder graue Augen? Im Dämmerlicht war das schwer zu erkennen. »Ich glaube sogar zu wissen, was Sie zu mir führt. Ich weiß allerdings nicht, was Sie mir für sein erbärmliches Leben bieten wollen.«
Mercedes Leyden ließ entmutigt die Arme sinken. »Woher wissen Sie …?«
»Weybourne Park ist nicht weit von hier. Ich werde morgen früh dort erwartet. Den Weg zu diesem Gasthof schafft man mühelos zu Fuß. Und Sie kamen zu Fuß. Ich habe gesehen, wie Sie das Gasthaus betraten. Ich weiß außerdem, dass der Graf zwei Töchter und zwei Söhne hat. Es war mir ein Anliegen, einige Einzelheiten über den Mann zu erfahren, der mich zum Duell fordert. Da Sie nicht einer seiner Söhne sein können und Ihre Kleider zu nobel sind, um einer Bediensteten zu gehören, gehe ich davon aus, dass Sie eine seiner Töchter sind.«
»Ich bin seine Nichte.«
Colin überlegte kurz. »Aha«, meinte er gedehnt. »Ich erinnere mich. Die arme Verwandte.«
Sie zuckte ein wenig zusammen, ohne zu widersprechen. Mercedes hatte die Worte schon oft gehört, allerdings nie so unverblümt. »Die höfliche Form, diesen Umstand in ein Gespräch einzuflechten, wäre abzuwarten, bis ich den Rücken gekehrt habe. Auf diese Weise könnten Sie annehmen, ich hätte die Bemerkung nicht gehört. Obwohl höfliche Umgangsformen von Amerikanern nicht sonderlich geschätzt werden.«
Colin zog anerkennend eine Braue hoch. Seine Mundwinkel kräuselten sich unmerklich. »Das trifft jedenfalls auf mich zu«, versetzte er. »Und darüber sollten Sie froh sein. Wäre ich Engländer, würde mir der Anstand verbieten, Sie in meinem Schlafzimmer zu empfangen. Wo wären Sie dann?«
»Auf dem Flur vielleicht?«, gab sie zurück. Mercedes stellte fest, dass ihre scherzhafte Bemerkung sein Lächeln keineswegs vertiefte. Er gehörte nicht zu den Männern, denen ein sorgloses Feixen oder gar ein Lachen leicht entkam. Den Faltenkranz um seine Augen verdankte er vermutlich der Sonne und der salzigen Gischt. Seine Jugend hatte sich eigentlich nur in seinem von der Sonne gebleichten Blondhaar erhalten, das seinen Kopf wie ein goldener Helm umgab. Seine dunklen Augen standen in verblüffendem Gegensatz dazu, leuchteten tiefbraun und funkelten so eindringlich, dass sie das Bild seines Gegenübers reflektierten und dabei den Einblick in sein Inneres verwehrten.
Colin erhob sich. »Warum setzen Sie sich nicht, Miss Leyden? Ich kümmere mich selbst um mein Badewasser. Es sei denn, Sie fühlen sich beim offenen Feuer wohl.«
Sie würde sich erst wieder wohlfühlen, wenn sie dieses Zimmer verlassen hatte, oder vielleicht nicht einmal dann. Ein Schauer durchflog sie.
»Legen Sie sich eine Decke um die Schultern.«
Mercedes’ Blick glitt zu dem Dolch, der am Kopfende des Bettes steckte. Er würde nicht zögern, sie wieder zu bedrohen. Wortlos nahm sie eine Decke vom Bett und setzte sich.
Colin stocherte im Feuer. Durch das offene Fenster wehte der Nachtwind, bauschte die Vorhänge und ließ Schatten über die nackten Wände flackern. Colin lehnte den Schürhaken an die Kamineinfassung, schloss das Fenster, lehnte sich daran und verschränkte die Arme. »Hat Weybourne Sie geschickt?«
Mit einer leichten Drehung des Oberkörpers wandte Mercedes sich ihm zu. Sie hatte das Bedürfnis, die Beine anzuziehen und die Füße unter ihrem Rock zu wärmen, da ihre Schuhe und Strümpfe völlig durchnässt waren.
»Du meine Güte.« Colin stieß sich vom Fenster ab und ging vor ihr in die Hocke. »Geben Sie mir Ihre Füße.« Sie war zu verblüfft, um zu reagieren, und Colin griff ihr ungeniert unter den Rocksaum, umfing ihre Fußknöchel, zog ihr Schuhe und Strümpfe aus und rieb ihr die nackten Füße. »Hat Weybourne Sie geschickt?«, fragte er erneut.
Demütigend, das war das Wort, das Mercedes durch den Kopf schoss. Und gleichzeitig fragte sie sich, wieso sie seine Berührung nicht als demütigend empfand. In ihrem ganzen Leben hatte sie noch niemand so intim angefasst, weder Mann noch Frau, und dennoch war sie davon nicht peinlich berührt. Ganz im Gegenteil. Wohlige Empfindungen durchströmten sie. Erst als er mit dem Rubbeln innehielt, wurde Mercedes bewusst, dass er auf Antwort wartete.
Sie entzog ihm ihre Füße, strich den Rock sittsam nach unten und fand ihre Stimme wieder. »Mein Onkel weiß nichts von meinem Besuch.«
Der Graf von Weybourne schien Colin kein besonders aufrichtiger Charakter zu sein. »Wirklich?«, fragte er skeptisch. »Ich gestehe, das verstärkt meine Neugier zu erfahren, was Sie zu mir führt.«
Mercedes beobachtete, wie der Captain sich aufrichtete und an den Kamin trat. Dieser Mann hatte eine merkwürdige Ausstrahlung. Der kühne Schwung seiner Nase, das unmerkliche Lächeln, der wachsame Blick seiner dunklen Augen, die kantige, glatt rasierte Kinnpartie, die Art, wie er den Kopf seitlich neigte, als höre er nicht nur zu, sondern horche auf eine lauernde Gefahr wie ein Raubtier auf dem Sprung, alles an ihm war ungewöhnlich.
»Ich weiß, dass Sie beabsichtigen, sich morgen früh mit meinem Onkel zu treffen.«
»Es ist nach Mitternacht«, entgegnete er. »Ich vermute, Sie sprechen von heute Morgen.«
Die Knöchel ihrer im Schoß verschränkten Hände wurden weiß im Bemühen, ihre Finger ruhig zu halten. »Ja. Sie haben natürlich Recht. Heute Morgen. Am See im Park von Weybourne. Ich glaube, Sie wählten Pistolen.«
»Wie es …«, er suchte nach dem passenden Wort, »die Regeln vorschreiben. Ihr Onkel war es, der mich forderte.«
»Er war betrunken.«
»Verzeihen Sie«, entgegnete Colin mit einem sarkastischen Unterton. »Ich erinnere mich nicht, Sie am Dienstag vor einer Woche im Club Ihres Onkels gesehen zu haben.«
»Sie wissen, dass ich nicht dort gewesen sein kann, da Frauen nicht zugelassen sind.«
»Das weiß ich sehr wohl, frage mich aber, ob Sie es wissen.« Er steckte den Zeigefinger in den Kessel. Das Wasser war lauwarm. »Wieso behaupten Sie, er sei betrunken gewesen?«
»Weil er es mir gesagt hat.«
»Und Sie glauben ihm«, entgegnete Colin ungerührt. »Ich frage mich nur, wieso.«
Wieso nicht, dachte Mercedes. Ihr Onkel trank viel. Wallace Leyden, der sechste Graf von Weybourne, war meist sternhagelvoll, wenn er sein Schlafzimmer aufsuchte. Und Mercedes konnte sich nicht denken, dass er einen Abend in seinem Club verbrachte, ohne eine Karaffe Brandy zu leeren. »Ich habe meine Gründe«, antwortete sie.
»Oh, ich zweifle nicht daran, dass er fast jeden Tag betrunken ist, doch letzten Dienstag war er nüchtern. Wollen Sie Beweise?«
»Nein.« Mercedes schüttelte den Kopf. Sie glaubte ihm. Es fiel ihr nicht schwer, dem Wort eines Fremden, selbst eines Amerikaners, mehr Glauben zu schenken als dem ihres Onkels. Sie kannte Graf von Weybourne durch und durch, kannte ihn vielleicht besser als seine eigenen Kinder. Und Lügen zählte zu seinen kleineren Verfehlungen. »Möglicherweise war er nüchtern«, fügte sie hinzu. »Aber er konnte nicht klar denken.«
»In diesem Punkt stimme ich Ihnen zu. Eine Reihe von Menschen, darunter auch einige, die sich seine Freunde nennen, bemühten sich, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Er aber wollte nicht hören.«
»Er hatte doch alles zu verlieren«, entgegnete sie beschwörend.
»Er hatte nur seinen Besitz zu verlieren«, entgegnete Colin. »Bevor er mich forderte, stand sein Leben nicht auf dem Spiel.«
Mercedes erbleichte. Die Anstrengungen der letzten Woche waren in ihren klaren grauen Augen zu lesen. Der kobaltblaue Ring, der ihre Iris umrandete, verdunkelte sich. Sie nagte wieder an ihrer Unterlippe. Nach einer Weile sagte sie bekümmert: »Dann ist es also wahr. Sie haben die Absicht, ihn zu töten.« Sie beobachtete ihn scharf, überlegte, ob er es abstreiten würde und ob sie ihm diesmal Glauben schenken konnte, wenn er verneinte. Sie hätte sich die Mühe ersparen können. Er bestritt nichts.
»Wenn er mich nicht zuvor tötet.«
Sie schloss kurz die Augen. Wo sollte sie leben, wenn es Weybourne Park nicht mehr gab? Wohin sollte sie gehen? Chloe war wenigstens bereits verlobt und Sylvia würde auch ohne Mitgift noch eine einigermaßen gute Partie machen, doch die Zwillinge blieben in ihrer Verantwortung. Wie sollte sie die Kinder ernähren, wie ihnen ein Dach über dem Kopf geben?
Mercedes spürte, wie ihre Eingeweide sich verkrampften, als ihre Gedanken durcheinander wirbelten. Es war nicht ihre Art, die Fassung zu verlieren. Sie war praktisch und verantwortungsbewusst veranlagt und behielt stets einen kühlen Kopf. Ihre Tugenden waren Ehrgefühl, Aufrichtigkeit, Treue und Vertrauenswürdigkeit. Und wie weit war sie damit gekommen? Sie wäre besser dran, wenn sie eine Neigung zu Hinterhältigkeit und Verrat hätte. Mit diesem nächtlichen Besuch hatte sie einen guten Anfang gemacht. Ein selbstironisches Lächeln umspielte ihre Lippen.
Colin, der sie nicht aus den Augen ließ, sah, wie ihre Mundwinkel sich leicht nach oben zogen. »Finden Sie die Idee, dass Ihr Onkel mich umbringt, etwa amüsant?«
Im ersten Moment wusste sie nicht, was er damit meinte. Dann erinnerte sie sich seiner vorangegangenen Worte. »O nein«, beeilte sie sich zu versichern. »Daran habe ich nicht gedacht. Ich …«
»Ja?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nichts.« Wie könnte sie ihm erklären, dass sie sich entgegen ihrer sonstigen Art verhielt, dass sie normalerweise Weybourne Park niemals nach Einbruch der Dunkelheit verlassen würde, schon gar nicht allein und zu Fuß? Unter keinen Umständen würde sie den Fuß über die Schwelle eines Gasthauses setzen und sie würde nicht einmal im Traum daran gedacht haben, einen Herrn, noch dazu einen wildfremden Amerikaner, auf seinem Zimmer aufzusuchen.
Colin prüfte das Wasser im Kessel erneut, das nun heiß genug war. Er zog ein Laken vom Bett, wickelte sich einen Zipfel um die rechte Hand, um sich nicht am eisernen Griff zu verbrennen, und goss das dampfende Wasser in den Bottich. Vermischt mit dem darin verbliebenen Wasser ergab es eine angenehme Badetemperatur. Nachdem er den Kessel auf dem Fußboden abgestellt hatte, machte er sich daran, sein Hemd aus der Hose zu ziehen.
»Wollen Sie etwa jetzt baden?«, fragte sie.
»Ich warte jedenfalls nicht, bis das Wasser wieder abkühlt.«
»Aber ich bin immer noch da.«
»Haben Sie vor, sich demnächst zu verabschieden?«
»Nicht ehe wir …«
»Das dachte ich mir.« Er hatte sein Hemd ausgezogen und hakte die Daumen in den Hosenbund.
Mercedes tat etwas völlig Unerwartetes. Sie drehte sich weder in ihrem Stuhl um, noch wandte sie den Kopf ab, zuckte nicht einmal mit den Wimpern. Sie starrte ihn einfach an.
Colin begann die Hosen von den Hüften zu streifen. Sie wandte immer noch nicht den Blick. Er schob die Hose weiter nach unten. Sein flacher, brettharter Bauch war nun entblößt und sie hatte immer noch keinen Mucks getan. Colin fluchte leise und schlug mit dem nackten Fuß gegen die Zinnwanne. Wasser schwappte über. »Na gut«, knurrte er. »Ich warte. Aber beeilen Sie sich mit dem, was Sie zu sagen haben, und verschwinden dann.«
Mercedes konnte ihren Sieg nicht genießen. Steif begann sie: »Wenn Sie darauf bestehen, morgen zur Verabredung zu erscheinen, müssen Sie einen ehrenvollen Ausweg aus dem Dilemma finden, ohne den Grafen zu töten.«
Colin setzte sich an den Bettrand und rieb sich den angestoßenen großen Zeh. »Muss ich das? Ich nehme an, Sie nennen mir einen triftigen Grund dafür.«
Mercedes beugte sich vor. »Wir werden alles verlieren. Sie können nicht nachvollziehen, was das bedeutet, sonst würden Sie nicht darauf bestehen, dass diese dumme Sache ausgetragen wird.«
Er wusste besser, als sie ahnen konnte, was es hieß, alles zu verlieren. Doch er schuldete ihr keine Erklärung, die sie ohnehin nicht verstehen würde. Also entgegnete er: »Sie nennen es eine dumme Sache? Stammt diese Bezeichnung von Ihnen oder Ihrem Onkel?«
»Er nennt es so«, gestand sie kleinlaut.
Colin hörte auf, seine Zehen zu reiben. »Der Graf von Weybourne ging eine Wette ein, die er nicht einhalten konnte. Ich hätte mich nicht darauf eingelassen, wenn ich seine Situation gekannt hätte. Doch es wäre eine Verletzung seiner Ehre gewesen und hätte gewiss nicht den Formen entsprochen, wenn ich offene Erkundigungen über seine Finanzen eingezogen hätte. Ich hingegen konnte die Wette einlösen, falls ich der Verlierer gewesen wäre. Der Graf bedauerlicherweise nicht.«
Ein eisernes Band schien Mercedes die Brust zuzuschnüren. Es war genauso schlimm, wie sie es sich vorgestellt hatte.
»Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?«, fragte Colin. Sie sah aus, als könnte sie einen Schluck vertragen. Er fürchtete sogar, sie würde jeden Moment in Ohnmacht sinken. Das einzig Gute daran wäre, dass er dann endlich sein Bad nehmen könnte, dachte Colin sarkastisch. »Wie dem auch sei«, fuhr er fort, ehe sie antworten konnte. Sie würde sein Angebot ohnehin ablehnen. »Ich schenke Ihnen ein Glas ein und Sie trinken.«
Sie nickte schwach. Es hatte keinen Sinn, ihm zu widersprechen. Im Zusammenleben mit ihrem Onkel hatte sie gelernt, sich zu fügen, und sie war im Lauf der Jahre eine leidlich gute Strategin geworden.
Die Flasche Whisky auf dem Nachtschränkchen hatte Molly mitgebracht. Colin goss zwei Fingerbreit Whisky in ein Glas und reichte es Mercedes. »Auf einen Zug«, befahl er.
Mercedes schloss ihre schlanken Finger um das Glas und hob es an die Lippen. Über den Rand sah sie die durchdringenden Augen des Fremden und fürchtete, er würde ihr den Schnaps eigenhändig in die Kehle schütten, wenn sie sich weigerte zu trinken. Sie legte den Kopf in den Nacken und kippte den Inhalt in die Kehle.
»Braves Kind.« Er nahm ihr das leere Glas ab und stellte es beiseite. »Es wird Ihnen guttun.«
Ihre Kehle und ihre Eingeweide standen in Flammen, so gut tat ihr das grässliche Zeug. Doch sie nickte lahm. Als sie wieder sprechen konnte, erkannte sie ihre eigene Stimme nicht wieder. »Erzählen Sie von der Wette.«
Colin stopfte sich ein Kissen in den Rücken, lehnte sich zurück und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Ist Ihnen Lloyds ein Begriff?«
»Die Versicherungsgesellschaft.«
»Genau. Dort werden Schiffe und Fracht seit mehr als hundert Jahren versichert. Die Gesellschaft verfügt über ein weltweites Nachrichtensystem über Abfahrt und Ankunft von Schiffen. Bei Lloyds treffen die ersten Nachrichten ein, wenn ein Schiff gesunken oder gestrandet ist, wenn Fracht im Sturm verlorengeht, Seeleute über Bord gingen oder das Schiff von Piraten gekapert wurde. Mit Lloyds kann man ein Vermögen verlieren oder gewinnen, das hängt vom Schicksal des jeweiligen Schiffes ab. Die Versicherungspolicen von Lloyds sind im Grunde genommen Aktien, die an risikofreudige Investoren verkauft werden, und wenn die Schiffe unbeschadet im Zielhafen eintreffen, kassieren die Investoren hohe Gewinne. Wenn nicht …« Colin zuckte die Schultern. »Dann eben nicht.«
Mercedes wusste, was er damit sagen wollte. Vor ihrem geistigen Auge sah sie Männer, die alles riskiert und auf eine Karte gesetzt hatten und sich im Hinterstübchen eines Kaffeehauses die Pistole an die Schläfe setzten, weil sie keinen anderen Ausweg wussten.
»Seit kurzem werden bei Lloyds noch riskantere Wetten abgeschlossen. Die Männer wetten nicht nur darauf, ob ein Schiff unbeschadet im Zielhafen ankommt, sie schließen zusätzliche Wetten ab, ob ein Schiff pünktlich eintrifft. Es winken hohe Gewinne, wenn ein Schiff mit einer wertvollen Ladung als Erstes sein Ziel erreicht, etwa eine Schiffsladung Tee aus Hongkong oder Wolle aus Melbourne. Wenn der Kapitän eines Schnellseglers es schafft, als Erster mit solcher Ladung Liverpool oder London anzulaufen, macht er für sich, seine Mannschaft und seine Reederei ein gutes Geschäft.«
»Sind Sie das?«, fragte sie. »Kapitän auf einem Schnellsegler?«
»Kapitän auf der Remington Mystic.«
Mercedes hörte keinen Anflug von Prahlerei oder Stolz aus seiner Antwort. Er gab lediglich eine sachliche Auskunft. »Ich glaube, ich möchte noch einen Schluck, bitte.«
Colin überlegte. Ihre Wangen hatten ein wenig Farbe bekommen. Ihre grauen Augen mit blauen Einsprengseln, wie er jetzt sah, waren klar und ruhig. Mercedes Leyden schien ihre Fassung wiedererlangt zu haben. »Gut«, sagte er und schenkte ihr die Hälfte der vorigen Menge ein. »Diesmal sollten Sie das Zeug aber nicht hinter die Binde kippen wie ein Matrose. Nippen Sie daran.«
Sie gehorchte wortlos und diesmal lief ihr der ölige Schnaps angenehm warm in den Magen. »Ist mein Onkel eine solche Wette eingegangen?«, fragte sie. »Setzte er darauf, dass Sie rechtzeitig einlaufen?«
Colin stellte die Flasche beiseite. »Nein. Diese Art der Wette hätte nicht den Gewinn gebracht, auf den der Graf es abgesehen hatte. Die Wette ging darum, dass die Mystic den Zielhafen vor der geplanten Ankunftszeit erreicht.«
»Heißt das, Sie sollten einen Rekord brechen?« Mercedes vergaß Colins Rat und goss den Rest Whisky in einem Schluck hinunter. »Mein Gott«, sagte sie leise. »Was hat er sich nur dabei gedacht?«
»Vermutlich dachte Ihr Onkel, er gewinnt«, entgegnete Colin ungerührt.
»Und was hat Sie dazu veranlasst, sich auf diese Wette einzulassen? Glaubten Sie zu gewinnen?«
»Im Gegenteil. Ich hielt meine Chancen für ziemlich gering. Ihr Onkel musste lediglich die Wette eingehen und warten, ich aber musste dafür sorgen, dass das Ergebnis auch eintraf.«
Auch diesmal konnte Mercedes keine Prahlerei in seinen Worten erkennen. Er machte lediglich eine Feststellung und akzeptierte seine Rolle in dem riskanten Spiel. »Wie hoch war die Summe?«
»Eine Viertelmillion Pfund Sterling.«
Sie erbleichte. Eine unvorstellbar hohe Summe. »Die Strecke?«
»Liverpool Boston London.«
»Und der Rekord?«
»Sechsundzwanzig Tage und dreizehn Stunden.«
Allmählich fiel es ihr leichter zu verstehen, warum ihr Onkel glaubte, eine sichere Wette eingegangen zu sein. Sie selbst hätte in Versuchung kommen können. Mercedes beugte sich vor und stellte das Glas auf den Fußboden. Als sie sich wieder aufrichtete, wurde sie von leichtem Schwindel befallen.
»Sechsundzwanzig Tage und vier Stunden«, sagte Colin und beantwortete ihre Frage, die sie noch gar nicht gestellt hatte. »Die Remington Mystic unterbot die Rekordzeit um neun Stunden.«
Mercedes starrte ihn an. »Neun Stunden«, wiederholte sie tonlos. »Meine Familie wird Weybourne Park wegen neun Stunden verlieren.«
Colin stand auf. »Sie reden, als sei das noch gar nicht geschehen. Ihre Familie hat Weybourne Park bereits verloren, nicht, weil meine Mannschaft ihr Äußerstes gegeben hat, sondern weil Seine Lordschaft es auch nicht eine Sekunde lang für möglich hielt, dass wir den Rekord unterbieten könnten.«
Mercedes drückte den Rücken gegen die Stuhllehne, als Colin sich über sie beugte.
»Jede Einzelheit der Fahrt ist bei Lloyds dokumentiert«, berichtete er. »Ein neuer Rekord. Als ich die Büroräume der Gesellschaft betrat, wusste man bereits, dass Ihr Onkel die Wette verloren hatte. Ich fand ihn noch am gleichen Abend in seinem Club. Auch ich dachte, er habe getrunken, doch seine Freunde fürchteten wohl unbedachte Handlungen seinerseits und sorgten dafür, dass sein Whisky mit Wasser versetzt wurde.« Erst jetzt bemerkte Colin, dass er sich über Mercedes beugte, die sich tief in den Polstersessel drückte. Sie blickte angstvoll zu ihm auf, als erwarte sie jeden Augenblick, von ihm geschlagen zu werden. Colin richtete sich auf und nahm seine Hände von den Armlehnen.
»Ich schlage Sie nicht«, sagte er schroff. Als sie sich jedoch weiterhin in die Polster drückte, offenbar zu keiner Bewegung fähig, trat er einen Schritt zurück und schritt dann ans Fenster. Sie machte eine halbe Drehung über die Schulter, um ihn anzuschauen. Nun sah sie wenigstens nicht mehr aus wie ein verschrecktes Vögelchen im Käfig. »Vor einem halben Dutzend Zeugen zog der Graf die Richtigkeit der Aufzeichnungen der Fahrten der Mystic in Zweifel. Er verstieg sich sogar so weit zu behaupten, die Mystic habe ein zweites Schiff quasi als Doppelgänger, und unterstellte mir, ich hätte den Segler nicht auf der gesamten Fahrt befehligt.«
Mercedes bekam große Augen. Ihr Onkel befand sich in einer verzweifelten Situation, sonst hätte er sich nicht derart fahrlässig verhalten. Die Ehre eines Mannes zu bezweifeln war kein Kavaliersdelikt, sondern eine Beschuldigung mit ernsthaften Konsequenzen.
»Ich zeigte ihm die Zeitung mit dem Datum meiner Ankunft in Boston. Er aber behauptete, es sei alles nur ein sorgfältig geplanter Schwindel.« Mercedes nickte bedächtig und bat den Captain fortzufahren. »Ihr Onkel brachte noch eine Reihe anderer Anschuldigungen vor. Es wäre mein gutes Recht gewesen, ihn für jede einzelne dieser Beleidigungen zum Duell zu fordern.«
»Warum haben Sie es nicht getan?«
»Weil es keinen Sinn gehabt hätte. Mir war längst klar, dass er seine Wette nicht einlösen konnte, ohne eine Hypothek auf Weybourne Park aufzunehmen, sonst würde der Besitz auf mich übergehen. Es ist alles völlig legal, das versichere ich Ihnen.«
Daran hatte Mercedes keinen Zweifel. Colin Thorne machte den Eindruck eines Mannes, der einschätzbare Risiken einging, er schien jedoch kein Hasardeur zu sein. Unverständlich war ihr allerdings, woher er eine Viertelmillion Pfund Sterling aufbringen konnte, um sie in einer Wette einzusetzen. Wie konnte ein Schiffskapitän ein solches Vermögen anhäufen? »Was geschah, als Sie sich nicht provozieren ließen?«, fragte sie.
»Er forderte mich. Ihm blieb keine andere Wahl. Wenn er mich morgen tötet, muss er die Wette nicht einlösen. Wenn ich ihn töte …« Colin hob die Schultern. »Ist er aller Sorgen enthoben.«
Der Graf von Weybourne war kein Mensch, der sich große Sorgen machte. Das überließ er Mercedes, denn ihr war die Verwaltung von Weybourne Park, ihrem ehemaligen Elternhaus, übertragen.
Mercedes rutschte an die Stuhlkante, streifte ihre feuchten Strümpfe über und schlüpfte in die immer noch nassen Schuhe. Als sie aufstand, spürte sie, wie die Nässe durch die Nähte quietschte. Sie krümmte unbehaglich die Zehen.
Auch ihr Umhang war immer noch feucht. Sie legte ihn sich um die Schultern und zog die Kapuze über den Kopf. Einmal streifte ihr Blick Colin, der sie weiterhin mit unverändert kühlem Interesse beobachtete. Sie legte die Hand an die Klinke und suchte nach passenden Worten. Doch dann verschwand sie ebenso leise, wie sie gekommen war.
Es wurde kein Wort gesprochen.
***
In der Bibliothek brannte noch Licht. Ihr Onkel wartete also auf sie. Kein Bediensteter öffnete ihr die Tür, niemand nahm ihr den Umhang ab, niemand fragte, ob sie eine Tasse Tee wünschte. Seit Jahren arbeitete zu wenig Personal im Herrenhaus und die Hausangestellten, die Mercedes behalten durfte, hatten sich bereits zu ihrer wohlverdienten Ruhe im Dienstbotenflügel zurückgezogen.
Ihr Onkel erschien in der schwach erleuchteten Halle, ehe sie ihren Umhang abgelegt hatte. »Ich möchte mir eine Tasse Tee aufgießen«, sagte sie, während sie den Schrank unter der Treppe öffnete und den Umhang weghängte. Als sie einen Schritt zurücktrat, um die Tür zu schließen, stand der Graf direkt hinter ihr. Sie versteifte sich, als ihr Rücken ihn berührte. Bevor sie ausweichen konnte, hatte Weybourne ihren Zopf gepackt und ihn um die Hand gewickelt.
»Der Tee kann warten«, sagte er leise.
Sein Mund war nah an ihrem Ohr und Mercedes roch seinen Atem. Er hatte getrunken. Es war sinnlos, sich zur Wehr zu setzen, also überließ sie sich seinem groben Griff.
»Lass uns in die Bibliothek gehen.«
Das war alles andere als eine Einladung. Mercedes versuchte zu nicken, wodurch sich das schmerzhafte Ziehen noch verstärkte.
Wallace Leyden, der hochwohlgeborene Graf von Weybourne, zog seine Nichte an den Haaren in die Bibliothek. Als er sie freigab, um die schweren Flügeltüren zu schließen, glitt sie rasch außer Reichweite, was von ihm nicht unbemerkt blieb. Mit einem säuerlichen Lächeln drehte er sich zu ihr um.
Lord Leyden war von mittlerer Statur; Mercedes musste dennoch zu ihm aufblicken. Er hatte sich in den letzten Jahren so gut wie nicht verändert. Nur sein braunes Haar war an den Schläfen ergraut und die Falten um Augen und Mund hatten sich vertieft. Eine andere Veränderung war ihr an ihm nicht aufgefallen. Die vielen Jahre übermäßigen Alkoholgenusses hatten ihn weder dickleibig gemacht noch seine Nase gerötet. Wenn er gelegentlich mit dem Trinken aussetzte, zitterten seine Hände niemals. Er genoss einen geradezu legendären Ruf, ein ausgesprochen trinkfester Zechkumpan zu sein, und Mercedes war im Laufe der Jahre so manche Anekdote über seine Ausschweifungen zu Ohren gekommen.
Bei den vernachlässigten Ehefrauen und einsamen Witwen seiner Kreise war er ein gern gesehener Gesellschafter. Seine sportliche Erscheinung und sein elegantes, weltmännisches Auftreten machten ihn zu einem begehrten Kavalier, und gelegentlich hielt er sich eine Geliebte in London. Das Ausmaß seines Schuldenberges war seiner Familie und seinen Gläubigern bekannt, nicht aber den Adelskreisen, in denen er verkehrte. Er veranstaltete selten Abendgesellschaften auf Weybourne Park, und wenn zufällig Freunde vorbeischauten, oblag es Mercedes, dafür Sorge zu tragen, dass der äußere Schein gewahrt blieb.
Auch das Herrenhaus hatte sich nach außen hin kaum verändert. Die Gartenanlagen und Rasenflächen des stattlichen Anwesens waren stets makellos gepflegt, die Fassaden wurden regelmäßig ausgebessert. Nur bei näherem Hinsehen zeigte sich der Verfall: Wasserflecken an den Zimmerdecken im zweiten Stock und in den Dienstbotenkammern; fadenscheinige Teppiche in den Schlafzimmern im Nordflügel; verblichene Wandmalereien in der Galerie; verstopfte Kamine und der durchhängende Parkettboden im Salon im Erdgeschoss.
Ebenso verhielt es sich mit dem Zustand des Grafen. Auch ihm war der Verfall erst bei näherem Augenschein anzusehen. Sein beißender Witz, für den er berühmt war, wurde im Kreise der Familie zum grausam kränkenden Sarkasmus. Im betrunkenen wie im nüchternen Zustand waren seine Launen unvorhersehbar und von beängstigender Gewalttätigkeit begleitet. Er benahm sich wie ein verhätscheltes, eigensinniges Kind. Er war ungeduldig und anspruchsvoll, ohne Pflichtbewusstsein und ohne irgendwelche Konsequenzen zu tragen.
In ihrer frühen Jugend hatte Mercedes nicht begriffen, wieso er so viele Freunde hatte. Ständig erhielt er Einladungen und verbrachte kaum einen Abend im Kreise seiner Familie. Einmal hatte sie ihre Tante Georgia danach gefragt, die ihr wohlweislich die Antwort schuldig geblieben war. Mit dem Heranwachsen zog Mercedes ihre eigenen Schlüsse und begriff, dass Seine Lordschaft seine Grausamkeit und seinen Jähzorn seiner Familie vorbehielt; sie war ein Ventil, das ihm gestattete, all seinem Ärger Luft zu machen. Je länger er von zu Hause fort war, desto höher der Preis, den Ehefrau und Kinder bei seiner Rückkehr zu zahlen hatten. Und erst als ihre Tante bei der Geburt der Zwillinge starb, wurde Mercedes klar, wie oft Georgia Leyden ihre Kinder und ihre Nichte vor den Grausamkeiten des Grafen bewahrt hatte.
Wallace Leydens verhangener Blick heftete sich auf seine Nichte. Die Hände hielt er im Rücken verschränkt. »Nun?«, fragte er. »Du scheinst erstaunlich gefasst nach der Begegnung. Ich nehme an, er hat dich nicht hinausgeworfen.«
Mercedes bewegte sich langsam auf den Kamin zu, in dem das Feuer heruntergebrannt war, aber noch Wärme ausstrahlte. Im Übrigen lehnte ein Schürhaken an der Steineinfassung. Mercedes hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, keinen Raum zu betreten, in dem ihr Onkel sich aufhielt, ohne sich umzusehen, welcher Gegenstand ihm als Waffe dienen könnte, obwohl sie meist seine Hand zu spüren bekam. »Nein, er hat mich nicht hinausgeworfen. Er war sogar erstaunlich entgegenkommend. Ich weiß nicht, ob ich unter den gegebenen Umständen so höflich gewesen wäre.« Möglicherweise übertrieb sie ein wenig, doch ihr Onkel verdiente einen Tadel. »Du hast mich belogen.«
Die goldenen Einsprengsel in Weybournes braunen Augen sprühten Funken. Eine seiner Wangen zuckte, doch er blieb erstaunlich ruhig. »Wie kommst du darauf?«
Mercedes strich sich fahrig eine feuchte Locke aus der Stirn. »Du hast mir versichert, du seist in jener Nacht betrunken gewesen und Mr. Thorne habe sich deinen Zustand zunutze gemacht. Du sagtest, er habe dich provoziert.«
»Das ist die reine Wahrheit.«
»Lügner!«, wollte sie ihm laut und verächtlich ins Gesicht schleudern, brachte aber nur ein heiseres Flüstern hervor.
Mit drei langen Schritten war er bei ihr und hob die rechte Hand. »Du wagst es«, knurrte er drohend.
Mercedes sah sich plötzlich im Zimmer in der Herberge im Sessel sitzen, während Colin Thorne Anstalten machte, ein Bad zu nehmen. Sie hatte ihn mit ihrem Blick bezwungen. Sie hatte sich nicht abgewandt, hatte nicht geblinzelt, bis er sich geschlagen gegeben hatte.
Diese Taktik richtete bei Seiner Lordschaft freilich nichts aus. Im Gegenteil, sie schürte nur seinen Zorn. Er schlug ihr die Faust mitten ins Gesicht. Der Schlag dröhnte in ihren Ohren und die Wucht ließ sie rückwärts taumeln. Sie suchte am Schreibtisch Halt, sackte in die Knie und stieß mit der Hüfte gegen die scharfe Kante.
Er hob die Hand zum zweiten Schlag. Ihr spitzer Schrei schien ihm Genugtuung zu geben. Er ließ den Arm mit der geballten Faust sinken. »Was hat er sonst noch gesagt?«, fragte der Graf gelassen.
Tränen verschleierten ihr den Blick, die sie hastig zurückblinzelte. »Dass du ihn beschuldigt hast, er habe betrogen, um die Wette zu gewinnen.«
»Er hat betrogen.«
»Hast du einen Beweis dafür?«
»Gibt es einen Beweis, dass er nicht betrogen hat?«
»Er sagt, es gab eine Zeitung vom Tag seiner Ankunft im Hafen von Boston.«
Weybourne machte eine wegwerfende Handbewegung. »Die ihm von einem anderen Schiff auf hoher See gebracht wurde. Er stellt Behauptungen auf, die jeder Grundlage entbehren. Er kann es nicht geschafft haben.«
Mercedes zog sich am Schreibtisch hoch. Da ihr Onkel keine Anstalten machte, zurückzutreten, umrundete sie den Schreibtisch, um Abstand zu gewinnen und ein Hindernis zwischen sich und ihn zu bringen. »Wie kannst du so etwas sagen? Er unterbot den Rekord um neun Stunden. Eine Minute hätte genügt, um die Wette zu gewinnen. Warum soll das nicht möglich gewesen sein?«
Der Mund des Grafen von Weybourne wurde zu einem schmalen Strich. Er starrte seine Nichte schweigend an.
»Du lieber Gott!«, stieß sie tonlos hervor. »Du hast jemanden bestochen, hab ich Recht? Wen? Einen von der Mannschaft? Einen Hafenarbeiter? Was hast du getan?«
Lord Leyden nahm die Anschuldigungen mit stoischer Miene entgegen. Alles, was er dazu sagte, war: »Er konnte es nicht schaffen.«
»Du hast Schande über uns alle gebracht.«
Einen Augenblick sah es so aus, als würde er sie erneut schlagen. »Captain Thorne ist ein Betrüger«, knirschte er dann lediglich, indem er seine Wut bezähmte. »Und ich werde es beweisen.«
»Wenn er dich nicht vorher tötet.«
»Deshalb brauche ich deine Hilfe.«
»Ich konnte ihm das Duell nicht ausreden.«
Der Graf beugte sich über den Schreibtisch und fixierte sie. »Wie sehr hast du es versucht, Mercedes?«
»Ich habe es versucht.« Selbst in ihren Ohren klang die Feststellung ziemlich lahm.
»Das habe ich mir gedacht.« Er richtete sich auf und wischte ein Stäubchen vom Ärmel seines maßgeschneiderten Gehrocks, zog seine Taschenuhr aus der Weste, klappte den goldenen Deckel auf und hielt sie Mercedes in der flachen Hand hin. »Es bleiben dir noch ein paar Stunden Zeit.«
Mercedes erbleichte. »Nein, ich kann nicht, Onkel«, wehrte sie hastig ab. »Ich kann nicht noch einmal zurück.«
Wallace Leyden ließ die Taschenuhr mit einem Achselzucken wieder in die Weste gleiten, begab sich an die Anrichte und schenkte sich ein Glas Brandy aus der Kristallkaraffe ein. Er drehte sich zu Mercedes um, hob das Glas und nickte ihr spöttisch zu. »Es ist deine Entscheidung, Mercedes. Doch ich fürchte, ich muss dir noch einmal die Konsequenzen vor Augen führen. Glaubst du denn, er wird einen von euch hier behalten? Aus welchem Grund sollte er fremden Kindern und ihrer Gouvernante ein Dach über dem Kopf geben? Chloe und Sylvia wird er verheiraten, damit er sie los ist, ohne einen Skandal heraufzubeschwören. Aber du und die Zwillinge, ihr werdet auf die Straße gesetzt.« Seine Stimme nahm einen einschmeichelnden, seidigen Klang an. »Hast du mal darüber nachgedacht, was dir blüht, wenn du auf der Straße landest?«
Über den Rand seines Glases hinweg musterte er Mercedes bedächtig von Kopf bis Fuß. Ihr volles dunkles Haar, ihre klaren grauen Augen erinnerten ihn an ihre Mutter. Mercedes schlug ganz nach Elizabeth Allen, nicht in die Leydenlinie. Sie hatte die schlanke Figur ihrer Mutter, ihre feingliedrigen Fesseln und Handgelenke. Allerdings hatte sie nicht Elizabeths störrischen Eigensinn. Den hatte die Kleine vor Jahren abgelegt und er vermisste diesen Wesenszug keineswegs. Er hatte sich Mercedes gefügig gemacht, was er bei ihrer Mutter nie geschafft hatte. Und Lord Leyden wusste, wie er seine Nichte dazu bringen konnte, ihm auch jetzt zu Willen zu sein. »Du bist eine ungewöhnliche junge Frau, Mercedes«, fuhr er mit leiser Stimme fort. »Wie oft habe ich bedauert, dass dein Vater mein Bruder war. Und wie oft habe ich in Erwägung gezogen, dich zu meiner Geliebten zu machen. Die meisten meiner Freunde würden sich weniger Zurückhaltung auferlegen.«
Mercedes zuckte innerlich zusammen, ließ sich ihr Grauen jedoch nicht anmerken.
»Ich erwähne dies nur«, fuhr er fort, »da ich mir denken kann, dass du Captain Thornes Interesse wecken könntest, wenn du dich darum bemühen würdest.«
»Nein«, entgegnete sie ruhig. »Ich bin sicher, dass du dich irrst. Er zeigte nicht das geringste Interesse an mir.«
Der Graf achtete nicht auf ihre Worte. Er neigte den Kopf seitlich. »Ich glaube, ich höre die Zwillinge.«
Mercedes’ Kopf fuhr hoch. »Was?« In ihrer Stimme schwang Panik. »Nein, das kannst du nicht. Nein …«
Er hob die Hand. »Aber ich tue es. Ich werde nach ihnen sehen. Wer wird es diesmal sein? Britton? Brendan? Vielleicht beide. Du weißt, ich habe es nicht gerne, wenn sie nachts herumgeistern. Es könnte ihnen etwas zustoßen. Auf der finsteren Hintertreppe kann man leicht stürzen.«
»O bitte.« Mercedes kam hinter dem Schreibtisch hervor und näherte sich ihm. »Bitte, lass sie in Frieden. Das alles hat nichts mit ihnen zu tun.«
Seine dunklen Brauen zogen sich zusammen. »Ich fürchte, es hat sehr wohl etwas mit ihnen zu tun. Du siehst es doch selbst.« Mit diesen Worten wandte er sich zum Gehen.
»Warte!«
Unbeirrt öffnete er die Flügeltüren und verließ den Raum.
Mercedes eilte hinter ihm her. Am Fuß der Treppe ergriff sie seinen Ärmel. »Nein«, flüsterte sie verzweifelt. »Gib mir noch eine Chance. Ich versuche es noch einmal.«
Mit hochgezogener Braue blickte er auf ihre zarten Finger an seinem Ärmel. »Ach wirklich?«
Mercedes zog hastig die Hand zurück und strich sich abwesend den Rock glatt. »Diesmal tu ich es. Ich schwöre es.«
»Hast du das Messer?«
Sie nickte. Das Messer lag in einem Futteral zwischen ihrem Korsett und Batistunterhemd.
»Gut. Benutze es diesmal.«