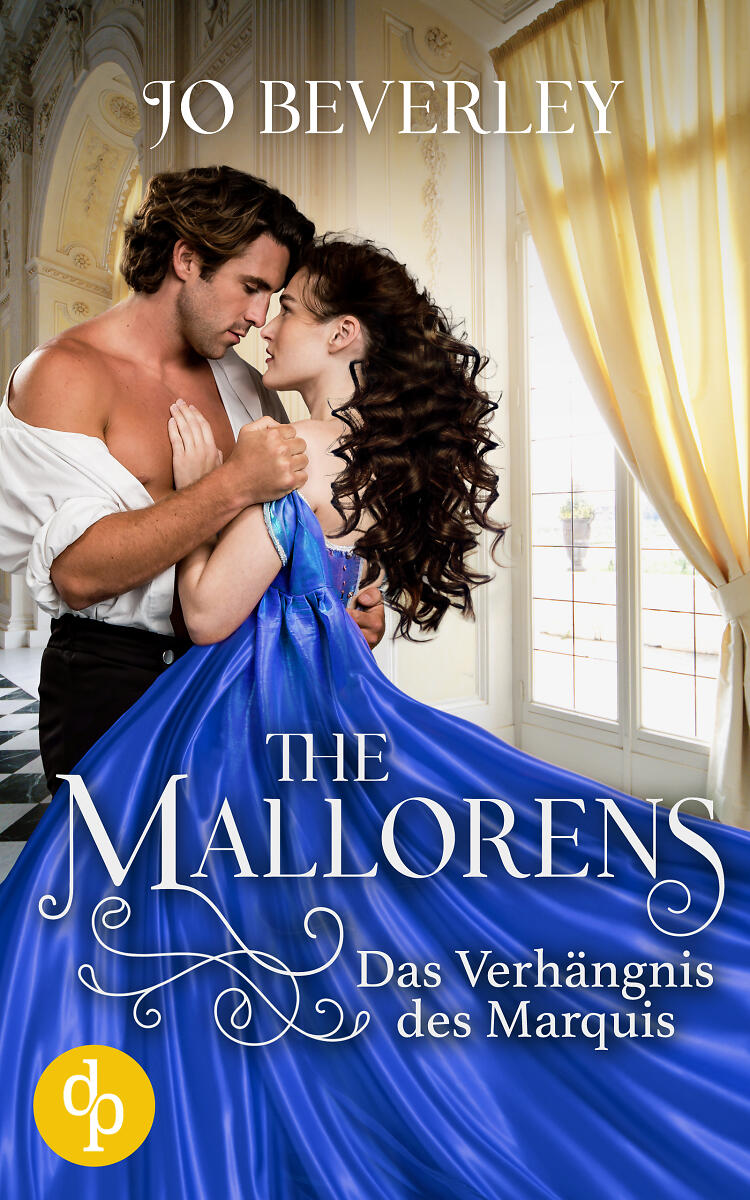2
Rothgar zog seinen Degen zurück, und der Arzt kam ohne große Eile herbei, um Currys Tod zu bestätigen. Keiner von Currys verblüfften Freunden schien den Wunsch zu verspüren, sich am Leichnam zu versammeln und zu trauern, und plötzlich, wie bei einer Vogelschar, die aus Käfigen befreit wird, erhob sich ringsherum lautes Stimmengewirr.
Rothgar sah sich im Publikum um: „Meine Herren“, sagte er, augenblicklich für Stille und Aufmerksamkeit sorgend. „Ihr habt gehört, dass Sir Andrew Curry versucht hat, den Namen einer Dame in den Schmutz zu ziehen, und dabei nicht nur die Ehre meiner Familie, sondern auch diejenige unseres gütigen Königs und seiner Gemahlin verletzt hat. Der König und die Königin haben Lady Raymore am Hofe als tugendhafte Frau akzeptiert. Weisheit und Urteilsvermögen der königlichen Hoheiten sollten nicht infrage gestellt werden.“
Nach einem überraschten Zögern kam zustimmendes Gemurmel auf, unterbrochen von Rufen wie ‚Jawohl!‘, ‚Gott schütze den König!‘ und ‚Der Teufel soll ihn holen!‘ Currys Kumpane wechselten erschrockene Blicke und schlichen sich hastig davon.
Während Rothgar von Männern umringt wurde, die ihm gratulieren und den Kampf noch einmal durchgehen wollten, bemerkte Bright, dass niemand dageblieben war, der sich um das Fortschaffen der Leiche kümmerte. So ging er mit dem Diener der Mallorens zum Arzt hinüber und veranlasste das Nötige. Wenn sie Glück hatten, brauchte Dr. Gibson oder einer seiner Kollegen eine Leiche, die sie zu anatomischen Zwecken zerstückeln konnten. Als Bryght alles geregelt hatte, half Fettler seinem Bruder gerade in den Mantel.
„Warst du so in Bedrängnis, wie es ausgesehen hat?“, fragte Bryght.
Rothgar nahm einen kräftigen Schluck aus einer Reiseflasche. Sicher war darin das saubere Wasser, das er täglich von einer Quelle in den Kreidehügeln mitbrachte. „Er war gut. Aber er ist nie richtig an mich rangekommen.“
Sie kletterten in die Kutsche, der Diener setzte sich ihnen gegenüber, und die Kutsche fuhr los und brachte sie zurück zum Malloren House.
„Hast du irgendwelche ernsthaften Verletzungen?“
„Nur Kratzer.“
„Ich glaube nicht, dass er bedacht hat, seinen Degen zu vergiften.“
Rothgars Mundwinkel zuckten. „Werde nicht theatralisch.“
„Es würde zu diesem Abschaum passen.“
Sein Bruder hatte jedoch bereits den Kopf zurückgelegt und die Augen geschlossen, sodass Bryght sich weitere Bemerkungen verkniff. Selbst an Rothgar konnte die Gefahr, die Anstrengung und das Töten nicht spurlos vorübergehen. Bryght dachte über seine eigene nervöse Reaktion nach und merkte, dass er jeglichen Geschmack an solchen Dingen verloren hatte. Er fragte sich, ob es seinem Bruder genauso ging.
Als sie bei Malloren House ankamen, konnte er nicht umhin, Rothgar in dessen stattliche Gemächer zu folgen. Er wusste, dass das Haus und seine vielen ausgezeichneten Bediensteten gut für Rothgar sorgen würden, aber er musste einfach mitgehen. Rothgar zog die Augenbrauen hoch, warf ihn jedoch nicht hinaus, als er sein ruiniertes Hemd abstreifte. In der Tat waren nur kleine Schnitte und Kratzer zu sehen. Am schlimmsten war die Wunde quer über der Schulter, aber auch sie war nicht tief.
Bryght konnte allmählich wieder klarer denken. „Was meinst du“, fragte er, „war das nur ein unbesonnener Mann oder ein Komplott?“
Sein Bruder hatte sich bis auf die Unterhosen ausgezogen und wusch sich. „Wenn es ein Komplott war, versuchen sie es bestimmt noch einmal. Die Art und Weise wird aufschlussreich sein.“
„Noch einmal? Zur Hölle, du kannst doch nicht einfach auf die nächste Attacke warten.“
„Was schlägst du vor, wie ich sie verhindern soll? Aber das würde ich auch gar nicht wollen. Ich ziehe es vor, jedweden mordgierigen Feind zu enttarnen und ihn mir vorzuknöpfen.“ Rothgar trocknete sich ab und erteilte knappe Anweisungen zu Verbänden und Kleidung. „Du interessierst dich doch für Mathematik. Ein einziger Anschlag ist wenig aufschlussreich. Drei sollten die Urheber allerdings zu erkennen geben.“
„Das nächste Mal könnte es Gift sein oder eine Pistole im Dunkeln.“
Sein Bruder setzte sich, damit der Barbier die Wunde an der Schulter behandeln konnte. „Ich gebe mein Bestes, um gegen solche Dinge gewappnet zu sein.“
„Und dennoch ...“
„Der Himmel bewahre mich vor Männern, die gerade eine Familie gegründet haben!“ Rothgar drehte sich energisch um. „Das ist die einzige Erklärung für diesen ganzen Wirbel. Nichts hat sich wesentlich verändert, Bryght. Außer dir.“
Geduldig glich der Barbier seine Arbeit der neuen Position an.
Verdammt, dachte Bryght. Jetzt war er bei dem Thema angelangt, das er ansprechen wollte. „Meine Umstände haben sich sehr wohl geändert“, sagte er und gab seinem Bruder den roten Siegelring zurück. „Ich führe zu Hause ein sorgenfreies Leben und erbebe bei der Vorstellung, deine Verpflichtungen übernehmen zu müssen.“
„Ich setze alles daran, dir dieses Schicksal zu ersparen, bis du zu alt für solche Sorgen bist.“
„Kannst du es Francis auch ersparen?“
Er meinte seinen Sohn. Es entstand eine vielsagende Pause, in der Rothgar sich darauf konzentrierte, den Ring wieder an die rechte Hand zu stecken und seine bandagierte Schulter zu dehnen. Dann nickte er zufrieden. Der Barbier murmelte etwas, woraufhin er sich wieder umdrehte und rasieren ließ.
Bryghts Gesicht verspannte sich. Hier ging es um Heirat, Rothgars Heirat und die Zeugung eines Sohnes, eines Erben; doch sein Bruder wies dies zurück. Da Rothgars Mutter verrückt geworden war, hatte er beschlossen, das unreine Blut dieser Linie nicht weiterzugeben. Es war immer klar gewesen, dass Bryght oder einer seiner Brüder, Söhne einer anderen Mutter, die zukünftigen Malloren-Generationen hervorbringen würden.
Das Thema war tabu, aber dieses Mal konnte Bryght ein Ausweichen nicht hinnehmen. Sobald der Barbier das Rasiermesser abgelegt hatte und begann, die Seifenspuren wegzuwischen, fragte er: „Nun?“
Rothgar stand auf, um das Hemd und die Kniehosen anzuziehen, die ein paar junge Kammerdiener ihm reichten. „Vielleicht findet dein Sohn eines Tages Vergnügen an hohem Stand und Macht.“
„Und wenn nicht?“
„Ich vermute, dass er ohnehin dazu erzogen wird, seine Pflicht zu tun.“ Als Nächstes kam die fein bestickte graue Seidenweste dran. Ein Diener machte sich daran, sie mit einer langen Reihe von ziselierten Silberknöpfen zu schließen.
Bryght schwitzte, als befände nun er sich in einem Duell.
Schon lange hatte er seine Rolle als Rothgars Erbe akzeptiert. Da er als Sohn eines Marquis aufgewachsen war, hatte er wohl oder übel eine Menge über die Aufgaben und Pflichten gelernt, und Rothgar hatte darauf bestanden, dass er noch mehr lernte. Auch wenn er nicht wollte, war er in der Lage, die Bürde auf sich zu nehmen, wenn es nötig war.
Als er letztes Jahr geheiratet hatte, hatte er akzeptiert, dass sein ältester Sohn eines Tages das Marquisat, die Marquiswürde, erben würde. Jetzt allerdings war dieser theoretische Erbe ein neun Monate altes Kind mit kupferfarbenen Locken und einem bezaubernden Lächeln. Sein Sohn Francis, den Bryght und Portia frei aufwachsen lassen wollten, damit er die aufregende moderne Welt kennenlernen konnte. Wie sollte Francis sein eigenes Leben gestalten und gleichzeitig bereit sein, morgen, nächstes Jahr oder in vierzig Jahren schwer lastende Verpflichtungen zu übernehmen?
Oder nie. Unerträglich.
Doch wie sollte er argumentieren ...?
Ihm wurde nun klar, dass er schon wieder nachgegeben hatte. Er hatte das Thema fallen gelassen. Vielleicht hatten ihn seine Nerven im Stich gelassen, weil er wusste, dass sein Bruder das Thema Heirat, sobald die Sprache darauf kam, vehement und unbarmherzig bekämpfen würde, wie er Curry bekämpft hatte.
Der Friseur brachte eine graue Perücke, deren hintere Haare in einer grauen Seidentasche verborgen waren und von einer schwarzen Schleife zusammengehalten wurden. Die Pracht, mit der sein Bruder zurechtgemacht wurde, erregte schließlich Bryghts Aufmerksamkeit.
„Wo zum Teufel gehst du hin?“
„Hast du vergessen, dass heute Freitag ist?“
Das hatte er tatsächlich. Jeden Mittwoch und jeden Freitag gab der König einen Empfang. Die Anwesenheit war nicht direkt verpflichtend, doch man erwartete von jedem wichtigen Mann des Hofes oder der Regierung, dass er teilnahm, wenn er sich in London aufhielt. Tat er dies nicht, gab das dem König Anlass zu vermuten, dass er mit einer der Splittergruppen sympathisierte, die gegen die königliche Politik waren.
„Du willst trotzdem hingehen?“, fragte Bryght. „Der König weiß bestimmt, dass du gerade ein Duell hattest.“
„Er wird sich von meinem Wohlbefinden überzeugen wollen.“
„Ein Dutzend Männer werden da sein, die ihm davon ...“
Sein Bruder hob die linke Hand, die jetzt mit zwei funkelnden Edelsteinen geschmückt war, und brachte ihn zum Schweigen. „Das Landleben trübt deinen Verstand, Bryght. Der König wird mich sehen wollen, und es ist wichtig, dass die Welt sieht, dass ich vollkommen unversehrt und unerschütterlich bin. Abgesehen davon“, fügte er hinzu, während er flüchtig auf ein Tablett mit Halstuchnadeln blickte, das ihm hingehalten wurde, „dass die Uftons in der Stadt sind und ich sie vorstellen soll.“
„Wer zum Teufel sind die Uftons?“
„Sie haben ein kleines Anwesen bei Crowthorne.“ Er nahm eine schwarze, prachtvolle Perle in die Hand. „Zuverlässige Leute. Sir George zeigt seinem Sohn und Erben all die wunderbaren Dinge in London, zweifellos genauso, wie er ihm Huffäule, Räude und sauberen Boden gezeigt hat. Carruthers kümmert sich um sie.“
Bryght gab es auf, Einwände zu erheben. Wenn ihm danach war, würde Rothgar vielleicht den König enttäuschen. Aber die Uftons würde er nicht enttäuschen.
Heute würde er überhaupt niemanden enttäuschen. Er bereitete sich auf einen großen Auftritt vor. Die eben erst beobachtete Rasur war sicher schon die zweite an diesem Tag, um alle Spuren dunkler Stoppeln zu entfernen – als Vorbereitung für Puder und Schminke. Das war natürlich wichtig, um erlaucht und zart zu wirken. Wenngleich die übertriebene Pflege am Hof normal war, sollten Rothgars Bemühungen zweifellos seine Maske wiederherstellen – nach der Enthüllung todbringender Kraft beim Duell.
Bryght dachte an Shakespeare. „Die ganze Welt ist eine Bühne ...“ Zuerst die Gewalttätigkeiten während des Duells und dann die eingeübten Kniffe am Hof. Später vielleicht der Esprit eines Salons, die verführerische Magie eines Balles oder die Gefahr der Spieltische. Vor seiner Heirat war er selbst auf diesen Bühnen aufgetreten und hatte es durchaus genossen, aber die vollendete Kunst seines Bruders hatte ihm immer gefehlt.
„Hast du bedacht, dass der König Currys Tod missbilligen könnte?“, fragte er.
„Wenn er mich tadeln möchte, muss er die Gelegenheit dazu erhalten.“
„Und wenn er dich in den Tower werfen will? Dafür sorgt, dass du dich vor Gericht verantworten musst?“
„Dafür gilt das Gleiche. Es war allerdings eine saubere Angelegenheit, vor vielen Zeugen.“
„Dein Todesstoß könnte für unüblich erachtet werden.“
Rothgar drehte sich zu Bryght um. „Willst du, dass ich hier herumschleiche, bis ich die Meinung des Königs weiß? Vielleicht denkst du auch, ich sollte nach Holland fliehen oder mich in die Neue Welt einschiffen?“
So betrachtet gab es keine andere Möglichkeit, als an dem Empfang teilzunehmen, und zwar in voller Pracht. Er hätte es wissen sollen. Hatte Rothgar jemals die falsche Karte ausgespielt?
Sein Bruder war faszinierend und bewundernswert, doch manchmal wirkte er wenig menschlich. Die Beachtung eines jeden Details, selbst der Kleidung für diesen Auftritt, die Tatsache, dass er fast immer auf der Bühne stand und vielschichtige Rollen spielte, konnte nicht spurlos an ihm vorübergehen. Es war nicht der Lebensstil für einen lachenden Engel. Rothgar war immerhin durch schreckliche Verluste und Belastungen geprägt worden.
Vielleicht hatte er schon immer ein stählernes Wesen gehabt, doch vier tragische Tode hatten ihn zu dem Mann gemacht, der er heute war – ein Mann, der mit neunzehn zu Macht und Verantwortung gezwungen worden war. Ein Mann, der ein kleines Reich aufgebaut hatte, das er nun verwaltete, und der dieses Reich und die Kontrolle darüber vielleicht brauchte, als Schutz vor seinen Verlustängsten.
Oder als Schutz vor der Angst, verrückt zu werden.
Seine Mutter war wahnsinnig geworden und hatte ihr neugeborenes Kind umgebracht. Rothgar, selbst noch ein kleines Kind, war ein machtloser Zeuge gewesen. Manchmal dachte Bryght, dass das Bedürfnis seines Bruders nach Kontrolle auch eine Art von Wahnsinn war. Er versuchte, die Welt zu einer Theaterbühne zu machen, mit ihm selbst als Direktor. Oder vielleicht zu einem der komplizierten Automaten, die er so mochte. Eine Maschine, die von ihm kontrolliert wurde; die ihm ganz allein gehörte und von ihm am Laufen gehalten werden musste; eine Welt, in der er Katastrophen verhindern konnte.
Es war eine eindrucksvolle Leistung, und Rothgar tat wirklich bemerkenswerte Dinge für seine Familie und für England, aber Bryght wollte nicht, dass irgendwelche Leidensprüfungen seinen Sohn so werden ließen wie seinen Bruder. Und doch hatte er zugelassen, dass ihm das Thema entglitten war.
Bevor er den Mut aufbringen konnte, es noch einmal zu versuchen, zog Rothgar vorsichtig seine maßgeschneiderte Jacke an. Die matte stahlgraue Seide warf keinerlei Falten und war auf der gesamten Vorderseite aufwendig mit schwarzen und silbernen, sechs Zoll breiten Stichen bestickt. Fettler glättete die Seide über den Schultern und am Rücken, auf der Suche nach nicht vorhandenen Mängeln. Obwohl Rothgar einen kleinen, reich verzierten Degen trug, wusste Bryght, dass er in einer so engen Kleidung niemals würde fechten können. Zweifellos bedingt durch die Kleidung, sah er jedoch selbst wie eine verzierte Stahlklinge aus.
Seine Kniehosen und seine Strümpfe waren aus demselben Grau. Er schlüpfte in schwarze Schuhe mit silbernen Absätzen und Schnallen und wählte ein schneeweißes Seidentaschentuch, das mit einer raffinierten Seidenspitze umsäumt war. Zum Schluss befestigte Fettler den silbernen Stern des Bath-Ordens an seiner linken Brust, dessen goldenes Kreuz in der Mitte die einzige farbige Stelle an ihm war.
Dann drehte er sich um und verneigte sich mit perfekter Anmut, während er elegant das Taschentuch schwenkte.
Schönheit und Bedrohung präzise vermischt.
Bryght klatschte, und sein Bruder verzog die Mundwinkel. Obwohl Rothgar seine Rolle auf dieser Bühne voll ausspielte, verirrte er sich nicht in der Künstlichkeit wie viele andere. Ihre Welt, das hatte er gegenüber seiner Familie häufig betont, war zwar ein Kostümball, aber ein Ball, bei dem bedeutende Dinge entschieden wurden.
Als sie das Zimmer verließen, umgab sie ein feiner Parfümduft. Rothgar hatte ein wenig auf sein Taschentuch geträufelt, und der Kontrast zu dem billigen Zeug dieses Gecken war schon fast ein paar Tränen wert.
Ebenso wie die Tatsache, dass Bryght sich eine einzigartige Gelegenheit hatte entgehen lassen. „Was Francis betrifft“, sagte er, und er wusste, dass es kein guter Zeitpunkt war.
„Ja?“
Das einzelne Wort klang so kalt wie Stahl, aber Bryght blieb hartnäckig. „Du wirst ihn bei der Reise zu Brands Hochzeit besser kennenlernen.“
„Ich zittere schon vor Freude.“ Aber Rothgar warf ihm einen Blick zu und lächelte. „Er ist ein reizendes Kind, Bryght. Glaubst du, dass Brands Pläne, im Norden zu leben, gelingen werden?“
„Vermutlich schon. Er hat nie Geschmack am eleganten Leben gefunden.“ Doch Bryght war sich darüber im Klaren, dass er abgelenkt worden war. Diesmal etwas freundlicher, aber genauso entschlossen.
„Er wird es nicht vollkommen vermeiden können“, bemerkte Rothgar, als sie den oberen Absatz der geschwungenen Haupttreppe erreichten. „Die Cousine seiner Braut unterhält dort ein großes Anwesen. Ihr Wohnsitz konkurriert mit Rothgar Abbey.“
„Die Peeress von Arradale? Bey –“
„Eine furchteinflößende nordische Kriegerin, mit Waffen in Form von Locken, leuchtenden Augen, Seide und Pistolen. Und sie weiß sie alle geschickt einzusetzen.“
„Bey –"
„Hat Brand dir erzählt, dass sie ihn beinahe umgebracht hat? Und meine Männer und mich hat sie mit ihrer eigenen kleinen Armee natürlich auch in die Flucht geschlagen.“
Belangloses Geschwätz als Verteidigungswaffe, geschwungen wie ein Degen, sodass Bryght kaum eine Möglichkeit fand zu sagen, was er zu sagen hatte.
„Eine Peeress aus eigenem Recht“, fügte sein Bruder hinzu, als sie die Treppe hinuntergingen. „Sie hat beträchtliche Macht und nicht vor, sie zu verlieren.“
Aha! „Nicht jeder mag Macht“, warf Bryght nun entschlossen ein. „Bey, ich will nicht, dass Francis damit belastet wird, dein Erbe zu sein.“
Eisiger Nebel schien sich auf sie niederzusenken. „Dann versichere ihm, wenn er alt genug ist, dass ich mein Möglichstes tun werde, um ihn zu überleben.“
„Ich wünschte, du würdest heiraten, Bey.“
„Nein, Bryght, auch nicht deinetwegen.“
„In der Familie deiner Mutter ist niemand sonst wahnsinnig geworden. Vielleicht war es nur eine vorübergehende Krankheit oder eine Art Ausrasten!“
„Alles muss irgendwann einmal anfangen. Ich will es nicht riskieren.“
„Haben meine Sorgen denn gar keine Bedeutung?“
Sie hatten das Ende der Treppe erreicht, und Rothgar drehte sich zu ihm um. „Ich kümmere mich um die Sorgen meiner ganzen Familie. Eine Möglichkeit wäre, mir das Kind zu überlassen, damit ich es als meinen Erben großziehe.“ Bryght suchte noch nach den passenden Worten, als Rothgar fortfuhr: „Die andere ist, dass ich bald sterbe. Dann wärst du Marquis, und Francis könnte sicher in seine zukünftige Rolle hineinwachsen. Soll ich die Mörder ihre Arbeit machen lassen?“
Die Pest sollte diesen herzlosen Teufel holen. Neben Zuneigung und Freundschaft gab es zwischen ihnen immer auch Rivalität und Gegensätze, die sich aus ihren Rollen ergaben, aus ihrem Wesen und ihrer Geschichte.
Bryght befürchtete, dass es zwecklos war, doch er blieb hartnäckig. „Du könntest heiraten. Riskiere es.“
Rothgar hob die Augenbrauen. „Risikobehaftete Generationen, nur um dir ein paar Sorgen zu ersparen und deinem Sohn eine gewisse Unsicherheit? Ich bin anderer Meinung. Erziehe Francis dazu, jede Bürde zu akzeptieren, die sich auf seine Schultern legen könnte. Es ist die einzige Möglichkeit. Du kannst ihn noch so sehr verhätscheln, die Bürden werden kommen. Das sagt mir zumindest die Erfahrung.“
Er wandte sich ab, ließ sich von einem wartenden Diener Umhang und Hut reichen und trat durch die hohen Flügeltüren hinaus. Für die kurze Reise zum St. James's Palace nahm er in seiner lackierten und mit Gold verzierten Sänfte Platz. Diesmal ignorierte er die wartenden Bittsteller, die darauf hofften, dass sich der Marquis ein wenig Zeit für sie nahm und etwas von seiner Macht und seinem Einfluss für ihre Belange einsetzte.
Die livrierten Träger hoben die Stangen an und machten sich auf den Weg, auf jeder Seite von bewaffneten Dienern begleitet.
Der Marquis von Rothgar war wieder auf der Bühne.
Zitternd vor Wut und nervöser Anspannung wandte Bryght sich ab. Es gab Zeiten, in denen er seinen Bruder gern selbst aufgespießt hätte, wenn er gekonnt hätte.
Harrogate, Yorkshire
„Passt doch auf!“ Die Gräfin von Arradale wich vor der Florettspitze zurück, die ihr Herz bedroht hätte, wäre die Spitze nicht mit einem Knauf versehen gewesen und hätte sie keinen gepolsterten Brustschutz getragen.
Ihr Fechtlehrer zog die Maske von seinem zerfurchten Gesicht. „Ihr übt nicht genug, Mylady.“
Diana zog ebenfalls die Gesichtsmaske ab und reichte sie ihrer wartenden Zofe. „Wie sollte ich auch, Carr, wenn Ihr nicht nach Arradale kommt, um mit mir zu üben?“ Clara hängte die Maske auf und eilte zurück, um die Bänder zu lösen, die den Brustschutz zusammenhielten.
William Carr legte hastig seine eigene Schutzkleidung ab. „Ihr wisst, dass ich Euch verehre, Mylady, aber ich werde nicht zulassen, dass Ihr mich ganz für Euch vereinnahmt.“
Diana warf einen Blick auf den gut aussehenden Iren mit den dunklen, lockigen Haaren und den leuchtenden blauen Augen. Sie hatte ein paar Mal daran gedacht, auf seine Flirtversuche einzugehen, aber sie wusste instinktiv, dass er als Spielzeug zu gefährlich war. Wie die meisten Männer würde er sie nur zu gern besitzen, ihre Macht und ihren Reichtum, und aus ihr eine bloße Ehefrau machen.
„Zumindest mit meinen Schießkünsten werdet Ihr zufrieden sein“, sagte sie, während sie auf einen Spiegel zuging und ihr kastanienbraunes Haar in Ordnung brachte.
„Doch leider wird es Eure Wangen nicht so reizend zum Erröten bringen.“
„Nein? Aber mein Herz wird schneller schlagen.“
„Das ist die Macht, Mylady“, sagte er mit einem matten Lächeln. „Es ist ein Jammer, dass Ihr für die Macht geschaffen seid, und ja, genau dadurch wirkt Ihr noch schöner. Aber auch gefährlich. Sehr gefährlich.“
Sie warf ihm einen beschwichtigenden Blick zu, wenngleich er immer das Richtige zu sagen wusste. Gefährlich. Der Gedanke, dass sie gefährlich war, gefiel ihr.
Der Spiegel sagte ihr, dass Carr die Wahrheit über ihr Aussehen sagte; von der Anstrengung waren ihre Wangen gerötet, und ihre Augen funkelten. Ein Jammer, dass das alles umsonst war. Ja, sie gehörte zu den Frauen, die auf Männer anziehend wirkten, auch ohne Rang, Reichtum und Macht.
Es war ihr Unglück, dass Rang, Reichtum und Macht ihr nicht erlaubten, die Männer zu ermutigen.
Sie drehte sich wieder um. „Kommt, ich zeige Euch, wie gefährlich ich geworden bin. Mit einer Pistole brauche ich keinen Partner, deshalb übe ich allein. Täglich.“
„Ich glaube Euch“, sagte er und hielt ihr die Tür auf, die auf einen sonnenbeschienenen Hof führte. „Ihr liebt es zu gewinnen.“
„Ja.“
„Und Ihr seid immer noch wütend auf Euch, dass Ihr letztes Jahr danebengeschossen habt, obwohl Ihr auf einen Mann feuertet, den Ihr nicht töten wolltet.“
„Natürlich bin ich froh, dass ich Lord Brand nicht getötet habe, Carr, aber ich hätte nicht so wild drauflosschießen dürfen. Das war eine Schwäche.“ Sie drehte sich zu ihm um. „Ihr müsst mir beibringen, wie man das vermeidet. Wie man in einer Notlage einen sauberen Schuss abgibt.“
Als sie an der Tür zu seiner Pistolengalerie angekommen waren, blieb er stehen. „Sicher, aber wie sollte eine große Lady wie Ihr in eine Notlage geraten?“
„Es ist schon einmal passiert“, erwiderte sie. „Wenn es wieder passiert, muss ich vorbereitet sein. Wären die Umstände so gewesen, wie ich dachte, hätte ich mein Leben verlieren können, und Rosa ebenfalls! Warum sonst arbeite ich so hart daran?“
„Allein der großen Herausforderung wegen, Lady Arradale.“
Bei dieser trockenen Bemerkung lachte sie laut auf. „Das stimmt. Ihr kennt mich zu gut, Carr. Aber auch, weil ich bereit sein werde, mich und die Meinen zu verteidigen, wenn es jemals dazu kommen sollte. Seid mein Lehrer. Seid mein Lehrer und behandelt mich, als wäre ich ein Mann.“
Er schloss die Tür auf und fragte: „Wer bedroht Euch, Mylady? Es wäre eine Ehre für mich, ihn für Euch zu töten.“
„Keiner“, antwortete sie und betrat den langen Raum, wo ihr der abgestandene Geruch von Schießpulver und Rauch in die Nase stieg. Es stimmte, dass sie die Macht von Pistolen liebte.
Dass sie nicht bedroht wurde, stimmte ebenfalls – zumindest nicht körperlich. Ihr Leben floss ruhig und sanft dahin, abgesehen davon, dass sie sich der Existenz eines gewissen Marquis bewusst war.
Sie nahm die speziell für sie angefertigten Waffen aus dem Kasten, um sie zu laden – etwas, das sie immer selbst machte. Während sie Schießpulver in den Lauf der Ersten schüttete, musste sie sich eingestehen, dass sie heute wegen des Marquis hierhergekommen war. Sie hatte Carr seit Monaten nicht besucht, aber die Nachricht, dass der Finstere Marquis bald nach Norden kommen würde, hatte sie hierher getrieben, um ihre Fertigkeiten zu trainieren.
Während sie die Kugel mit Stoff umwickelte und in den Lauf stopfte, dachte sie an ihre letzte Begegnung. Sie hatte ihn mit der Pistole bedroht und schließlich verjagt. Und er war kein Mann, der eine Niederlage vergaß.
Sie legte die Pistole zur Seite und nahm sich die andere vor. Jene gewaltsame Begegnung war nicht der einzige Grund für das nervöse Prickeln, das sie empfand.
Oh nein – sie stopfte die nächste Kugel nach unten – es war die Erinnerung an ihn, an die Wirkung, die er auf sie hatte. Als er letztes Jahr im Norden gewesen war und sie zu Hause besucht hatte, hatten sie sich ständig gegenseitig herausgefordert, meistens mit Worten. Die verbalen Fechtkämpfe waren jedoch in einen Flirtwettkampf übergegangen.
Sie öffnete die Pfanne, um das feine Pulver hineinzugeben, hielt jedoch gedankenverloren inne.
In einer unvergesslichen Nacht hatte er versucht, sie zu verführen. Er hatte es nicht ernsthaft gewollt – es war Teil ihres ständigen Wettkampfes gewesen, und er hatte sie testen wollen –, doch die Erinnerung daran hatte seitdem dauernd an ihrer Vernunft und ihrem Verstand genagt.
Nach ihrer Weigerung hatte er gesagt: „Solltet Ihr jemals Eure Meinung ändern, Lady Arradale ...“
Jene Worte waren es, die sie Tag und Nacht verfolgten, und es hatte viele verrückte Momente gegeben, in denen sie sich gewünscht hatte, sie hätte dieses zynische Angebot angenommen.
Sie schüttelte den Kopf und ließ das Pulver vorsichtig in die Zündpfanne rieseln. Der Marquis stellte keine körperliche Bedrohung dar, das nicht; trotzdem hatte sie im letzten Jahr intensiver als je zuvor schießen geübt.
Im Moment übte sie täglich und hatte sich trotz ihres ausgefüllten Tagesablaufs Zeit genommen, hierher zu kommen, vor allem um Carr zu sehen. Denn der Marquis kam wieder nach Norden, kehrte zurück, um Unruhe in ihr Land und ihren Seelenfrieden zu bringen.
Sie schloss den Pfannendeckel und füllte danach die Pfanne der anderen Waffe. Dann entsicherte sie die erste Pistole, sodass der Hahn gespannt und die Pistole schussbereit war. „Wenn mich jemand bedroht, Carr, komme ich selbst mit ihm klar.“
Als sie jedoch ihre Position vor den Zielscheiben einnahm – grob stilisierte Figuren mit roten Herzen als Ziel war ihr bewusst, dass auch ein Herzschuss keine Verteidigung gegen die Bedrohung war, der sie entgegensah.
3
Es wurde Mittag, und die Menschen strömten durch das Pförtnerhaus an der Pall Mall in das Labyrinth aus alten Gebäuden, das als St. James's Palace bekannt war. Kabinettsminister waren darunter, Offiziere, erschöpfte Höflinge, und auch Landedelmänner, die einmal im Leben eine Audienz beim König haben wollten. Sie alle trugen das komplette Hofkostüm – elegante Kleidung, kleiner Degen, gepudertes Haar –, da sie ansonsten nicht empfangen worden wären.
Diejenigen, die daran gewöhnt waren, dies zwei- oder dreimal pro Woche mitzumachen, schlenderten über den Hof und unterhielten sich oder hatten andere Dinge im Kopf. Die Gentlemen vom Land allerdings blickten mit großen, erwartungsvoll leuchtenden Augen umher. Den König so nah vor sich zu sehen. Empfangen zu werden. Ein oder zwei Worte mit ihm zu wechseln!
Die Träger des Marquis brachten ihn durch das Pförtnerhaus in den großen Innenhof, wo er ausstieg und sich die üppige Spitze an den Handgelenken zurechtrückte. Er nahm von verschiedenen Seiten Grüße entgegen und schätzte die Stimmung ein. Neugier und eine gewisse erregte Erwartung, dass er im Tower enden könnte. Das war nicht unwahrscheinlich. Der junge König war schwer einzuschätzen, auf ihm lastete die Gewissheit, moralischer Führer seines Reiches zu sein.
Rothgar entdeckte seinen Sekretär bei zwei staunenden Landherren und schlenderte zu ihnen hinüber. Bevor Carruthers sie vorstellen konnte, trat der ältere Mann vor und verneigte sich. Er war groß und kräftig, fühlte sich jedoch offensichtlich unwohl in seiner prächtigen Kleidung. „Verehrter Herr Marquis! Wir sind Euch sehr zu Dank verpflichtet.“
Rothgar verneigte sich ebenfalls. „Durchaus nicht, Sir George. Ich bin erfreut, Euch in London zu sehen. Dies ist gewiss Euer Sohn ...“ Während er sprach, blinzelte er seinem Sekretär zu, der ‚George‘ mit den Lippen formte. Er unterdrückte ein Lächeln und fügte ‚George‘ hinzu.
Der hübsche, ein wenig benommen wirkende junge Mann verneigte sich ebenfalls und hielt dabei vorsichtshalber seinen kleinen Degen fest. Diese Dinger waren bekanntermaßen tückisch und hatten schon viele Damen zu Fall gebracht oder gelegentlich gar an unglücklichen Stellen getroffen. Der junge George wurde offenbar zu einem ebenso tadellosen Mann erzogen, wie sein Vater einer war.
Der Marquis schlug vor, ins Gebäude hineinzugehen. „Ich hoffe, meine Leute haben dafür gesorgt, dass Eure Reise nach London ganz nach Euren Wünschen war, Sir George.“
„Das haben sie gewiss, Mylord!“, beteuerte Sir George und berichtete von all den wunderbaren Dingen, während sie in Richtung Empfangssaal gingen. Als sie sich dem Saal näherten, fing er jedoch nervös und aufgeregt an zu stammeln. „Glaubt mir, Mylord, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.“
„Lasst Euch von Seiner Majestät leiten, Sir George, aber sprecht zu ihm. Er beschwert sich bei solchen Anlässen vor allem darüber, dass die Leute ihn nur anstarren und ‚Ja, Sir‘, ‚Nein, Sir‘ sagen.“
„Sehr wohl, Mylord!“ Sir George sah aus, als müsste er kräftig schlucken. „Nun, die Sterne mögen mir beistehen, ich werde mein Bestes geben. Aber du, Georgie“, sagte er zu seinem Sohn, der ihnen folgte und dabei die Waffensammlung an den getäfelten Wänden anstarrte, „du bleibst besser bei ‚Ja, Sir‘ und ‚Nein, Sir‘. Hast du gehört?“
„Ja, Vater!“
Rothgar verbarg ein Lächeln. Empfänge waren eine langweilige Verpflichtung, und er genoss es, seine Nachbarn vom Land vorzustellen. Mit ihren Augen betrachtet gewannen die Empfänge an Frische und Würze und erinnerten ihn daran, dass es ein Hauptmerkmal des englischen Staates war, dass anständige Männer Zutritt zum König erhielten. Er bedauerte, das Duell nicht um einen Tag verschoben zu haben. Er würde dafür sorgen, dass die Uftons in keine Unannehmlichkeiten gerieten, aber wenn der König beschloss, Duelle und den Tod zum großen Thema zu machen, würde es ihre Begeisterung beeinträchtigen.
Sie betraten den Empfangssaal, der reich mit Wandteppichen und Gemälden geschmückt war, jedoch keine Möbel enthielt, und stellten sich in den Kreis, der sich an der Wand formierte. Rothgar wählte einen Platz neben anderen Leuten vom Land, und schon bald unterhielten sich die Uftons angeregt mit ihresgleichen. Unterdessen kamen mehrere Männer zu Rothgar und sprachen mit ihm. Keiner von ihnen missbilligte das Duell, aber was die Folgen betraf, waren einige offensichtlich unsicher. Diejenigen, die ihn plötzlich ignorierten, entgingen ihm ebenfalls nicht.
Als der König schließlich eintraf, war ihm seine Stimmung nicht anzusehen. George III. war erst fünfundzwanzig, groß und ansehnlich, hatte eine frische Gesichtsfarbe und große, blaue Augen. Da er seine Aufgabe ernst nahm, ging er langsam im Raum umher und blieb bei jedem Mann stehen, um mit ihm zu sprechen. Selbst wenn er über Rothgar nachdachte, so ließ er es sich nicht anmerken. Während er sich durch den Raum bewegte, bildete er den Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit.
Der König sprach kurz mit dem Earl of Marlbury, der neben Rothgar stand, dann schweifte sein Blick ernst und nachdenklich weiter. Rothgar spürte, wie der ganze Raum den Atem anhielt und sich fragte, ob man einem Ereignis beiwohnen würde, das es wert war, an die Nachkommen überliefert zu werden.
Dann senkte der König den Kopf. „Verehrter Herr Marquis, wir sind erfreut, Euch gesund hier zu sehen. Sehr erfreut.“
Ein Raunen ging durch den Saal, und Rothgar verneigte sich. „Euer Majestät ist gütig wie immer. Darf ich Euch Sir George Ufton von Ufton Green in Berkshire und seinen Sohn George vorstellen?“
Von da an ging alles glatt. Sir George erzählte kurz und überlegt von den Umständen bei ihm zu Hause. Dann fragte der König den jungen George, ob er seinen Aufenthalt in London genieße und bekam ein nervöses ‚Ja, Sir‘ zur Antwort.
Danach ging er weiter.
Sir George stieß einen tiefen Seufzer aus. Rothgar unterdrückte jegliches Zeichen von Erleichterung. Er erlaubte sich keinerlei Siegeszeichen, als er die Verbeugungen der vorbeigehenden Kabinettsminister erwiderte, auch wenn einige ihn immer noch als Rivalen ansahen.
Wenngleich es durchaus gestattet war, den Saal zu verlassen, sobald der König vorbeigegangen war, ließ Rothgar den Uftons einen Moment Zeit, sich von ihrem Erlebnis zu erholen, bevor er sie nach draußen an die frische Luft geleitete. Carruthers erwartete sie und übergab sie einem livrierten Diener, der ihnen noch mehr Attraktionen zeigen würde. Danach nahm er Rothgar beiseite und teilte ihm mit, der König hätte ihn zu einer privaten Audienz bestellt.
„Aha, ich bin also noch nicht komplett entkommen“, murmelte Rothgar, und selbst sein diskreter Sekretär blickte ihn gequält an.
Er machte sich zum Schlafgemach des Königs auf, das nur noch für Audienzen genutzt wurde. Er wusste, dass man ihn keinesfalls schelten, sondern umgarnen würde, und danach würde der König ihn um seinen Rat in anstehenden komplexen Angelegenheiten bitten.
Manchmal ermüdete ihn diese Rolle. Manchmal wünschte er sich sogar, wie Sir George zu sein, nur verantwortlich für ein kleines Anwesen und seine Familie. Er war jedoch in diese Pflichten hineingeboren, und Gott hatte ihm das Talent gegeben, seinem Land von Nutzen zu sein. Er konnte sich nicht heraushalten, ohne dabei seine Ehre zu verlieren.
Nach seiner Rückkehr nach Hause zog Rothgar erleichtert sein steifes Hofkostüm aus und veranlasste einige Dinge, die aus dem Gespräch mit dem König resultierten.
Obwohl der Friedensvertrag mit Frankreich unterzeichnet worden war, gab es in Paris immer noch Leute, die wieder den Krieg herbeisehnten und die Niederlage ungeschehen machen wollten. Es war notwendig, ihre Pläne zu kennen und auf ihre Spione in England Acht zu geben. Rothgar konnte häufig Informationen beschaffen, die offizielle Ermittler nicht herausfanden, vor allem, weil er ein eigenes Netz von Spionen unterhielt.
Als Nächstes kümmerte er sich um einen Stapel von Dokumenten, die er mit einem Siegel versehen und unterschreiben musste. Dann wandte er sich belanglosen Dingen zu, Briefen und Listen von Leuten, die auf seine Dienstleistungen oder seine Gönnerschaft hofften. Er blätterte sie beiläufig durch, weil er nicht in der Stimmung für solche Dinge war, bis er bei einem Päckchen angelangt war, das ihm ein Verleger geschickt hatte.
Es enthielt eine Auswahl von Gedichten. Er überflog sie und legte einige beiseite, weil sie interessant schienen. Dann stieß er auf ein paar Seiten, die den Titel Diana, eine Kantate trugen. Sie wurde Monsieur Rousseau zugeschrieben, war jedoch ins Englische übersetzt. Ein leichtes Stück, aber da ihm sofort eine andere Diana in den Sinn kam, auch ein interessantes.
Die Sonne schon fast am Horizont verschwand,
Als die keusche Diana und ihre Jungfernschar ...
Lady Arradale. Sie hatte einen festen Charakter, einen offenen Blick und einen Körper, der für die Liebe geschaffen war.
Wahrscheinlich war sie jedoch eine keusche Jungfrau und darüber nicht gerade glücklich.
Eine Abschrift davon könnte ein amüsantes Geschenk sein.
Er verstand ihren Beschluss, nicht zu heiraten, aber eine solche Entscheidung forderte ihren Preis, besonders für eine Frau. Sicher fiel es ihr nicht leicht, ihre weiblichen Bedürfnisse zu befriedigen. Außerdem war eine unverheiratete Frau für viele Menschen eine Beleidigung des Himmels; als alte Jungfer dazu bestimmt – in den Worten Shakespeares –, Affen in die Hölle zu geleiten.
Aus irgendeinem Grund hatte der König heute nach ihr gefragt, und sicher gehörte er ebenfalls zu denen, die beleidigt waren. Wenig angetan war George vor allem von der Vorstellung, dass sich eine junge alleinstehende Frau in der besonderen Position befand, die Peerswürde mit ererbtem Besitz im Oberhaus innezuhaben.
In der Hoffnung, dass der konventionelle König ihre Existenz komplett vergaß, hatte Rothgar gleichgültige Antworten gegeben. Die Könige von England waren durch viele Regeln eingeschränkt, aber sie hatten immer noch Biss.
Rasch las er den Text der Kantate durch. Sie beschrieb einen Angriff der Göttin Diana auf Amor, also auf die Liebe. Das würde der Gräfin gefallen, dachte er. Würde es auch als Warnung dienen? Am Ende ging ein Pfeil daneben, und Diana unterlag der Liebe.
Vielleicht, dachte er, als er die Seiten zu den interessanten Gedichten legte, sollte er auch eine Abschrift davon bei sich haben.
Er war sich darüber im Klaren – über solche Dinge war er sich immer im Klaren –, dass Lady Arradale einen lauernden Pfeil darstellte. Sie war hübsch und lebhaft, doch das waren nur ihre unbedeutendsten Reize. Wegen ihrer ungewöhnlichen Stellung war sie zu einer außergewöhnlichen Frau geworden, klug, kühn und tapfer.
Sie war außerdem eigensinnig, impulsiv und vielleicht sogar verwöhnt. Normalerweise würden solche Eigenschaften jegliches Interesse seinerseits zum Erlöschen bringen, aber in ihrem Fall riefen sie seinen Beschützerinstinkt hervor. Als Cousine von Brands Braut gehörte sie fast zu seinem Heiligtum, seiner Familie.
Ein weiser Mann vermied die Gefahr. Während er seinen Siegelring am Finger auf und ab schob, zog er in Betracht, überhaupt nicht an Brands Hochzeit in Yorkshire teilzunehmen. Dann würde er gar nicht erst in die Reichweite des Pfeiles gelangen.
Die übrige Familie plante jedoch hinzufahren, und er wollte das glückliche Ende von Brands Abenteuer miterleben.
Er prüfte, ob er noch irgendwelche Papiere übersehen hatte, und stand vom Schreibtisch auf. Er konnte ruhig hinfahren. Die Komplikationen, die sich aus dem Ende des Krieges mit Frankreich ergaben, boten Grund genug, rasch nach London zurückzukehren. Zusätzlich würde er veranlassen, dass Carruthers ihm per Eilboten Unterlagen zuschickte, um ihm die aktuelle Lage zu verdeutlichen.
Ein Abwehrmanöver, aber ein kluges. Man überlebte am ehesten, wenn man der Gefahr aus dem Weg ging. Er würde einen Tag vor der Hochzeit ankommen und am Tag danach abreisen. Drei Tage. Es würde ihm leicht fallen, drei Tage lang Verwicklungen mit der Gräfin zu verhindern.
Als er das Zimmer verließ, um sich auf seine abendlichen Verpflichtungen vorzubereiten, war ihm jedoch bewusst, dass es viele historische Dramen gab, ja sogar Tragödien, die das Gegenteil bewiesen.
Drei Tage waren Zeit genug für eine komplette Katastrophe.
Drei Tage, sagte sich Diana, als sie auf das Signalhorn des Pförtners wartete, der die Ankunft der Malloren-Kutschen ankündigte. Er würde nur drei Tage bleiben. Sie konnte diese drei Tage überstehen, ohne in irgendeine Katastrophe zu geraten.
Trotz dieser Vorsätze spannte sich jedoch jeder einzelne Nerv an, als das Horn in der Ferne ertönte. In früheren Tagen hatte jenes Horn zum Beobachtungsstand des Schlosses gehört und vor Feinden gewarnt. Vielleicht hatte sie die Erinnerung daran noch im Blut, denn ihr Herz begann zu rasen und ihr Mund wurde trocken.
Sie zwang sich zur Vernunft. Dies war kein Überfall. Es war eine Feier des Hauses und eine Hochzeit. Sie würde die perfekte Lady sein, der Marquis der perfekte Gentleman, und in drei Tagen würden sie sich wieder trennen.
Mit etwas Glück diesmal für immer.
„Diana?“
Sie fuhr herum und erblickte ihre Mutter. Die verwitwete Gräfin komplizierte alles, indem sie nicht nur eine, sondern zwei Hochzeitsglocken läuten hörte. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, dass Dianas Nervosität aus ihrer Zuneigung für den Marquis resultierte.
„Das sind die Mallorens, vermute ich“, sagte ihre Mutter beiläufig. „Gehst du nicht hinunter, um sie zu begrüßen?“
„Ja, natürlich, Mutter.“
Die Lippen ihrer Mutter verzogen sich zu einem fast schelmischen Lächeln. „Du hast Arradale von innen nach außen gekehrt, um alles herzurichten, meine Liebe, und du gehst schon eine Stunde lang hier im Raum auf und ab, und jetzt zögerst du. Was ist mit dir los?“
Keine mädchenhafte Aufregung, Mutter.
„Nichts“, sagte Diana mit gezwungenem Lächeln und eilte vor diesem wissenden Blick davon.
Dianas Mutter hatte die Motive, aus denen ihre Tochter unverheiratet geblieben war, nie verstehen können. Sie betrachtete die Verpflichtungen einer Grafschaft als eine schreckliche Last und nicht als aufregende Herausforderung. Sie war hartnäckig davon überzeugt, dass ihre Tochter nur den richtigen Mann suchte, und hoffte, dass sie ihn in dem Marquis gefunden hatte.
Den Letzten, der dafür geeignet war.
Diana rauschte die breite Treppe hinunter in die getäfelte Eingangshalle und hoffte, dass ihre Mutter in den nächsten Tagen keine peinlichen Bemerkungen von sich geben würde. Eines beruhigte sie. Der Marquis war ebenso entschlossen wie sie, eine Heirat zu vermeiden.
Die Kutschen fuhren gewiss noch die Auffahrt hinauf, sodass Diana stehen blieb, um sich in dem prächtigen vergoldeten Spiegel zu betrachten. Ihrem Äußeren hatte sie sich mit großer Sorgfalt gewidmet.
Als sie und der Marquis das letzte Mal aufeinandergetroffen waren, hatte er gerade versucht, ihre Cousine Rosa zu entführen. Sie hatte ihn mit ihrer eigenen Pistole und einer kleinen Armee von Männern des Landsitzes davon abgehalten. Sie bereute es nicht. Möglicherweise war es der ruhmreichste Moment ihres Lebens gewesen. Dennoch hatte sie sich heute auf eine Art und Weise gekleidet, die ihn daran erinnern sollte, dass sie vor allem eine Dame war.
Sie trug ein blassgelbes Kleid, das mit cremefarbenen Blumen besetzt war, und als Ohrschmuck und auf einem cremefarbenen Halsband einfache Perlen. Ihre Locken kräuselten sich frivol und beinahe ein bisschen albern aus einer Haube aus Musselin und Bändern hervor. Sie trug sogar eine der modernen, nur dem Schmuck dienenden Schürzen aus Seidengaze und Spitze. Ihr gerötetes Gesicht war leicht gepudert.
Sie hob die Hände, die Handflächen ihrem Gesicht zugewandt, sodass ihre acht Ringe im Spiegel aufblitzten. So sanft und süß sie auch wirken wollte, sie konnte es nicht ertragen, ohne ihre Ringe zu sein, auch wenn sie sie dem Marquis gegenüber schon einmal verraten hatten. Tatsächlich trug sie genau die gleichen verräterischen Spielereien wie beim letzten Mal, als sie ihn auf Arradale willkommen geheißen hatte.
Man sagte ihm eine hervorragende Beobachtungsgabe und Allwissenheit nach, sodass er sich an alles erinnern dürfte. Er würde die Herausforderung erkennen. Sie war eine Dame, aber sie war auch die Gräfin von Arradale.
Außerdem befand er sich auf ihrem Land.
Sie wartete noch einen Moment und ging dann auf die prächtigen Türen zu. Als ihre Diener die Türflügel öffneten, flutete das Sonnenlicht herein, und sie sah vier große Reisekutschen, die vor den doppelten Treppenbögen zum Stehen kamen. Drei andere, die vermutlich Gepäck und Bedienstete enthielten, waren abgebogen und fuhren zum Hintereingang des Hauses.
Sieben! Und sie entdeckte Vorreiter. Sie selbst reiste auch mit viel Aufwand, aber dies war übertrieben, selbst für eine ganze Familie. Sie brachten auch Kinder mit, was eine Überholung der schon lange nicht mehr benutzten Kinderzimmer erforderlich gemacht hatte. So etwas übertrieben Lächerliches machten nur die Mallorens.
Nur drei Tage, sagte sie sich, als sie langsam durch die offenen Türen schritt, um ihren schnellen Herzschlag zu verbergen. Mit einem freundlichen Lächeln hob sie ihre weiten Röcke etwas an und ging die Treppen hinunter, um die aus den Kutschen kletternden Gäste zu begrüßen. In Gedanken probte sie kühle, höfliche Begrüßungsworte, doch dann erblickte sie eine Dame, der aus der zweiten Kutsche geholfen wurde, und vergaß die Anstandsformen.
„Rosa!“, rief sie und lief auf ihre Cousine und teuerste Freundin zu, um sie kräftig zu umarmen. Sie hatten sich neun Monate nicht gesehen.
Nach einer Weile merkte sie, dass sie ihre Pflichten als Gastgeberin völlig vernachlässigt hatte. Sie errötete und wandte die Aufmerksamkeit von ihrer glücklichen und gesunden Freundin ab, um sich zu entschuldigen. Als sie ein paar Tränen wegwischte, fand sie sich einem amüsierten Lord Brand Malloren gegenüber.
Mit seinen rostbraunen Haaren, die schlicht nach hinten gebunden waren, und seinem sonnengebräunten Gesicht voller Lachfalten passte er hervorragend zu Rosa. Er hatte Diana sogar verziehen, dass sie auf ihn geschossen hatte.
Während sie sich mit Lord Brand unterhielt, bemerkte Diana, dass sie Mühe hatte, zusammenhängend zu denken oder zu sprechen. Er war in der Nähe. Sie wusste es, obwohl sie ihn nicht sehen konnte. Es war lächerlich, aber an einem plötzlichen heißen Prickeln, das ihr den Rücken hinunterlief, spürte sie, dass er hinter ihr stand.
Irgendwie brachte sie das angefangene Gespräch zu einem sinnvollen Ende und drehte sich in der Hoffnung um, dass sie sich geirrt hatte, dass er ganz woanders und alles nur Einbildung oder die Sonne gewesen war.
4
Doch da stand der Marquis, nur ein paar Schritte entfernt, und wartete geduldig. Hatte er immer schon eine solche Wirkung auf sie gehabt, oder war dies irgendeine neue Foltermethode?
„Lord Rothgar!“, rief sie und betete, dass ihr rasendes Herz nicht auffiel, während sie verzweifelt ihrem Drehbuch folgte. „Welch ein Glück, dass wir Euch wieder hier in Arradale begrüßen dürfen.“
Er küsste ihre Hand. Sie spürte nur einen ganz leichten, schicklichen Luftzug auf den Fingerknöcheln, doch die Berührung ihrer Finger löste erneut ein erschreckendes Gefühl aus.
Zur Hölle. Das kam dabei heraus, wenn man ein Jahr lang so viel an einen Mann dachte!
„Das Glück ist ganz auf unserer Seite, Lady Arradale. Besonders da Ihr gewillt seid, eine ganze Horde von Mallorens bei Euch aufzunehmen.“
Kein Anzeichen, dass er ebenfalls erregt war. Sie zog ihre Hand weg. „Für Rosas Hochzeit?“, fragte sie gelassen. „Dafür würde ich eine ganze Horde von Monstern willkommen heißen, Mylord.“
„Dann sollte es Euch gelingen, uns zu überleben. Erlaubt mir, dass ich Euch vorstelle.“
Mit einer leichten Berührung ihres Ellbogens führte er sie zu einer Familie, die aus einer der hinteren Kutschen ausstieg, doch selbst diese formelle Berührung schien Funken zu erzeugen. Hilfesuchend schaute sie sich nach Rosa um, aber ihre Cousine lächelte gerade Lord Brand an und nahm ihre Umgebung nicht wahr.
„In der Tat“, murmelte der Marquis, als hätte sie etwas gesagt. „So benehmen sie sich ständig. Welch ein Glück, dass wir auf eine solche schwächende Torheit verzichtet haben.“
Falls er geplant hatte, sie wieder zu beruhigen, hätte er keine besseren Worte finden können. Sie versuchte, würdevoll und ruhig zu wirken, und ging auf die Familie zu.
Sie bestand aus dem Ehepaar und ihren vier Kindern im Alter von ungefähr eins bis acht Jahren.
„Lord und Lady Steen“, sagte er, „und die Lady ist meine Schwester Hilda. Die Kinderschar ist unendlich verwirrend, also überlasse ich es ihnen, sie vorzustellen.“
Dessen ungeachtet trottete das kleinste Kind, das braune glatte Haare auf dem Kopf trug, fröhlich lächelnd und mit geöffneten Armen auf sie zu und gab etwas von sich, das klang wie: „Onkebay! Onkebay!“
Diana war überrascht, dass der Marquis es hochhob, wenn auch mit einem hörbaren Seufzen. „Dies ist Arthur Groves, Lady Arradale, ein Bursche ohne jede Vorurteile, wie Ihr seht. Er würde auch bei einem Tiger Annäherungsversuche machen.“ Der Junge hatte seinen Arm vertrauensvoll um den Hals seines Onkels gelegt und schien keine Angst vor irgendwelchen Zähnen zu haben.
Diana fühlte sich beinahe, als wäre sie selbst gebissen worden. Sie hatte sich darauf vorbereitet, den Finsteren Marquis zu treffen, aber was sollte sie mit diesem Mann anfangen? Ein Finsterer Marquis trug gewiss keine Kinder herum!
„Mein Bruder ist mit seiner Weisheit am Ende.“
Diana drehte sich verwirrt zu Lady Steen um. So stellte sie sich eine ‚rote Malloren‘ vor, obschon ihr mittelbraunes Haar nur durch ein paar rötliche Strähnen aufgehellt wurde. Sie hatte jedoch das gleiche natürliche Lächeln wie Lord Brand.
„Es ist schwer, die Schwarze Eminenz von England zu sein“, fuhr die Lady fort, „wenn einem ein schmuddeliges Kind überallhin folgt.“
Ein kurzer Seitenblick zeigte Diana, dass die Schwarze Eminenz mit ihrer Weisheit durchaus nicht am Ende, sondern vollkommen entspannt und damit beschäftigt war, mit dem Kind eine Art Unterhaltung über die Pferde zu führen. Was den kleinen Arthur betraf, so bestand diese aus einer Menge Geplapper und Zeigen, aber nach der Aufmerksamkeit und den vernünftigen Antworten des Marquis zu urteilen, konnte man meinen, das Kind gäbe durchaus weise Dinge von sich.
Sie durfte es nicht beachten, beschloss sie einige Sekunden zu spät. Sie durfte nicht hinsehen, hinhören oder solchen Dingen irgendeine Art von Aufmerksamkeit schenken. Er war der Finstere Marquis, und sie würde ihn in den nächsten drei Tagen so oft wie möglich ignorieren.
Lady Steen zog zwei Mädchen nach vorn, die versuchten, sich hinter ihren Röcken zu verstecken. „Darf ich meine Töchter vorstellen, Lady Arradale? Sarah und Eleanor.“ Die beiden Mädchen machten schüchtern einen kleinen Knicks. „Und dies“, fügte sie hinzu, während sie auf einen wohl erzogen wirkenden Jungen zeigte, der neben seinem Vater stand, „ist Charles, Lord Harber.“ Eine korrekte Verbeugung und aufrichtige, kluge Augen.
„Ich kann nicht versprechen, dass sie sich alle perfekt benehmen werden“, bemerkte Lady Steen mit einem Seitenblick auf ihre kichernde Tochter, „aber ich hoffe, sie werden Euren Haushalt nicht zu sehr durcheinander bringen. Wir haben sie mitgebracht, weil wir von hier aus alle nach Schottland weiterreisen.“
Während sie Belanglosigkeiten über Reisen austauschten, bemerkte Diana, dass sie sich entspannte. Erstaunlich, dass diese freundliche, natürliche Frau und ihr liebenswürdiger, treuer Mann zu den Mallorens gehörten.
Einen Augenblick später merkte sie, dass es gefährlich war. Es könnte ihre Vorsicht untergraben. Sie war äußerst froh, auf die Passagiere der nächsten Kutsche zugehen zu können.
Der Marquis, der immer noch geduldig das plappernde Kind auf dem Arm trug, stellte sie einem Mann vor, der ebenso dunkel und dramatisch wie er selbst wirkte. Diana begrüßte Lord Bryght Malloren und dachte, genau so hatte sie sich alle Mallorens vorgestellt.
Er war möglicherweise der ansehnlichste Mann, den sie je zu Gesicht bekommen hatte. Mit seinem geheimnisvollen und hageren Gesicht, den schönen Augen und der etwas zynischen Art war er sicher in der Lage, jede Frau auf der Stelle dahinschmelzen zu lassen. Einem solchen Mann konnte sie widerstehen.
Seine Frau war schockierend. Sie war klein, schmächtig und mit ihren roten Haaren und den zahlreichen Sommersprossen fast hässlich. Als Diana sie begrüßte, fing sie zu allem Übel noch einen kurzen innigen Blick der beiden auf, der ihre Liebe, Leidenschaft und Treue gleichsam in die Welt hinausschrie.
„Ja“, murmelte der Marquis, als sie weitergingen. „Noch mehr von diesen Betörten. Ich warne Euch, es scheint ansteckend zu sein. Meine ganze Familie wurde in kurzer Zeit davon befallen. Ich bin natürlich immun, aber für Euch ist es riskant.“
„Ich bin ebenfalls immun, Mylord, das versichere ich Euch.“
„Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin, denn ich bin die einzige ledige männliche Person, die hier ist. Wir können uns heute Abend auf einer Insel der Nichtansteckung zusammensetzen.“
Sie lachte, fragte sich aber, ob man ihr die Panik anmerkte. Er hatte recht. Sie waren das sonderbare Paar in dieser Gesellschaft! Was hatte sie hier nur zusammengeführt? Es konnte einfach nicht sein. Ein paar Minuten in seiner Gesellschaft hatten ihr klar gemacht, dass sie die Wirkung, die er auf sie haben konnte, falsch eingeschätzt hatte.
Ganz abgesehen von der Verteilung der Schlafzimmer – du lieber Himmel!
Selbst in einem Haus, das so groß war wie Arradale, wurden bei einer solchen Anzahl von Gästen alle guten Schlafzimmer gebraucht. Sie selbst schlief in den Gemächern des Earls, doch ihre Mutter war schon vor langer Zeit aus den Räumen der Gräfin ausgezogen, um woanders zu schlafen. Jemand musste also den Gemächern der Gräfin zugewiesen werden, weshalb sie beschlossen hatte, dass der Marquis dort schlafen konnte – nicht ohne eine gewisse Häme. Die Zimmer waren in einem besonders weiblichen Stil eingerichtet.
Sie hatte weder daran gedacht, dass sie genau nebeneinanderlagen, noch, wie es auf andere wirken könnte.
Oh Herr! Gab es noch irgendeine Möglichkeit, die Dinge zu diesem späten Zeitpunkt zu ändern?
Der kleine Arthur wollte plötzlich wieder herunter und rannte auf einen rothaarigen Burschen zu, der sich gerade eben auf seinen Beinen halten konnte und sich an die Hand eines Dienstmädchens klammerte.
„Unser Sohn Francis“, sagte Lord Bryght und ging auf den Jungen zu, um ihn selbst an die Hand zu nehmen. Dann hob er ihn schwungvoll hoch, woraufhin der Kleine fröhlich krähte. „Wir erwarten nicht, dass Ihr Euch merken könnt, wer wer ist oder wer zu wem gehört, Lady Arradale“, fügte er hinzu und schwenkte das Kind hin und her, sodass es vor Freude gluckste. „Es gibt immer die Hoffnung, dass sie außer Sicht- und Hörweite bleiben.“
Seine Frau prustete vor Lachen. Diana versuchte einfach nur, sie nicht fassungslos anzustarren. Geheimnisvolle, aufregende und verwegene Männer waren doch keine liebevollen Väter!
Lord Rothgar führte sie zur letzten Kutsche. „Ich fürchte, Portia hat recht, obwohl Euer Haus immerhin größer als die Gasthäuser ist, von denen einige uns wahrscheinlich nie wieder sehen möchten.“
Jetzt auch noch Humor und Toleranz. Diana war vollkommen hilflos. Sie wusste nicht mehr, was als Nächstes kommen würde oder wie sie sich verhalten oder schützen sollte. Oder besser, wovor genau sie sich schützen sollte.
„Ich glaube, meine Schwester Elf kennt Ihr“, sagte der Marquis und riss sie aus ihren verwirrten Gedanken, während er auf ein anderes Paar zeigte. Bei einer ihrer zwei Reisen nach London hatte Diana Lady Elfled Malloren in der Tat kennengelernt und sympathisch gefunden.
„Ich darf auch Lord Walgrave, ihren Mann vorstellen.“
Lady Elf war eine andere rote Malloren – etwas heller und unbekümmerter. Ihr Mann hatte braune Haare und war recht stattlich, doch nicht so eindrucksvoll wie Lord Bryght. Etwas kräftiger. In dieser Gesellschaft fast schon durchschnittlich.
Fast eine verwandte Seele! Vielleicht konnte sie ihre Zeit mit Lord Walgrave verbringen und über die Mallorens sprechen, statt ein auffälliges Paar mit Lord Rothgar zu bilden. Schließlich pflegten verheiratete Paare in der Öffentlichkeit nicht die Nähe des anderen zu suchen.
Sie erkannte jedoch allmählich, dass die Mallorens sich wenig um übliche Verhaltensweisen kümmerten und nur das taten, was ihnen gefiel. Wie sollte sie damit umgehen?
Wenigstens hatten die beiden keine Kinder, und die Walgraves waren die Letzten. Sie wusste, dass es noch einen anderen Bruder gab. Lord Cynric. Er und seine Frau waren in Canada, Gott sei Dank.
Genug war genug.
Drei Tage, wiederholte sie im Stillen wie eine schützende Zauberformel, während sie sich umdrehte und die Walgraves zum Haus geleitete.
„Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin, dass wir diese Reise hinter uns haben“, sagte Lady Elf. „Mein Umfang vergrößert sich, und das erweist sich als unglaublich ermüdend.“
Diana hätte es wissen müssen.
Töricht und fruchtbar, alle zusammen.
Vielleicht hatten sie vor, England allein dadurch zu beherrschen, dass sie in der Überzahl waren!
Außer dem Marquis, der deutlich gemacht hatte, dass er nicht beabsichtigte, zu heiraten oder Kinder zu zeugen. Sie war also vor der schlimmsten aller Torheiten geschützt, doch aus irgendeinem Grund war sie nicht vollkommen überzeugt ...
Sie schob alle Gedanken an ihn zur Seite. „Übelkeit?“, fragte sie.
„In unvorhersehbaren Momenten. Wenn ich mich manchmal zurückziehe, seid einfach dankbar, dass ich rechtzeitig geflüchtet bin.“
„Wie nett von Euch, dass Ihr die Mühen in Kauf nehmt, um bei der Hochzeit dabei zu sein.“
„Oh, wir konnten doch keine Familienhochzeit verpassen, nicht wahr?“, fragte sie und warf ihrem Mann ein Lächeln zu.
„Natürlich nicht“, antwortete er, obwohl Diana das Gefühl hatte, dass er nicht ganz ihrer Meinung war. Der Gatte einer Malloren zu sein, war zweifellos eine anstrengende Rolle.
„Wir hatten schon so oft das Vergnügen“, sagte Lady Elf, und Diana erinnerte sich, dass sie gern erzählte. „Hochzeiten, meine ich. Und diese hier ist wenigstens ganz gemütlich geplant, ohne Mitglieder des Königshauses.“
Diana widerstand dem Bedürfnis, Fragen zu stellen. Den Familienklatsch würde sie von Rosa erfahren. Sie war jedoch neugierig, ob Lady Elf wegen ihres zunehmenden Umfangs zum Altar hatte eilen müssen.
„Und ich freue mich, in den Norden zu kommen“, fügte Lady Elf hinzu.
Nein. Diana durfte nicht vergessen, dass sie jetzt Lady Walgrave war. „Es ist so herrlich hier. All die wilden Blumen auf den Wiesen. Die Hügel. Die Aussicht! Wenn ich malen könnte, würde ich versuchen, es festzuhalten. Wie die Dinge liegen, würde ich mir während unseres Aufenthaltes gern ein wenig Industrie ansehen.“
„Industrie?“ Diana fürchtete, sie sei nicht ganz bei der Sache gewesen und hätte sich verhört.
„Tuchfabriken. Baumwollmanufakturen. Solche Dinge.“
Diana sah sie verständnislos an. Eine Reise durch Schottland war nicht ungewöhnlich, aber eine Reise durch Fabriken?
„Ich interessiere mich dafür“, sagte Lady Elf mit einem schelmisch wirkenden Lächeln. „Wir werden mit Bryght und Portia weiterreisen, weil sie das Aquädukt des Herzogs von Bridgewater sehen möchten. Außerdem interessieren wir uns alle für den Hafen von Liverpool.“
Diana gab ein paar geistesabwesende Antworten, begann sich jedoch zu fragen, ob dies alles ein Traum war. Sie hatte ohnehin Albträume von diesem Treffen gehabt.
Es war nicht überraschend, dass Besucher aus dem Süden das berühmte Aquädukt sehen wollten – sie selbst war vor vier Jahren bei seiner Eröffnung dabei gewesen. Aber den Hafen von Liverpool? Und Fabriken?
Sie hatte ein Fest für gelangweilte Leute aus dem Süden geplant, die angesichts des wenig luxuriösen Nordens verdrießliche Gesichter machten. Nun wusste sie nicht, worauf sie sich einstellen sollte. Wollte der Marquis vielleicht in eine Bleimine hinuntersteigen oder einen Ausflug zum Torfstechen vorschlagen?
Sie sah sich um.
Dies war jedoch real, und am liebsten wäre sie weggelaufen, um sich die nächsten drei Tage im Moor zu verstecken. Stattdessen besann sie sich auf ihr lebenslanges Training und verbarg ihr Unbehagen, während sie all die vielen Mallorens ihren Dienern übergab. Wenigstens bot ihr das ein wenig Aufschub.
Sie ging die Pläne für den restlichen Tag noch einmal durch.
Alle würden nun ein wenig Zeit in ihren Räumen verbringen und sich von der Reise erholen. Als Nächstes das Abendessen, aber sie hatte schon dafür gesorgt, dass sie und der Marquis an den gegenüberliegenden Enden des Tisches saßen. Danach Musik und Kartenspiele, um alle zu beschäftigen, was es ihr ermöglichen würde, ihm aus dem Weg zu gehen.
Morgen war die Hochzeit. Alles würde gut gehen ...
Ein plötzliches Kreischen ertönte. Es wurde von der hohen Decke zurückgeworfen, prallte dann von den Marmorwänden und Säulen ab, um sich mit erneutem Gebrüll zu vermischen.
Der kleine Arthur hatte einen Wutanfall, jene Sorte von unkontrollierbaren Wutanfällen aus Übermüdung, die nicht zum Schweigen gebracht werden konnten.
Das Baby Francis auf dem Arm seines Vaters hatte beschlossen, mit rotem Gesicht in das Kreischen mit einzustimmen. Während Lord Bryght seinen Sohn hastig bei einem der Kindermädchen ablud und ein anderes den sich windenden, brüllenden Arthur entgegennahm und davoneilte, widerstand Diana dem Bedürfnis, sich die Ohren zuzuhalten.
Die Kindermädchen waren mit bemerkenswerter Geschwindigkeit verschwunden. Die besorgten und vielleicht auch verlegenen Eltern eilten hinterher. Das Echo erstarb, und der Frieden kehrte zurück. Die Walgraves liefen mit angespannten Gesichtern die Treppe hinauf.
Wie er vorhergesagt hatte, blieben nur der Marquis und sie übrig.
Diana wollte etwas Unbedeutendes zu ihm sagen, bevor sie entkam, hielt jedoch inne, als sie seinen Gesichtsausdruck sah. „Geht es Euch gut, Mylord?“
Seine anspannte Miene glättete sich, wenngleich er immer noch recht blass wirkte. „Nur ein wenig Kopfschmerzen, das ist alles“, sagte er und fügte mit einem leicht gequälten Lächeln hinzu: „Die Akustik dieses Raumes ist allerdings erstaunlich.“
Diana ertappte sich dabei, wie sie sein Lächeln erwiderte, ein Lächeln, das zu erkennen gab, sie beide seien die einzigen normalen Menschen in einer verrückten Welt.
Oh doch, dies war gefährlich. Hastig ergriff sie die Flucht und rannte zum Arbeitszimmer des Anwesens, wohin ihr kein Gast folgen konnte.
Es schien nicht zu helfen.
Jenes Lächeln hatte offenbar einen gefährlichen, seidenen Faden zwischen ihnen gesponnen, einen Faden, der nicht riss, selbst wenn sie in Sicherheit war und die Tür fest hinter sich geschlossen hatte.