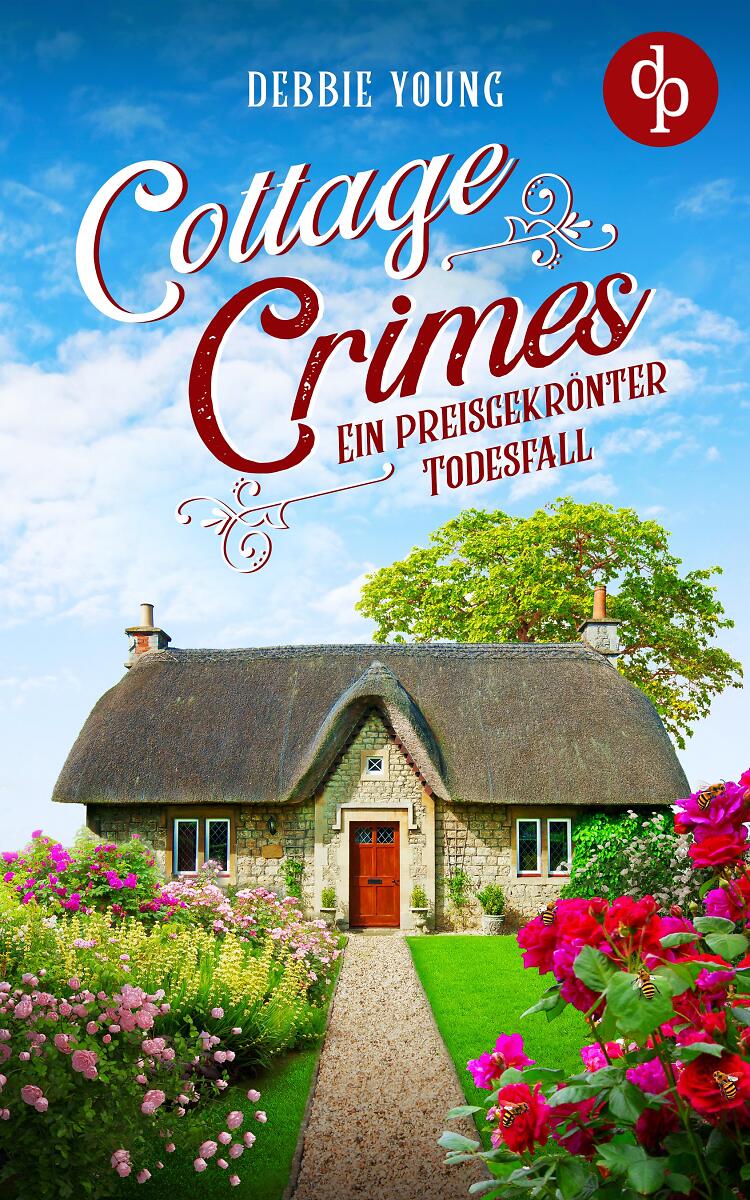Prolog: Kein Kopf für einen Mord
Von meinem Platz aus wirkten Anne Boleyn und Catherine Howard bemerkenswert sauber und wohlriechend, wenn man bedachte, dass sie gerade geköpft worden waren. Durch die feuchte Sommerbrise wehte mir der herbe Duft von Lavendel entgegen, ausgehend von den hübschen Sträußen, die an den Gürteln der sechs Ehefrauen von Henry VIII. baumelten.
Die abgetrennten Köpfe von Anne Boleyn und Catherine Howard, die aus mit Pappmaschee überzogenen Luftballons bestanden, lagen fein säuberlich in Weidenkörben und lächelten dort gutmütig vor sich hin. Die Hälse – aus zuckerrosa Pappe gefertigt und in die Oberteile der Tudor-Kleider gesteckt – ruhten auf umgedrehten, vom örtlichen Baumeister geliehenen Hohlblocksteinen. Die echten Köpfe der Königinnen waren sicher unter den aufgesetzten Schulterteilen der Kostüme verborgen, und die Ausschnitte der Kleider waren mit gestärkten Halskrausen versehen und obendrein zugenäht, was die Illusion einer Hinrichtung komplett machte.
Um zu vermeiden, dass die kopflosen Königinnen auf dem Karnevalswagen hin und her schwankten, während jener die High Street hinauftuckerte, waren sie an ein um den Anhänger verlaufendes Geländer gebunden. Die anderen vier Ehefrauen von Henry VIII. saßen aufrecht und unversehrt auf niedrigen Holzthronen, die dem Chorgestühl der Dorfkirche entliehen worden waren. Auf einem Podest am Ende des Wagens sonnte sich der König auf einem großen Bischofsstuhl.
Man konnte es Tom, dem Scharfrichter, nicht verdenken, dass er mit seiner sauber ausgeführten Arbeit sichtlich zufrieden war. Auf dem ganzen Weg die High Street hinauf hatte er der Menge so stolz zugewinkt, als hätte er gerade die MasterChef-Kochshow gewonnen. Beim Anblick der dunklen Kapuzengestalt brachen zwei kleine Kinder erschrocken in Tränen aus. Sie beruhigten sich erst wieder, als der Scharfrichter seine Sturmhaube hochzog, um zu offenbaren, dass es sich bei ihm in Wirklichkeit um Ian handelte, den Verkehrshelfer der Dorfschule.
Wir auf dem Wagen der Wendlebury Writers hielten es für besser, nicht auf königliche Art und Weise zu lächeln und zu winken, denn sonst hätten wir kein glaubhaftes Bild literarischer Helden abgegeben. Übrigens, ich war Virginia Woolf.
Während wir unruhig auf das Urteil der Jury warteten, bemerkte ich, dass Rex, der Direktor der Wendlebury Players, der sich selbst die Rolle von König Henry VIII. zugeschanzt hatte, zu mir herüberstarrte. Schamlos angesichts der Tatsache, dass seine Freundin Dido im Publikum war.
Ich konnte mir nicht helfen, aber irgendetwas hatte dieser Mann an sich. Seit ich ihn bei den Proben im Juni zum ersten Mal getroffen hatte, war ich auf der Hut. Vor Zorn errötend, richtete ich den Blick in die andere Richtung. Ich hoffte inständig, dass Dido nicht dachte, zwischen uns liefe etwas.
Ein Ablenkungsmanöver musste her, also tat ich einfach so, als fesselte mich der Anblick eines weiteren Motivwagens: Das Fraueninstitut, dessen Wagen auf unserer anderen Seite parkte, hatte sich das Motto der Suffragetten auf die Fahnen geschrieben. Es war ein interessantes Spektakel. Vor einer Kulisse, die einer Londoner Straße nachempfunden war, waren eine Reihe große Eisengitter aufgestellt: Kunststoffzäune, die mit metallgrauer Farbe besprüht waren. Und daran angekettet waren ein halbes Dutzend Damen mittleren Alters in geliehenen My-Fair-Lady-Kostümen. Die Frau in der Mitte trug eine große Rosette mit der Aufschrift „Mrs Pankhurst“, um das Thema zu verdeutlichen. Alle sechs waren geschmückt mit den charakteristischen Schärpen der Suffragetten-Bewegung in Grün, Lila und Weiß, wie man sie heute eher mit Schönheitsköniginnen in Verbindung brachte. Keine der angeketteten Demonstrantinnen sah aus, als hätte sie kürzlich hungerstreikend im Gefängnis gesessen.
Was Virginia Woolf wohl von unserem Dorffest gehalten hätte? Ich wünschte, ich hätte etwas mehr Zeit mit Recherche verbracht, ehe ich sie zu meiner literarischen Heldin auserkoren hatte. Zumindest hätte ich eines ihrer Bücher lesen sollen. Ausgesucht hatte ich sie mir nur deshalb, um meinen neuen Freunden von den Wendlebury Writers zu imponieren. Von meiner Klugheit überzeugen wollte ich auch meinen Boss, Hector Munro. Er war der Besitzer des örtlichen Buchladens und zog, verkleidet als Homer, just in diesem Moment unseren Wagen mit seinem Land Rover.
Doch ganz abgesehen von Virginia Woolf – ich war mir ja selbst nicht im Klaren, was ich über die Dorfshow denken sollte. Obwohl ich als Schülerin in den Sommerferien regelmäßig hergekommen war, um für zwei Wochen bei meiner Großtante May Urlaub zu machen, hatten sich meine Besuche nie mit der Show überschnitten. Jetzt, da ich fünfundzwanzig war, war ich zurückgekehrt, um hier zu leben, und ich hatte angenommen, meine Teilnahme an der Karnevalsparade wäre lediglich ein harmloser Spaß. Nun war ich mir da nicht mehr so sicher.
Durch den würzigen Duft frischen Heus, der über dem Platz lag, witterte ich plötzlich einen fauligen Geruch: Der Henker hatte gefurzt und stand ausgerechnet mit dem Rücken zu mir und Anne Boleyn. Die Glückliche, ihr blieb diese kleine, übel riechende Wolke erspart, weil sie mit ihrem Kopf unter dem Kleid steckte, dachte ich gerade, als ein lautes Knistern aus den Lautsprechern uns darauf aufmerksam machte, dass die Jury gleich die Ergebnisse des Motivwagenwettbewerbs bekannt geben würde.
Stanley Harding, der Vorsitzende des Dorffestes, rief mit seinem ausgeprägten Gloucestershire-Akzent: „Gratulation an alle Teilnehmer für die abwechslungsreichen Beiträge zu unserem Karnevalsumzug.“ Nach einundzwanzig Jahren in dieser prestigeträchtigen Position war er geübt in seiner Rolle als Sprecher. Das Amt war ihm quasi in die Wiege gelegt worden. Keiner hatte dagegen Einwände erhoben, nachdem er seinem Vater in das Amt gefolgt war, der es wiederum von seinem Vater übernommen hatte. Wenn man von der offenkundigen Freude der wuseligen Zuschauermenge an der Veranstaltung ausging, schien dieses neuzeitliche Feudalsystem niemandem auch nur in geringster Weise geschadet zu haben.
„Meinen Dank an euch alle für die harte, wundervolle Arbeit, die ihr heute zur Schau gestellt habt. In umgekehrter Reihenfolge vergebe ich die Preise folgendermaßen: Der dritte Platz geht an das Fraueninstitut für den Mary-Poppins-Motivwagen, der Mrs Banks und ihre Suffragettenschwestern gezeigt hat.“
Applaus brandete auf. Die angeketteten Frauen stießen Entzückensschreie aus und schienen unbeeindruckt davon zu sein, dass ihr ernstes politisches Statement als Disney-Film missinterpretiert wurde. Die Suffragetten versuchten, sich gegenseitig zu umarmen, vergaßen jedoch, dass sie alle an die Gitter gebunden waren, und es gelang ihnen gerade einmal, ihre Arme und Schultern zu verrenken und die metallgrauen Zäune aus ihrer Verankerung zu reißen. Dass sie gefesselt blieben, trug zum Vergnügen der Menge bei. Keiner kam herbei, um die Vorhängeschlösser zu öffnen und sie zu befreien, und das, obwohl sie um Hilfe riefen.
„Donnerwetter! Mit der Macht dieser Damen werden wir rechnen müssen. Wehe, wenn sie losgelassen. Nehmt euch in Acht, Jungs.“ Stanley machte eine dramatische Pause. „Der zweite Platz geht an die Wendlebury Players für König Rex und seinen Harem. Nein, ich scherze nur, Dido, ich meine Henry VIII. und seine sechs Frauen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass dies das Thema der Theatervorstellungen im November sein wird. Wir freuen uns schon alle darauf. Außer vielleicht die beiden Ehefrauen, denen dann die Köpfe abgehackt werden.“ Er lachte aus vollem Halse über seinen eigenen Witz. „Ich wette, jetzt, wo wir Ian in derart gruseliger Montur zu Gesicht bekommen haben, werden die jungen Rennfahrer unter uns etwas langsamer an der Schule vorbeifahren, wenn er wieder den Verkehr regelt.“
Während Stanley darauf wartete, dass der Beifall abebbte, sah ich mir die übrigen Wagen an und drückte die Daumen, dass wir die glücklichen Gewinner sein würden. Unser Beitrag war bei Weitem der anspruchsvollste.
„Und jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben: Der erste Preis geht in diesem Jahr an den Gartenverein mit seiner Armee von Vogelscheuchen.“
Da die Vogelscheuchen, allesamt aus Fleisch und Blut, an Holzkreuze gebunden waren, konnten sie unmöglich in den tosenden Applaus einfallen. Es wirkte, als gehörten sie einem extremen religiösen Kult an, der auf ordentliche Bekleidung keinerlei Wert legte. Der Treckerfahrer der Gruppe hüpfte von seinem Gefährt und durchtrennte die Seile, die um die menschlichen Strohpuppen gebunden waren, mit einem äußerst scharfen Taschenmesser. Nachdem er alle befreit hatte, nahm die Truppe einen großen, silbernen Pokal von Stanley in Empfang. Schnurstracks machten sich die Gewinner zum Bierzelt auf, um das Preisgeld dafür einzusetzen, den Pokal mit Bier füllen zu lassen. Einigen von ihnen hingen bereits Glimmstängel aus dem Mund, ehe sie das Zelt erreicht hatten, ohne Rücksicht auf die mit Stroh gespickten Kostüme. Ein gefährlicher Zwischenfall war geradezu vorprogrammiert.
Meine Enttäuschung darüber, dass wir Wendlebury Writers keinen Preis einheimsen konnten, war größer, als ich gedacht hatte. Ich fragte mich, ob es daran lag, dass wir nirgendwo angekettet gewesen waren, weil unser Motto nicht Gefangenschaft lautete. Dieses Thema war bei den Gewinnern doch besorgniserregend präsent.
Als sie den mürrischen Ausdruck auf meinem Gesicht sah, erhob sich Louisa, die als Agatha Christie verkleidet war, von ihrem niedrigen Art-déco-Sessel und klopfte mir tröstend auf die Schulter. „Mach dir nichts draus. Wir haben die Leute unterhalten, und darauf kommt es schließlich an – auf eine gute Zusammenarbeit, um eine großartige Show zu liefern. Lass uns die anderen einsammeln, und dann gönnen wir uns einen Cream Tea im Gemeindehaus. Wusstest du, dass Devon Cream Agatha Christies Lieblingsgetränk war? Sie ließ ihn sich zum Dinner im Weinglas servieren.“
Ich wünschte, ich hätte gewusst, was Virginia Woolf an Trinkbarem bevorzugt hatte, um darauf angemessen antworten zu können.
Ich setzte gerade an, auf den Pfennigabsätzen meiner Kitten Heels die Treppen unseres Anhängers hinabzustaksen, als ich einen Schrei vernahm. Auf dem Wagen der Wendlebury Players beugte sich eine kopflose, nunmehr ungefesselte Catherine Howard hin zu Anne Boleyn und rüttelte an deren aufgesetzten Schultern. Trotz des Gazestreifens, der über dem Mieder angebracht war und durch den sie hindurchsehen konnte, drang ihre Stimme gedämpft durch den dicken Stoff des Kleides. „Oh mein Gott, Linda ist ohnmächtig geworden. Wasser, schnell! Binde sie los und hilf mir, sie aus diesem elenden Kostüm zu befreien, Rex. Ich habe dir gesagt, dass es uns viel zu heiß wird, wenn wir mit den Köpfen stundenlang unter diesen Kleidern stecken.“
Hector sprang aus seinem Land Rover, löste einen antiken Dolch vom Gürtel seiner Toga und hielt ihn Rex entgegen. Joshua, mein älterer Nachbar, der die Parade angeführt hatte, trat an seine Seite und fuchtelte mit einem rostigen Taschenmesser herum. Unterdessen löste Anne of Cleves die Schlingen, die Anne Boleyn in Position hielten. So schnell es ihr als fünfzigjähriger Frau möglich war, eilte Carol, die Dorfladenbesitzerin und Gewandmeisterin der Wendlebury Players, eine Schneiderschere schwingend vom Handwerksstand herbei. Die plötzlich vorherrschende Fülle an tödlichen Waffen war beängstigend.
„Untersteh dich, das Kleid zu beschädigen, Rex! Im November muss es noch für vier Abendvorstellungen und eine Matinee herhalten.“ Mit geübten Händen öffnete Carol zahlreiche Reißverschlüsse, Druck- und Ösenknöpfe, die sie in der Woche zuvor liebevoll angenäht hatte. Sie stülpte den Stoff über den Hals aus Pappe und konnte erst dann den Karton entfernen, um darunter Anne Boleyns echten Kopf zu entblößen.
„Seht euch Lindas Gesicht an, sie glüht geradezu“, schrie Catherine Howard und riss den Halsausschnitt ihres eigenen Kleides auf, um mit dem Kopf unter der Halskrause hervorzutauchen. „Sie hat einen Hitzeausschlag und muss ohnmächtig geworden sein.“
Ian legte die Axt ab und kauerte sich stirnrunzelnd neben den reglosen Körper von Anne Boleyn. Er legte einen Arm auf ihre Schultern und zwei seiner dicken Finger auf ihren schlanken Hals, dann blickte er zu Rex hinauf, der mit versteinerter Miene neben ihm stand und an seiner Schamkapsel herumspielte. Rex’ elegante Freundin Dido, die in ihrer Kleidung aus dem einundzwanzigsten Jahrhundert irgendwie nicht hierherpasste, schmiegte sich mitfühlend an ihn.
Ians nächste Worte brauchte ich nicht zu hören. Ich wusste bereits, dass Linda Absolom tot war.
1 Leser, ich habe ihn verlassen
Zwei Monate zuvor, als ich noch in Deutschland gelebt hatte, hatte mein Freund Damian behauptet, dass Morde in Wendlebury Barrow an der Tagesordnung seien. Um es präziser zu formulieren, er sagte, dort wimmele es von verrückten Männern und Mördern.
„Lästereien und Intrigen sind in kleinen Dörfern wie Wendlebury Barrow weit verbreitet“, erklärte er mir beim Frühstück an einem Tag im Juni und lieferte mir damit nur einen Bruchteil der Gründe, weshalb ich ihn nicht verlassen sollte, um in das Cottage zu ziehen, das ich von meiner Großtante geerbt hatte. „In deinem Bett wird man dich ermorden“, sagte er. „Und niemand wird da sein und deine Schreie hören. Du wirst einsam vor dich hinleben und mich vermissen.“
Er lieferte mir jeden erdenklichen Grund, zu bleiben, außer den, den ich hören wollte.
„Aber durch ihr Vermächtnis eröffnen sich mir Möglichkeiten, die ich nie hätte, wenn ich hierbliebe“, sagte ich, goss uns beiden frischen Kaffee ein und stellte seinen Becher vor ihm ab. „Ich könnte mietfrei in Tante Mays Cottage leben. Ich könnte Bücher schreiben. Das habe ich mir schon immer gewünscht.“
Doch meinem Eifer maß er, wie üblich, keine Bedeutung bei. „Du glaubst ernsthaft, mitsamt dem Haus spränge gleichzeitig der Funke ihres Erfolgs auf dich über? Denkst du, du könntest ihn dir einverleiben, indem du in Mays Bett schläfst? Und deine Bücher verkaufen sich allein deshalb, weil ihr denselben Nachnamen tragt?“
„Das weiß ich nicht, aber ich sollte es zumindest versuchen. Sie hätte es so gewollt.“
„Um zu schreiben, musst du nicht in ein Provinznest ziehen, das kannst du auch hier. Du kannst überall schreiben.“
„Wendlebury Barrow wird mir und meiner Kunst guttun, dort ist es ruhig und friedlich.“
Mein Blick wanderte zum Sofa, auf dem sich schnarchend einer von Damians Schmarotzerfreunden breitgemacht hatte, der ansonsten mit ihm und seiner englischsprachigen Theatergruppe, den Damian Drammaticas, umherreiste.
„Ja, ein bisschen zu friedvoll, wenn du mich fragst, ganz allein mitten im Nirgendwo, in einem verschlafenen, kleinen Nest, wo nichts, aber auch gar nichts passiert.“
„Ich finde, das klingt gut.“
„Eine Träumerin bist du.“ Er warf seine Toastrinde auf den Teller und verteilte Krümel auf dem Tisch.
„Na ja, das bringt das Schreiben eben so mit sich.“
„Mit Schreiben wirst du nie Geld verdienen, niemand tut das. Das ist dir doch hoffentlich klar, oder?“
„Ich verdiene deutlich mehr Geld als du.“ Ich schnappte mir die Toastrinde und nahm einen Bissen. Es ärgerte mich, wenn ich sah, wie er mein Essen verschwendete.
„Ja, als Lehrerin, nicht als Schriftstellerin. Davon abgesehen wirst du auch keine Möglichkeit mehr haben, an den schicken internationalen Schulen zu lehren. Du wirst dann auch nicht mehr jedes Schuljahr von einer europäischen Stadt zur anderen ziehen können. Es wird nicht mal halb so spannend sein, in England zu unterrichten.“
„Ich habe nicht vor, zu unterrichten, ich werde schreiben. Meine Tante May sagt immer – sagte immer –, das Geld liegt in Büchern, und sie sollte es wissen.“
„Wenn du Banknoten als Lesezeichen benutzt, ja. So oder so, das Geld für deinen Lebensunterhalt wirst du dir trotzdem verdienen müssen. In einem kleinen Dorf wie diesem wirst du niemals einen Job finden.“ Er leerte seinen Kaffeebecher und stellte ihn ungewaschen in die Spüle, dann wandte er sich mir lächelnd zu. „Wie wäre es, wenn du das Cottage verkaufst und das Geld behältst? Du könntest es in die Theatergruppe investieren, in einen besseren Van zum Beispiel. Du könntest unsere offizielle Schirmherrin sein.“
Nun war ich froh, dass ich ihn meiner Großtante May nie vorgestellt hatte.
Damian deutete auf sich selbst als letztes Beispiel seiner langen Liste von Einwänden. „Weißt du nicht, was für ein Glück du hast?“
Einen Moment lang betrachtete ich sein beeindruckend wikingerhaftes Aussehen: den kräftigen Körperbau, das dichte blonde Haar und die stechend blauen Augen.
Früher hatte das gereicht, um mein Urteilsvermögen zu trüben, doch das war nun vorbei.
„Doch, ich glaube, das weiß ich“, sagte ich mit ruhiger Stimme, ehe ich meinen Laptop aufklappte und einen Flug von Frankfurt nach London buchte. Ein One-Way-Ticket.
2 Zu Hause ist es am schönsten
Insgeheim befürchtete ich zwar, Damians Bedenken im Hinblick auf Wendlebury Barrow könnten sich bewahrheiten, dennoch konnte ich es kaum erwarten, endlich allein in Tante Mays Cottage zu sein. Auch ohne ihr Erbe war es mehr als Zeit, nach vier Jahren im Ausland wieder nach England zurückzukehren. Wo aber mein Zuhause war, das wusste ich nicht. Ich war fünfundzwanzig und zu meinen Akademikereltern nach Inverness ziehen wollte ich nicht. In Tante Mays Cottage würde ich die Zurückgezogenheit vorfinden, die ich brauchte, um mich zu sammeln und zu mir zu kommen, was immer das auch für mich bedeutete.
Die Ruhe und Beschaulichkeit des Dorflebens mussten einen Teil der Anziehungskraft Wendleburys auf Tante May ausgemacht haben. Ein verlässlicher Anker in ihrem unsteten Leben als Reiseschriftstellerin, an den sie sich immer wieder zurückgezogen hatte, um Energie zu tanken, und wo sie sich schließlich zur Ruhe gesetzt hatte, um den perfekten Schlussakt eines ereignisreichen Lebens einzuleiten.
An jenem Junitag, da ich zur Eingangstür des Cottages hinaufstieg, fühlte ich mich plötzlich zu Hause, mehr, als ich erwartet hatte. Der dezente Duft der aprikosenfarbenen Teerosen, die den Eingang säumten, ließ meine Nase angenehm zucken. Bedächtig schob ich die Tür auf und fragte mich, ob ich das Haus leer vorfinden würde. Ich hatte nicht daran gedacht, meinen Vater, der den Nachlass verwaltete, zu fragen, wie es um die Einrichtung stand.
Zu meiner Erleichterung befand sich das gesamte Mobiliar noch an seinem Platz, und auch der Geruch von Sandelholz und Gewürzen, der von ihren gesammelten Reisemitbringseln ausging, war unverändert.
Trotz der sieben Jahre, die ich das Haus nun nicht mehr betreten hatte – ein furchtbares Gefühl durchfuhr mich, als mir dies bewusst wurde –, war alles so vertraut wie eh und je: das Aquarell nahe der Tür, das ägyptische Boote auf dem Nil zeigte, die feinen chinesischen Teller, die entlang der Stufen hingen, die Perserteppiche in dem kleinen Wohnzimmer im vorderen Teil des Hauses. In meinen jungen Jahren hatte ich es geliebt, das Haus zu durchstreifen, fasziniert von all den fremdländischen Souvenirs und den dazugehörigen Geschichten, die Tante May mir erzählt hatte: kristallklare Teegläser aus Marokko, feine japanische Seidenschals und unheimlich anmutende Holzfiguren aus der Karibik. Ich beneidete sie um ihren leidenschaftlichen Spürsinn, mit dem sie während ihrer Reisen all die Stücke an Marktständen aufgestöbert hatte.
Alles sah aus wie immer, so als lebte sie noch hier.
Durstig, wie ich war, stellte ich nach dem Flug aus Frankfurt meinen Rucksack und die Koffer in der Diele ab und schlurfte in die kleine, urige Wohnküche, die ausgestattet war mit einem Spülbecken aus Stein, einer Holzanrichte und hier und da einigen Regalen. Vor einer der Wände befanden sich zwei Bugholzstühle und ein kleiner Klapptisch. Die Suche nach Tee führte mich in die Speisekammer; ein kühler, dunkler Ort, der zwar so klein war wie eine Gästetoilette, in dem ich aber neben einer Teedose mit Mays Lieblings-Earl-Grey eine weitere ungeöffnete Packung und eine Glasschale mit buntem Kandiszucker fand. In Tante Mays Haus wurde selbst eine Tasse Tee zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Ich hatte längst vergessen, wie sehr ich es geliebt hatte, dabei zuzusehen, wie die winzigen Zuckerkristalle in die Tasse rieselten und sich auflösten, ehe sich Milch aus einem fast durchscheinenden japanischen Kännchen dazugesellte.
Der Anblick des noch verschweißten Teepäckchens war allerdings zu viel für mich; Tante May hatte es gekauft, ohne zu ahnen, dass sie es niemals würde öffnen können. Ich lehnte mich gegen die kühle Kalksteinwand und weinte leise vor mich hin.
Geraume Zeit später fühlte ich mich allmählich besser und fuhr mir über das Gesicht. Dies war nur der erste Moment von vielen, da ich mich überwältigt fühlen würde, doch nicht nur von Trauer, sondern von Reue, weil ich Tante May zu Lebzeiten vernachlässigt hatte. Diese verlorene Zeit würde ich nie wieder zurückholen können.
Ich entschied, dem auf andere Art und Weise entgegenzuwirken: indem ich etwas aus dem Neuanfang machte, den sie mir ermöglicht hatte. Ich würde als Schriftstellerin in ihre Fußstapfen treten. Ihr Schreibtalent würde weiterleben. Und ich würde ihr Phönix sein.
Zurück in der Küche, spülte ich den Teekessel ab, füllte ihn mit frischem Wasser, kochte eine Kanne Earl Grey und machte mich mit einem Tablett, beladen mit Porzellankanne, Tasse und Untertasse, Löffel und Zuckerschüssel, auf den Weg in den Garten hinter dem Haus. Glücklicherweise hatte jemand den Kühlschrank geleert und ausgeschaltet, sodass ich nicht auch noch ihre letzte Flasche Milch geerbt hatte. Für den Augenblick würde ich mich damit zufriedengeben, meinen Tee schwarz zu trinken.
Eine Wolke schob sich vor die Sonne, als ich mich dankbar auf der rustikalen Holzbank ausstreckte, die knackte wie die Gelenke eines alten Mannes. Ich huschte kurz zurück nach drinnen, um mir eine zusätzliche Schicht Kleidung zu holen, und griff nach einem Seidentuch, das an der Garderobe hing, die Tante May von ihrer Mutter geerbt hatte. Außer ihr kannte ich niemanden mit einer derart altmodischen Garderobe. Ich warf mir das Tuch um die Schultern, lehnte mich draußen wieder auf der Bank zurück und schmiedete Pläne, wie ich all das hier zum Laufen bringen würde.
Es gab schrecklich vieles, über das ich nachdenken musste.
Das Nächste, an das ich mich erinnerte, war, dass ich eine knochige Hand auf meiner Schulter spürte und sich gleichzeitig der scharfe Geruch einer frisch geöffneten Flasche Bleiche in meine Nebenhöhlen schlich. Als ich die Augen öffnete, erwartete ich beinahe, dass einer von Damians Mördern mit einer Axt in der Hand sich bedrohlich über mich beugte. Stattdessen ließ sich ein großer, dünner Mann mit weißem Haar und einem Zwirbelbart auf dem Gartenstuhl mir gegenüber nieder. Ich schätzte ihn auf ungefähr achtzig. Seine beige Tweedhose und die orangefarbene Cordweste, die er über einem karierten Hemd trug, verströmten den Geruch von Mottenkugeln. Er war im wahrsten Sinne des Wortes ein Bauernbursche und etwas zu alt, um als Mörder oder Einbrecher durchzugehen. Aber ich konnte mir nicht erklären, warum er mir bekannt vorkam. Von wo war er gekommen? Und was hatte er in meinem Garten zu suchen?