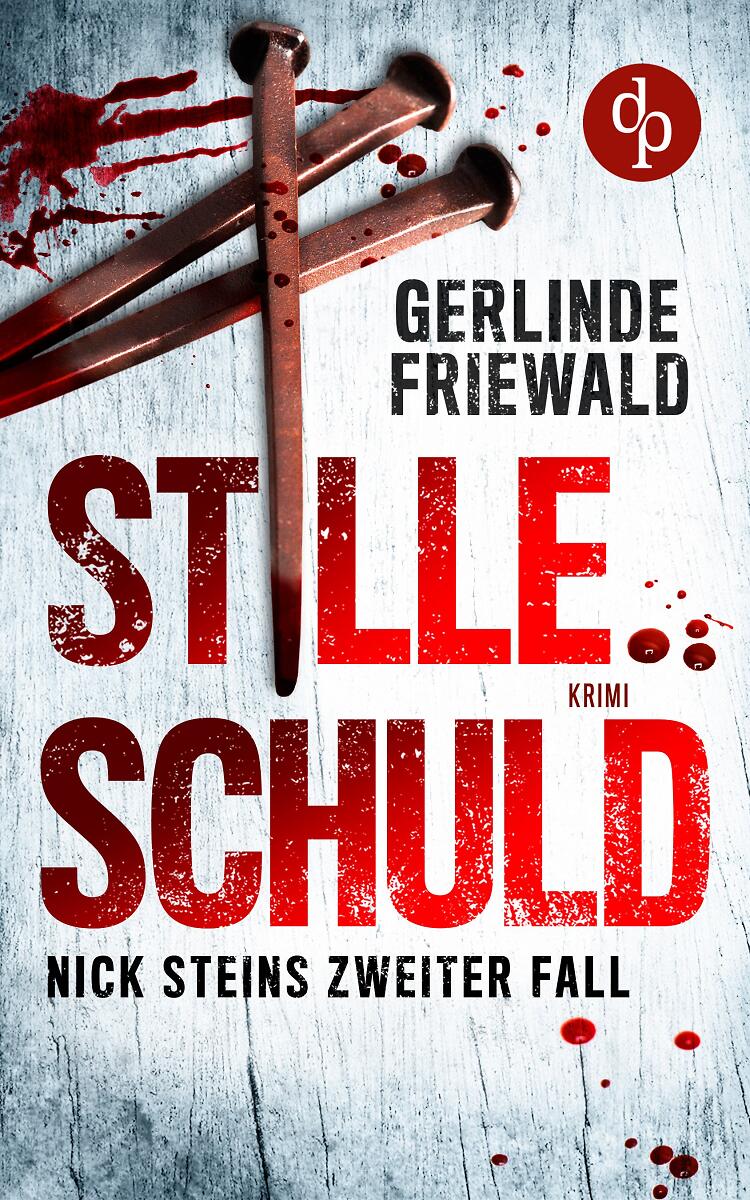1
Langsam erwachte sie aus ihrem ohnmachtsähnlichen Zustand. Es dauerte eine Weile, bis ihr Gehirn alle Schmerzreize empfangen hatte und die Realität in ihr Bewusstsein vordrang. Sie vernahm rhythmisch röchelnde Geräusche. Zu ihrem Erstaunen entstammten diese ihrer eigenen Kehle. Es wird nicht mehr lange dauern, bald ist es zu Ende, dachte sie voller Sehnsucht und wunderte sich beim nächsten qualvollen Atemzug über die Klarheit ihres Wunsches. Wie einfach es geworden war, seine Zielvorstellungen zu definieren. Kein Gedanke drehte sich mehr um Einkaufsbummel, Kaffeetratsch und Luxusgegenstände. Stattdessen hatte sich ein einziges, an sich absurdes Bedürfnis geformt: sterben. Sie erhoffte sich nichts mehr, als zu sterben.
Unter Aufbietung all ihrer Kraft öffnete sie die Augen. Aus ihrer erhöhten Position musste sie den Kopf senken, um die auf dem Boden kniende Gruppe beobachten zu können. Hört auf mit eurem verfluchten Gemurmel! Eigentlich war es mehr eine Art monotoner Singsang, irgendwelche Lieder mit unzähligen Strophen, aber durch die OP-Masken drang nur dieses undefinierbare Murmeln. Würden ihre Speicheldrüsen noch normal funktionieren, sie hätte auf die Köpfe der Knienden gespuckt.
Einen Moment lang trug ihre Fantasie sie fort: Mit einem Ruck löste sich ihr Kreuz aus den Verankerungen und donnerte auf die Gruppe hinab. Der Hauptbalken zerdrückte die Schädel der beiden direkt vor ihr Sitzenden, das Querholz traf die anderen. Sie sah das Blut förmlich spritzen, Gehirnmasse über den Boden rinnen und hörte Knochen knacken.
Ihre Pupillen wanderten zur Seite. Sie hing in der Mitte und hatte den besten Ausblick. Anna zu ihrer Linken zeigte seit Längerem keinerlei Regungen mehr. Sie würde es bald hinter sich gebracht haben. Die Glückliche! Maria, rechts neben ihr, starrte seit einer gefühlten Ewigkeit geradeaus, sie schien nicht einmal mehr zu zwinkern. Hat den Verstand verloren! Na ja, sie war schon immer zu zart besaitet, unser Seelchen. Trotz ihrer Schwäche spürte sie, wie Zorn in ihr aufloderte. Reue war ein undankbarer Begleiter; späte Reue ohnehin unnötig. Wie hatte Maria nur annehmen können, es handelte sich um ein einfaches Gespräch. War sie davon überzeugt gewesen, die Kleine von damals hätte eine Art Stockholm-Syndrom entwickelt? Maria, dieses dumme Weib, muss sich in Sicherheit gewiegt haben. Maria: »Ich möchte mich dafür entschuldigen, was wir euch damals angetan haben!« Die Kleine: »Oh, kein Problem, das ist alles längst vergessen und verziehen.« Maria: »Das freut mich. Und wenn wir schon so gemütlich beieinandersitzen, sag mir doch, was meine Zukunft bringt.« Die Kleine: »Aber gerne, nichts lieber als das.« Was für ein Schwachsinn! So abrupt der Ärger in ihr aufgekeimt war, erlosch er schlagartig. Ihre Augen kreisten weiter zu den Männern. Die drei hingen auf der anderen Seite des Raums, Franz ihr genau vis-à-vis. Die Ironie des Schicksals, überlegte sie. Vor Jahrzehnten hatte er sie durchaus beeindruckt. Für ihre Verhältnisse war sie richtiggehend verliebt in ihn gewesen. Er sieht elendig aus. Was er wohl über mich denkt? Egal. Er war es nicht wert, sich eingehender mit ihm zu beschäftigen, damals nicht und heute ebenso wenig. Maria hatte er ein Kind gemacht. Damit war sie doppelt versorgt. Bestimmt hatte er ihr eine Menge Geld gegeben, damit sie den Mund hielt und seine heile Welt beließ, wie sie war. Was habe ich bekommen? Nichts. Dabei war sie seine Vertraute, seine Geliebte gewesen. Seine Geliebte! Oh ja, verrückt habe ich ihn gemacht. Kein Wunder, so etwas hat er vorher wahrscheinlich noch nie erlebt. Am liebsten hätte sie ob der Erinnerung losgekichert, doch ihre Kehle war trocken und geschwollen, ihre Lippen aufgerissen. Sie war kein Kind von Traurigkeit gewesen und hatte ihm Dinge geboten, die er vorher noch nicht gekannt hatte.
Sie spürte, wie sich ihre Blase ohne ihr Zutun entleerte. Ja, das hat er auch gemocht, der feine Herr Doktor! Der Urin rann über ihre Schenkel, es brannte höllisch. Ein kleiner Schmerz im Gegensatz zu den Qualen, die sie außerdem ertragen musste.
Seine Geliebte, seine Vertraute – und seine Geschäftspartnerin!, nahm sie den Gedanken wieder auf. Gemeinsam hatten sie viel Geld verdient. Natürlich waren die anderen auch nicht schlecht ausgestiegen, aber ihnen hatte der Löwenanteil zugestanden, immerhin war es ihre Idee gewesen. Meine und die vom Herrn Doktor. Keiner durfte sich beschweren, denn alle waren sie damit reich geworden und hatten ein Leben im Luxus geführt.
Der Singsang zu ihren Füßen verstummte, in die Runde der Knienden kam Bewegung. Wasser, gebt mir doch bitte etwas Wasser! Zuerst in diesem Keller und später in dem Zimmer hier im Haus hatte sie gedacht, es könnte nicht mehr schlimmer kommen. Welch ein Irrtum! Dort waren sie wenigstens einmal täglich von den Handschellen befreit worden, hatten den Kübel benutzen dürfen, Wasser und Brot bekommen. Nicht, dass sie es gestört hätte, zu pinkeln, wenn ihr danach war, auch angekettet, an ihrem Platz. Aber das Fehlen von Wasser und Nahrung brachte sie zeitweise schier um den Verstand.
Ein heiserer Ton drang über ihre Lippen. Sie vermochte nicht einmal mehr zu krächzen, normal sprechen konnte sie schon länger nicht mehr. Obwohl sie nicht wusste, worum es sich handelte, spürte sie deutlich, wie ihr Körper etwas ausschüttete. Anspannung und Angst krochen in ihr hoch. Ihre schlaffen Muskeln spannten sich so gut es ging an. Welche Schmerzen erwarten mich? Was werden sie heute tun?
Doch die Knienden taten nichts. Sie standen auf, hielten sich kurz an den Händen und verließen schweigsam nacheinander den Raum.
Sie kamen nicht wieder.
2
Mit einem Ruck zog Nick die Schiebetür auf und trat hinaus auf den Balkon seiner Suite. Wärme schlug ihm entgegen. Er setzte sich. Auf dem Tisch lagen seine Zigaretten. Für einen Moment konnte er sich beherrschen, doch dann zog er das Päckchen zu sich heran und fischte sich einen Glimmstängel heraus. Das Feuerzeug flammte auf und er machte einen tiefen Zug.
Sein Zimmer lag in nördlicher Richtung, sodass er in den Genuss des Anblicks der Skyline von Dubai kam. Wenn man das fantastische Burj al Arab, greifbar nahe auf der linken Seite, und den kleinen Jachthafen vor ihm dazurechnete, war das Panorama unbezahlbar. Er lehnte sich zurück. Erstaunlicherweise fühlte er sich wohl. Eigentlich sollte Luisa neben ihm sitzen. Gemeinsam hatten sie diesen Urlaub geplant. Für ihn sollte es eine kurze Unterbrechung seines nervenaufreibenden Jobs sein. Für sie: Er wusste es nicht. Wollte sie die vermeintlich verlorenen Gefühle zurückholen? »Nutzen wir die Zeit, um über unsere Zweisamkeit zu reflektieren. Du hast dich von mir entfernt. Ich spüre es«, waren ihre Worte gewesen. Was für ein Quatsch!, dachte er. Er musste über gar nichts nachdenken, seine Gefühle waren ungebrochen. Warum müssen Frauen immer etwas sehen, was es nicht gibt?
Man hätte meinen können, der durchaus schwierige Anfang ihrer Beziehung, bedingt durch einen Unfall im Zuge einer Ermittlung, wäre die eigentliche Hürde gewesen. Diese Zeit hatten sie jedoch ohne Probleme überstanden. Luisa war seine Rekonvaleszenzphase hindurch uneingeschränkt verständnisvoll gewesen und hatte sein langsames Vorantasten in die Normalität und den Wiedereinstieg in seinen Beruf, ohne mit der Wimper zu zucken, begleitet. Erst als er wieder der Alte war, hatten die Schwierigkeiten begonnen.
Der Alte, überlegte er. Bin ich in Wahrheit unfähig, eine Beziehung zu führen? Habe ich es verlernt, auf eine zweite Person Rücksicht zu nehmen? Verlernt? Ich habe es nie gelernt!
Kurz schloss er die Augen und meinte, Luisas Haar auf seiner Wange zu spüren, dieses leise Kitzeln, wenn sie sich über ihn gebeugt und geküsst hatte. Sogar der Geruch ihres Parfums war noch fest in seinen Gedanken verankert.
Nun lag in seinem Bett eine junge Schweizerin, die er vor nicht einmal fünf Stunden zusammen mit ihrer Mutter und Großmutter kennengelernt hatte. Der Shuttleservice zwischen den Hotels hatte ihn und das lustige Dreiergespann aus Luzern in einem Golfwagen zusammengebracht. Gemeinsam hatten sie den Souk des Nachbarhotels besucht, hervorragende Steaks gespeist und waren alsdann bei einer Flasche Champagner gelandet. Mutter und Großmutter hatten sich schließlich nacheinander verabschiedet, zuerst die Großmutter, eine halbe Stunde später die Mutter. Der Rest war genau genommen Zufall gewesen. Seine Suite und das Zimmer des Trios lagen auf derselben Seite im selben Stockwerk des Hotels. Dieser Umstand und der Alkohol hatten ausgereicht, um zu zweit in seinen Räumlichkeiten zu landen.
Nach einem weiteren tiefen Zug drückte er die Zigarette aus und erhob sich. Er gähnte und machte einen Schritt nach vorn zum Glasgeländer. In diesem Augenblick ertönte aus dem Zimmer Falcos »Amadeus«. Er fuhr zusammen und jäh schoss eine kleine Portion Adrenalin durch seinen Körper. Seit er ins Flugzeug gestiegen war, hatte er den Klingelton seines Handys nicht mehr gehört. Es gab nur zwei Möglichkeiten: das Bundeskriminalamt oder Luisa. Mit weiten Schritten lief er zurück ins Zimmer zu dem runden Esstisch, auf dem sein Telefon lag. Ein Blick auf das Display genügte. Er nahm das Handy von der Glasplatte und drückte auf den Annahme-Button. »Sam!«
»Oh Fuck! Endlich erreiche ich dich! Ich versuche es seit einer Stunde. Hast du dich schon wieder irgendwo mit einer Frau herumgewälzt?« Sie holte geräuschvoll Luft, offenbar, um zum zweiten Teil ihrer Schimpftirade anzusetzen.
Er ergriff die Chance und unterbrach sie. »Hier graut bald der Morgen und bei dir in Wien ist es mitten in der Nacht. Was willst du?« Wortwechsel dieser Art standen bei den beiden auf der Tagesordnung. Seit vielen Jahren fungierte Samantha Smith als seine Assistentin und Vertraute, seinen privaten Bereich eingeschlossen. Manchmal schien es, als erfüllten die Verbalfehden einen geheimnisvollen therapeutischen Zweck, sowohl bei ihm als auch bei Samantha.
»Pack deine Koffer. Du fliegst mit der ersten Maschine nach Hause. Es gibt Arbeit für den Profiler Number one. Home sweet home, Babe.«
»Was ist passiert?« Automatisch wechselte er die Stimmlage. Auf einmal klang er sachlich und eindringlich, selbst seine Körperhaltung veränderte sich. Er streckte die Wirbelsäule durch und stand kerzengerade. Aufmerksam folgte er ihrem Bericht.
Auch mit ihr war eine Wandlung vonstattengegangen. Sie erzählte knapp, strukturiert und ohne einen Anflug ihrer sonst so berühmt-berüchtigten Ironie. Allein ihr britischer Akzent trat stärker hervor als sonst, da sie sich auf den Inhalt und nicht auf die Aussprache konzentrierte.
Sogleich heftete sich die Quintessenz ihrer Informationen in seinem Kopf an die erste Stelle: Leichenfund. Er räusperte sich und fragte dazwischen: »Ist die Identität des Opfers bekannt?«
»Nicht ein Opfer, Nick, sechs Opfer! So etwas hast selbst du noch nicht gesehen. It is horrible.«
Er spürte ihr blankes Entsetzen; ein unüblicher Zustand für die toughe Sam.
Unzufrieden blickte Nick an sich hinab. Er hatte nie verstanden, wie Menschen es schafften, nach einem mehrstündigen Flug frisch auszusehen. Seine Jeans hatten einen Kaffeefleck, das kurzärmelige Hemd und das Sakko stritten sich darum, wer zerknitterter aussah, und seine Haare standen im wahrsten Sinne des Wortes zu Berge. Er hasste diesen Zustand.
Während er zügig an den Gepäckbändern vorbeimarschierte, versuchte er, zumindest seine Frisur mit den Fingern wieder instand zu setzen. Bis zum Ankunftsbereich für Fluggäste hatte er es halbwegs geschafft. Hinter der Absperrung erblickte er in der Menge der Wartenden seinen Mitarbeiter Peter Westernschmidt, der bereits eifrig winkte. Obwohl der Mann noch nicht lang in seinem Dienst stand, war er für ihn zum männlichen Pendant von Samantha geworden, jedenfalls im beruflichen Bereich. Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden lag darin, dass Samantha hauptsächlich vom Schreibtisch aus agierte und Peter ihn bei seinen Außeneinsätzen begleitete.
Peter ergriff Nicks ausgestreckte Hand und drückte sie. »Ich bin ja so froh, dass du da bist.« Er sah sich um. »Wo ist dein Koffer?«
»Ich will so rasch wie möglich zum Tatort. Mein Gepäck wird aufgehoben. Irgendeinen Vorteil muss mein Beruf doch haben, oder?« Nick lachte trocken.
Peter stimmte ein, wurde aber sogleich wieder ernst. »Ich hoffe, du hast nichts gegessen im Flugzeug. Was dich erwartet, ist …« Er suchte nach dem richtigen Wort. Schließlich gab er es auf. »Du weißt, ich bin nicht zimperlich, aber ich musste einige Male an die frische Luft laufen, weil es mir gehörig den Magen umgedreht hat.«
Geflissentlich ignorierte Nick Peters Fingerzeig und fragte: »Habt ihr auch alles so belassen, wie ihr es vorgefunden habt?«
»Selbstverständlich. Genau deinen Anweisungen entsprechend, die einer bestimmten Person übrigens ganz und gar nicht gefallen haben.«
Nick seufzte. »Mein alter Freund Robert Hofer?«
Peter nickte. »Er meinte, die Dokumentation würde für dich völlig ausreichen.«
»So und nicht anders ist es üblich. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder dahergelaufene Polizist bestimmen könnte, wie lange ein Tatort aufrechterhalten bleibt«, äffte Nick den Rechtsmediziner Doktor Robert Hofer nach.
Peter wiegte den Kopf. »Die Wortwahl hast du nicht ganz getroffen, aber die Aussage dahinter deckt sich zu hundert Prozent.«
»Wenn er nicht der beste Rechtsmediziner weit und breit wäre, würde ich ihn von meinen Tatorten vertreiben, das schwöre ich.«
»Das könntest du überhaupt nicht, jetzt, wo er quasi zur Familie gehört.«
»Erinnere mich bloß nicht daran!«
Peter zwinkerte. »Du bist schuld.«
»Nur weil er mir einmal das Leben gerettet hat, hätte sich Samantha nicht gleich Hals über Kopf in ihn verlieben müssen.« Demonstrativ schüttelte sich Nick. »Wo steht dein Wagen?«, wechselte er das Thema, als sie den Fahrstuhl erreichten.
»Im dreier.«
Sie betraten den Lift. Die Fahrt legten sie schweigend zurück. Im dritten Parkdeck angekommen, zeigte Peter auf sein silberfarbenes, bereits in die Jahre gekommenes dreier BMW-Cabrio. »Hier, beinahe Poleposition.« Er fischte den Autoschlüssel aus seiner Hosentasche und drückte auf die Fernsteuerung.
Nick öffnete die Beifahrertür und ließ sich mit einem Ächzen auf den Sitz fallen. »Ich bin die ganze Nacht nicht zum Schlafen gekommen und im Flugzeug habe ich auch kein Auge zugetan. Stört es dich, wenn wir das Radio ausgeschaltet lassen?«
Peter bedachte ihn mit einem vielsagenden Blick, dann nickte er. »Nicht nur das. Ich werde auch die ganze Fahrtzeit über den Mund halten. Bis nach Baden brauchen wir eine dreiviertel Stunde. Oder möchtest du einen Zwischenstopp bei dir zu Hause einlegen?« Prüfend wanderten Peters Augen über seinen Körper.
»Sehe ich so schlimm aus?«
»Als nobler Mensch möchte ich mich der Worte meiner seligen Großmutter bedienen: Du wirkst ein wenig derangiert.«
Nick lehnte den Kopf gegen die Kopfstütze und schloss die Augen. Eine Antwort blieb er schuldig. Während Peter auf die Autobahn zusteuerte, führten ihn seine Gedanken zurück nach Dubai. Eilig hatte er seinen Koffer gepackt, ausgiebig geduscht und bis zur Abfahrt die Informationen am iPad studiert, die ihm Samantha zugesandt hatte. Die Schweizerin war trotz aller Geräusche nicht aufgewacht. Bevor er ging, hatte er noch einmal nach ihr gesehen. Sie lag ausgestreckt auf dem Bett, hatte kurz aufgeseufzt und selig weitergeschlafen. Ihm war es recht gewesen. Er hatte ihr eine Nachricht hinterlassen, die wahrscheinlich mehr Fragen aufwarf, als sie beantwortete. Hätte ich sie wecken sollen und ihr die Situation erklären?, ging es ihm durch den Kopf. Bin ich wirklich so ein Arsch? Luisa zumindest ist dieser Ansicht, davon war er überzeugt. »Du bist ein Charly«, hatte sie ihm während eines Streits entgegengeschleudert. Als ob ich herumhuren, bis zur Besinnungslosigkeit trinken und zocken würde. Ich habe sie kein einziges Mal betrogen, kein einziges, verdammtes Mal!
Peters Stimme durchbrach seine Träume. »Wir sind da.«
Nick ruckte hoch und fuhr sich mit den flachen Händen über das Gesicht. Dann warf er einen ersten Blick auf den Tatort. Es handelte sich um eine imposante, zweistöckige Villa, wie man sie vor hundert und mehr Jahren zuhauf in den besseren Gegenden rund um Wien gebaut hatte. Er selbst war in einem solchen Kasten aufgewachsen. Im Gegensatz zu seinem Elternhaus zeigte dieses Anwesen drastische Spuren des Verfalls. »Gehen wir.« Er öffnete die Autotür und stieg mit einem neuerlichen Ächzen aus dem Wagen. Der Sex mit der Schweizerin und der mehrstündige Flug hatten seiner Wirbelsäule nicht gutgetan.
Sie gingen einen ungepflegten Kiesweg entlang, der durch den verwilderten Vorgarten bis zur Eingangstür führte. Am Rand wucherten Buchsbäume. Die Fassade des Gebäudes war in einem blassen Gelbton gestrichen und blätterte an vielen Stellen ab. Darunter trat das feuchte Mauerwerk in schmutzigem Grau hervor. Neben der Tür zeugten kleine kreisförmige Verfärbungen auf der Mauer von Efeuranken, die entfernt worden waren. Sämtliche Fenster waren geschlossen, auch sie hätten einen neuen Anstrich nötig gehabt.
Es war seltsam still. Allein die Männer in ihren weißen Überzügen, die den Garten durchstreiften, die Polizei-Absperrbänder und einige Uniformierte störten die vermeintliche Dornröschenschloss-Idylle.
»Ist ein Polizist anwesend, der bei der Entdeckung dabei war?«, fragte Nick.
»Wie du es gewünscht hast.« Peter hob die Hand.
Ein Mann reagierte. Er löste sich von seinem Platz und kam auf die beiden zu.
»Er?«
Ein schalkhafter Ausdruck huschte über Peters Gesicht. »Hast du Vorurteile?«
»Nein, natürlich nicht. Das solltest du am besten wissen. Aber musste es ausgerechnet so einer sein?«, zischte Nick.
»Wenn dich ein Homosexueller nicht stört, sollte es ein Kampfroboter ebenso wenig.«
Inzwischen war die hünenhafte Bodybuildergestalt mit dem zwei Millimeter Haarschnitt näher gekommen. Der Kies knirschte unter seinen festen Schritten und als er vor ihnen zum Stehen kam, streckte er seinen Arm wie eine wütende Schlange nach vorne.
Zögerlich ergriff Nick die Hand des Beamten. »Nick Stein.«
Der Mann straffte seine Schultern und schaffte es dabei, den Kopf weit zu senken, ohne es unbequem wirken zu lassen. Adern und Sehnen am Hals traten hervor, unter seiner Jacke hoben sich die Trapezmuskeln. »Arno Hammer. Ich freue mich aufrichtig, Sie kennenzulernen, Herr Doktor Stein. Es ist mir eine große Ehre.«
Nick stoppte den Mann, indem er sofort zur Sache kam. »Sie haben den Tatort entdeckt?«
»Ja, gemeinsam mit meinem Team.«
Wider Willen gefiel Nick die Antwort. Er wusste selbst nicht, warum er diesem Typ generell skeptisch gegenüberstand. Weil ich genauso voreingenommen bin wie jeder andere auch. Menschen haben nun einmal Vorurteile, gab er sich in Gedanken die Antwort. »Erzählen Sie«, sagte er und bemühte sich um ein Lächeln.
Arno Hammer reagierte ohne Umschweife. »Seit einiger Zeit verfolgen wir eine Verbrecherbande, die in der Gegend Einbrüche in private Gebäude verübt. Sie haben sich genau auf diese Art von Villa spezialisiert: alt, ungesichert, mit großem Garten und somit viel Abstand zum nächsten Haus. Die betreffenden Objekte werden so lange beobachtet, bis sich eine gute Gelegenheit bietet, zuzuschlagen.« Mit seinem Kinn deutete er auf das Haus. »Genau so haben sie es auch hier gemacht. Allerdings mit dem feinen Unterschied, dass sie selbst beobachtet wurden, nämlich von uns. Wir wollten sie auf frischer Tat ertappen, mit dem Diebesgut in der Hand, und staunten nicht schlecht, als die Verbrecher schon wieder davonrannten, kaum dass sie in das Haus eingestiegen waren; ohne Beute, dafür voller Panik. In ihrem Schock waren sie richtiggehend froh, uns zu sehen und haben sich ohne Widerstand festnehmen lassen.« Er stockte. »Ich bin als Erster in das Haus gegangen und habe den Raum betreten, in dem … in dem …« Bei der Erinnerung an das Gesehene verzog er das Gesicht.
Nick kam ihm zu Hilfe. »Was sagen die Einbrecher zu dem Ganzen?«
»Die Verhöre laufen, aber die Männer haben nichts damit zu tun.« Arno Hammer zeigte wieder in Richtung der Villa. »Wie gesagt, wir sind ihnen seit Monaten auf den Fersen. Die Bande verfügt über ein geniales System. Ihnen steht eine ganze Reihe vornehmlich Jugendlicher und Arbeitsloser zur Verfügung, die nichts anderes tun, als die möglichen Häuser zu observieren. Wir vermuten, dass sie immer mehrere Villen auf ihrer Liste stehen haben.«
»Haben sie sich auf bestimmte Güter spezialisiert?«, fragte Nick einerseits, um den Redefluss des Mannes zu erhalten, und andererseits, um sich selbst Nachdenkzeit zu verschaffen.
»Nein. Sie nehmen alles mit, was sie verhökern können: vom kaputten Handy in der Lade bis zur alten Nähmaschine, vom Silberbesteck bis zum Diamantring.«
Nick ließ die Worte sacken. »Moment, noch einmal zurück!« Er hob die Hand. »Sie sind ihnen seit Monaten auf der Spur und beobachten sie?«
Arno Hammer nickte.
»Das heißt, Sie haben das Haus ebenfalls die ganze Zeit über beobachtet?« Gespannt fixierte er den Mann. Kann es wahr sein, dass ein Polizeitrupp wochenlang vor der Villa gehockt und nichts bemerkt hat?
Entschieden schüttelte der Beamte den Kopf. »Nein. Wir kannten die Identität zweier Einbrecher. Kundschafter und Ziele waren uns nicht geläufig.«
»Schade«, erwiderte Nick knapp, ein Teil in ihm atmete jedoch auf, aus einem ganz bestimmten Grund: Schlagzeilen à la »Polizei beobachtet seelenruhig Haus, während dort Menschen gefoltert werden« oder »Dein Freund und Helfer ist blind« hätten, wieder einmal, ein schlechtes Image für die Polizei mit sich gebracht und eine Ermittlung empfindlich stören können. Letzteres war stets seine Hauptsorge.
»Wieso schade?«, fragte Arno Hammer.
»Zumindest diese Beobachter hätten uns wichtige Hinweise liefern können«, entgegnete Nick und offenbarte damit die Kehrseite der Medaille.
»Aber … die haben wir ja!« Der Beamte machte große Augen und erklärte: »Wir wissen noch nicht alles über den Ablauf, zum Beispiel nicht, wie der Kontakt zwischen der Bande und den Spähern während der Beobachtungsphase passierte; wahrscheinlich mittels Prepaid-Handys. Aber klar ist, dass die Einbrecher erst auf den Plan traten, wenn die Kundschafter grünes Licht gaben. Dann schlugen sie jedoch nicht sofort zu, sondern überzeugten sich erst einmal selbst vom Istzustand. Kurz belauerten sie gemeinsam das betreffende Objekt. – Beobachtest du den einen, findest du automatisch den anderen«, setzte er nach.
»Sie haben das Haus also doch observiert? Wenigstens eine Zeit lang?«
Er verzog den Mund. »Ich weiß, worauf Sie hinauswollen, Herr Doktor Stein. Fakt ist, wir haben nicht das Haus beobachtet, sondern die Täter.« Er sprach ruhig und bestimmt, ohne einen Anflug von Unsicherheit.
»Wie lange haben Sie die Einbrecher und diese Kundschafter beobachtet?«, variierte Nick seine Frage. Das Auftreten des Mannes gefiel ihm. Seine Antipathie schwand.
»Vier Tage. Niemand ging in das Haus, niemand kam heraus. Es wirkte verlassen. Wie hätten wir –«
Nick hob die Hand und unterbrach den nun doch aufkeimenden Rechtfertigungsversuch. Er verstand das Vorhaben Arno Hammers, sich zu verteidigen, erachtete die Ausführung jedoch als unnötig. Die Beamten hatten korrekt gehandelt und nichts falsch gemacht. »Ich mache Ihnen keinen Vorwurf.« Seine Worte unterstrich er mit einer offenen Geste. »Jetzt sehe ich mir erst einmal den Tatort an. Dann reden wir weiter. Sie können gern hier im Freien bleiben, Herr Hammer, ich brauche Sie nicht dabei.«
Arno Hammer widersprach nicht und Nick meinte, Erleichterung in den Augen des Mannes zu erblicken. Er wandte sich an Peter. »Na dann, los.«
Sie setzten sich in Bewegung und marschierten auf den Eingang zu. Peter öffnete die Tür und ließ ihm den Vortritt.
Bereits im Flur schlug Nick der unverkennbare Gestank des Todes entgegen. Erstaunlicherweise halfen die zusätzlich vorhandenen Gerüche nach Schimmel und Feuchtigkeit dabei, ihn eine Spur erträglicher zu machen. Er schloss den Mund und atmete so flach wie möglich durch die Nase. Nach und nach legte sich der Würgereiz. Es dauerte immer eine Weile, bis sich der Körper daran gewöhnt hatte.
Nick sah sich um. Der Boden des Vorraums bestand aus mausgrauem Stein, der seit langem, vielleicht seit dem Bau des Hauses, hier lag, so abgetreten wie er war. Auf der linken Wand waren einige schmiedeeiserne Haken angebracht, darunter eine Schuhablage, ebenfalls aus Schmiedeeisen. Ein massiver Eichenkasten und ein mannshoher Spiegel mit einem verschnörkelten Rahmen vervollständigten die Garderobe. An den Haken hingen eine dunkelbraune Weste auf einem Kleiderbügel, eine Lodenjacke und ein schwarzer Umhang. Im Eck stand eine etwa eineinhalb Meter hohe Bodenvase mit getrocknetem Schilfgras. Die Vase wirkte alt und wertvoll.
Peter zeigte auf eine Tür. »Da. Im Salon.«
Sie gingen weiter. Vor der hohen, weißen Doppeltür verharrte Nick kurz, dann drückte er die Klinke hinunter und öffnete den rechten Flügel mit einem Ruck. Er hatte Fotos gesehen, doch die Realität traf ihn wie der Hieb mit einem Holzstock. Instinktiv machte er einen Schritt zurück. Er wartete, bis er sich gefasst und innerlich distanziert hatte. Dann erst passierte er die Schwelle und ließ die Einzelheiten der Szenerie in sein Gehirn vordringen.
Das Zimmer maß seiner Schätzung nach mindestens fünfzig Quadratmeter und war gut dreieinhalb Meter hoch. Es wirkte riesig. Die Vorhänge der beiden Fenster an der gegenüberliegenden Wand waren zugezogen. Durch den dunkelgrünen, verblichenen Stoff, der offenbar viele Jahre der Sonne hatte standhalten müssen, drang ausreichend Licht, um alles sehen zu können. Zum Glück war niemand auf die Idee gekommen, die Vorhänge zur Seite zu schieben. Er wünschte keine veränderten Tatorte, sofern es nicht zwingend notwendig war, einzugreifen.
Sämtliche Möbel des Raums standen zusammengepfercht zwischen den Fenstern und seitlich davon: ein Holztisch mit kunstvoll gedrechselten Beinen, dazu passende Sessel, drei samtene Fauteuils und ein Sekretär. Auf dem Boden waren einige Bücher übereinandergestapelt, daneben stand eine Stehlampe mit Fransen am unteren Ende des Schirms und davor lag ein aufgerollter Teppich.
Sein Blick glitt weiter. Vor den Wänden zu seiner Linken und seiner Rechten waren je drei dicke, vierkantige Holzpfosten mit massiven Winkeleisen auf dem Fischgrätparkett montiert. Das Parkett rund um diese Stellen war fleckig verfärbt. Er löste seine Augen von den Flecken und folgte dem Verlauf der Pfosten in Richtung der Decke, bis er bei den Querbalken im oberen Drittel angelangt war. Jäh flammten in seinem Kopf jene Fotos auf, die während der Erstbegehung gemachten worden waren und die ihm Samantha nach Dubai geschickt hatte. Die Leichen waren natürlich mittlerweile bereits abgenommen worden, doch er sah sie förmlich vor sich: sechs gekreuzigte Menschen, abgemagert, geschunden, tot. Er schloss die Augen und visualisierte die Details: Aus den übereinandergelegten Füßen ragten dicke Nägel. Das getrocknete Blut rund um die Wunden sah schwarz aus. Die im neunzig Grad Winkel an den Querbalken aufgespannten Arme waren an den Handgelenken durch lederne Schlaufen fixiert. Zusätzlich hatte man die Arme fest mit Seilen umwickelt, die sich tief in das schlaffe Fleisch gruben. Während Kopf und Rumpf bis auf die ersten Anzeichen des Verfalls den Umständen entsprechend beinahe normal schienen, waren die Gliedmaßen verfärbt, vor allem die Waden hatten ein dunkles Violett angenommen.
Nick hob wieder die Lider und zog die Stirn kraus. Ein weiteres Bild schob sich in seine Gedanken. Der Vergleich hatte kommen müssen, auch wenn es ihm nicht gefiel.
»Erinnert es dich auch an die Kreuzigung Christi?« Peters Stimme klang brüchig. Er hatte den Nagel auf den Kopf getroffen.
»Genau das versuche ich gerade zu verdrängen. Ich bin katholisch erzogen und hatte viele Jahre lang Religionsunterricht. Wenn ich das sehe, kann ich offensichtlich an gar nichts anderes denken.« Unzufrieden schüttelte Nick den Kopf. »Es wäre falsch, wenn wir jetzt schon die Idee zuließen, dieser Fall hätte etwas mit Religion zu tun. Viele Varianten sind möglich.«
»Du meinst, dass das hier nicht zwangsläufig das Werk eines geisteskranken, völlig verrückten Katholiken gewesen ist?« Peter wirkte skeptisch, die Ironie in seiner Stimme war unverkennbar.
»Ganz genau. Es fängt schon beim Katholiken an! Überleg mal, wie viele Religionen dir auf Anhieb einfallen, die das Kreuz und Jesus impliziert haben.« Nick bedeutete Peter näher zu kommen. »Im Übrigen, geisteskrank ja, aber verrückt mit Sicherheit nicht. Sieh dich um. Das alles hier bedarf einer ausgereiften Planung und guten Organisation. Die riesigen Pfosten für die Kreuze und viele andere Dinge müssen hierhertransportiert worden sein. Es braucht Handwerkskenntnisse, um die schweren Kreuze zu befestigen. Sowohl die Winkeleisen als auch die Abstandhalter, mit denen die Kreuze an der Wand fixiert wurden, sehen für mich fachgerecht montiert aus. Und dann die Logistik während der Gefangenschaft …« Er stockte. »Zeig mir jetzt die Kammern, Peter.«
»Hier entlang.«
Sie verließen den Raum und Nick zog die Tür hinter sich zu. Schweigend stiegen sie die Treppe in den ersten Stock hinauf.
Peter zeigte auf zwei nebeneinanderliegende Türen, die mit Vorhängeschlössern und Schieberiegeln versehen waren. »Hier drinnen waren sie untergebracht, je drei Personen.« Er öffnete eine der beiden Türen und trat zur Seite.
Nick blieb im Türrahmen stehen und blickte in das verschmutzte Zimmer. Das Fenster war mit Brettern vernagelt, in einer Ecke lag ein Haufen eingetrockneter Fäkalien. An der Wand waren drei Metallringe montiert, daran hingen Handschellen.
»Wie lange diese armen Menschen hier wohl dahinsiechen mussten?«, murmelte Peter. Ihn schien dieser kahle Raum noch mehr zu bedrücken als das Zimmer im Erdgeschoss. Mit einem Schulterzucken erklärte er: »Dort unten sind sie gestorben, aber in diesem Loch waren sie wer weiß wie lange gefangen.«
»Sie haben ja keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Denken Sie, gekreuzigt zu werden, sei ein Honiglecken? Es kann mehrere Tage dauern, bis man stirbt!« Die Stimme des Rechtsmediziners wehte wie eine eisige Windböe von der Treppe zu ihnen herüber.
Mit einer schnellen Bewegung schaffte Nick es gerade noch, Peter zu stoppen, der durch die Nase schnaubte und zu einer sicherlich feindseligen Antwort ansetzte. Doktor Robert Hofer war nicht nur ein unsympathischer, sondern auch ein gleichermaßen eingebildeter Mann. Bei Personen, die er nicht zu Seinesgleichen zählte – und dazu gehörte Peter –, war er darüber hinaus herablassend und gnadenlos snobistisch.
Sein typisch süffisantes Grinsen im Gesicht musterte der Rechtsmediziner Nick. Nichts an seinem Verhalten ließ darauf schließen, ob er den kritischen Moment mitbekommen hatte. »So wie du aussiehst, bist du vom Flughafen direkt hierhergefahren. Dermaßen zerfleddert habe ich dich noch nie gesehen. Nun, wenigstens bist du braun geworden; hervorragend für die Haut, sich wie ein Hähnchen braten zu lassen.« Er vollführte eine finale Handbewegung und bedeutete damit, dass das Thema Urlaub für ihn abgehakt war.
Nick war es nur recht. Weder Situation noch Person passten, um über seinen Dubai-Aufenthalt zu plaudern. »Was kannst du mir sagen?«, fragte er den Rechtsmediziner.
Robert Hofer fuhr sich über das glatt rasierte Kinn. »Als die Opfer gefunden wurden, hingen sie bereits seit einigen Tagen tot an den Kreuzen. Wie sie starben, muss ich wohl nicht extra erörtern. Was letzten Endes die genaue Todesursache war, kann ich dir erst sagen, wenn ich sie mir genau angesehen habe; ich möchte es aber als Geschenk bezeichnen. Auch das Drumherum muss zunächst weggeschafft und untersucht werden.« Mit verkniffenen Lippen setzte er nach: »Man könnte längst daran arbeiten, wenn dir Videoaufnahmen und Fotos gereicht hätten.«
Der Seitenhieb hatte kommen müssen. Nick unterließ es, darauf zu antworten und verzichtete auf die Frage, ob der Rechtsmediziner irgendetwas vermutete. Ohnehin hätte er nur eine Abfuhr erhalten. Doktor Robert Hofer hielt nichts von Gedankenaustausch. Hypothesen waren »Schall und Rauch«, wie der Arzt es nannte. Er setzte auf hieb- und stichfeste Ergebnisse.
»Die Opfer sahen extrem ausgezehrt aus. Als hätte man sie verhungern lassen?« Peter hatte sich wieder gefangen und stellte seine Frage in ruhigem Ton.
Zum Glück fand sie bei dem Rechtsmediziner Anklang. »Alle sechs Körper weisen eine gravierende – ich betone: gravierende – Unterernährung auf. Da muss ich nicht einmal reinschneiden, um das zu wissen.« Der letzte Satz galt Nick.
»Man kann nur hoffen, dass ihre Leiden am Kreuz dadurch verkürzt wurden«, antwortete Nick. Auf die Reinschneide-Bemerkung ging er nicht weiter ein. Bei dem Rechtsmediziner war es klug, manches zu überhören.
Robert Hofer hob seinen Zeigefinger. »Davon darfst du nicht ausgehen. Wenn Herz, Lunge und die anderen Organe gesund gewesen sind und sie ausreichend Flüssigkeit erhalten haben, konnte sich das Sterben hinziehen.«
»Durch das Festbinden der Arme waren sie stabilisiert«, gab Peter zu bedenken.
»Ganz genau. So hat man Müdigkeitserschlaffungen verhindert. Das Atmen war zwar sicherlich mühsam, wurde aber nicht unterbunden.« Der Rechtsmediziner grinste. »Unterbunden im wahrsten Sinn des Wortes.« Triumphierend blickte er in die Runde, als erwartete er Beifall für seinen makabren Wortwitz.
Peter wandte sich mit zusammengekniffenen Augen ab und schnaubte verhalten. Nick schenkte ihm einen bedeutungsvollen Blick und schüttelte kaum merklich den Kopf. »Müdigkeit ist mein Stichwort. Ich sehe mir jetzt die restlichen Räume an, gehe alles noch ein zweites Mal ab, dann brauche ich ein paar Stunden Schlaf. Peter, du kannst draußen warten.«
3
Nick zählte nicht zu den Menschen, die lange an einem Jetlag laborierten. Mit einer Zwischenstation am Flughafen, um sein Gepäck abzuholen, hatte Peter ihn nach Hause gebracht und war als Dankeschön mit einer Liste voller Aufgaben betraut worden. Nachdem Nick seinen Koffer ausgepackt und sämtliche Kleidung daraus für seine Haushälterin in den Wäschebehälter gesteckt hatte, war er ins Bad gegangen und hatte sich eine ausgiebige Dusche gegönnt. Anschließend war er sofort, nackt und noch feucht, zu Bett gegangen.
Jetzt fühlte er sich ausgeruht, hatte Hunger und einen unglaublichen Gusto auf eine heiße Tasse Kaffee. Die verkniff er sich allerdings zu Hause und machte sich auf den Weg ins Büro.
Trotz der frühen Stunde herrschte reges Treiben im Bundeskriminalamt. Samantha saß bereits an ihrem Schreibtisch und drehte sich mit grimmiger Miene um, als er ihr von der halb geöffneten Tür aus das Wort »Kaffee!« zuplärrte.
»Asshole«, schnaubte sie zurück und erhob sich grinsend, um ihm eine Tasse Kaffee zu bringen.
Nick hatte nie von ihr verlangt, ihn zu bedienen. Genau genommen war es ihm anfänglich sogar unangenehm gewesen und er hatte versucht, ihr zu erklären, er könnte sich selbst um seinen Kaffee kümmern. Sein Wunsch war auf taube Samantha-Ohren gestoßen.
Nick ging weiter, betrat sein Büro und hängte sein Sakko sorgsam auf einen Kleiderhaken. Nach einem prüfenden Schwenk über den Schreibtisch ließ er sich in seinen Sessel fallen. Er schaltete den Computer ein und lehnte sich zurück. Bis auf das leise Summen des PCs herrschte Stille. Nachdem er gestern den Tatort besichtigt hatte, wollte er sich nun die Fotos nochmals genau ansehen. Es lag ein Unterschied darin, einfach nur Bilder zu betrachten oder wirklich vor Ort gewesen zu sein. Am besten war beides in der Reihenfolge, wie es sich in diesem Fall ergeben hatte: Fotos, Tatort, Fotos. Ein Tatort konnte ablenken und Fotos allein gaben die Atmosphäre der Szenerie nicht wider.
Er hatte die ersten Bilder gerade geöffnet, als Samantha wie ein Tornado ins Zimmer fegte. Sie knallte eine Kaffeetasse auf seinen Tisch und zog sich ungefragt einen Sessel heran.
»Wo ist Peter?«, erkundigte er sich, ihren Auftritt ignorierend, und nahm einen Schluck Kaffee. »Au, verdammt, heiß.«
»Only hot coffee is good coffee.«
Ungerührt wiederholte er seine Frage. »Wo ist Peter?«
»Er checkt die Vermisstensuche.«
»Ist alles am Laufen, was ich ihm gestern aufgetragen habe? Und hast du einen Termin in Baden ausgemacht?«
Samantha und Peter arbeiteten gut zusammen. Nick konnte sich darauf verlassen, dass sie sich stets abstimmten und jeder seinen Teil erledigte, egal wem er die Aufträge diktierte. Von Anfang an hatte Peter Samanthas bisweilen schroffe Art, ohne mit der Wimper zu zucken, über sich ergehen lassen. Selbst wenn sie »gay, gay, gay« in seiner Nähe vor sich hinträllerte, nahm er es stoisch hin und revanchierte sich nur gelegentlich mit einer feinen Retourkutsche, die zumeist auf ihren Freund, Doktor Robert Hofer, abzielte.
»Of course – and of course, alles läuft und morgen um vierzehn Uhr hast du den Termin am Polizeirevier in Baden. Dieser …« Sie zog die Stirn in Falten.
»Arno Hammer«, half er ihr auf die Sprünge.
»Genau! Er wird ebenfalls anwesend sein, ganz wie du verlangt hast, Chef.«
»Peter organisiert bereits die Vermisstensuche …« Bewusst setzte er keinen Punkt und Samantha übernahm sofort.
»Ich sagte, checkt. Aber ja, er ist dabei. Und ich sage dir, wir schöpfen aus dem Vollen.«
»Selbst wenn die Opfer unter den gemeldeten Vermissten sind, wovon ich ausgehe, werden wir uns in Geduld üben müssen. Im Gegensatz zu den Vermisstenfotos mit gut genährten und vor allem lebendigen Menschen haben wir als ersten Vergleich …«
»… nur Bilder von ausgehungerten, schmerzverzogenen Fratzen«, vollendete Samantha den Satz ihres Chefs.
Nick zuckte mit den Schultern und griff den nächsten Punkt auf. »Was ist mit der Besitzerin der Villa? Gibt es hier schon eine Rückmeldung von der Rechtsmedizin, ob sie zu den Opfern zählt?«
In Samanthas Augen blitzte es auf. »Maria Gutensteiner heißt sie. – Rob arbeitet auf Hochtouren. Sobald er Ergebnisse vorweisen kann, meldet er sich. Du kennst ihn, er würde nie –«
Nick hob abwehrend die Arme. »Ich weiß, ich weiß. Er würde nie eine blanke Vermutung aussprechen. Das läge unter seiner Würde.«
»Hogwash! Er ist einfach zu sehr Perfektionist, als dass er sinnlose Mutmaßungen von sich gäbe.«
»Ich hätte deine früheren Aussagen über ihn aufnehmen sollen.«
Samantha fauchte. »Du bist vierzig Jahre alt, musst aber noch viel lernen, baby boy. In Sachen Liebe bist du wahrlich kein Spezialist.«
»Ich bin über vierzig, Samantha. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Punkt betreffend noch etwas lernen will. Bin ich überhaupt lernfähig?« Er machte eine wegwerfende Handbewegung. »Zurück zum Thema: Hat Freddy sich gemeldet?«
»Ja. Nachdem du gestern vom Tatort verschwunden bist, haben seine Spurensicherer im Haus den Rest erledigt und den Abtransport der Beweismittel organisiert. Mit dem Garten sind sie mittlerweile auch fertig.«
»Und?«
»Fingerabdrücke und Schuhabdrücke in Massen, Blut, Exkrete, sonstige hübsche Kleinigkeiten. Wenn sich etwas Verwertbares darunter befindet, wird Freddy es ans Tageslicht befördern.«
Nick seufzte. »Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.« Beruflich stand Freddy für ihn auf derselben hohen Stufe wie der Rechtsmediziner, persönlich schätzte er den Spurensicherer im Gegensatz zu Robert Hofer jedoch aufrichtig. »Irgendwelche Hinweise auf die Besitzerin? Fehlt Kleidung im Schrank? Wurde ein Reisepass gefunden? Fanden sich Unterlagen, die auf einen Urlaub hindeuten?«
Samantha sah ihn überrascht an. »Bist du nicht überzeugt davon, dass sie eine von den sechs Opfern ist?«
»Doch, ich bin ziemlich sicher. Aber was wäre, wenn sie gerade irgendwo urlaubt? Etwa den Winter in Mallorca verbringt?«
»Der Presse würde es gefallen. Präsentiere deine Vermutung und wenn die Dame wider Erwarten lebendig auftaucht, haben wir jede Menge Publicity.«
»Die Presse … mit der lassen wir uns noch ein wenig Zeit.« Nick rieb sich das Kinn. »Dafür nicht mit der Hausbesitzerin. So oder so möchte ich alles über sie wissen. Selbst wenn sie lebt und nichts damit zu tun hat, sind die Morde in ihrem Haus geschehen.«
Samantha erhob sich. Sie wusste auch ohne detaillierte Anweisungen, was sie nun zu tun hatte.
Nachdem sie sein Büro verlassen hatte, nahm er sich die Tatortfotos weiter vor. Schließlich zog er seinen Block heran und machte sich erste Notizen. Anschließend erstellte er einen Zeitplan. Der Ablauf der folgenden Tage war nicht minutiös planbar, dennoch brauchte er einen groben Leitfaden. Einige wichtige Termine standen an. Neben einem Besuch auf dem Polizeirevier Baden wollte er sich so rasch wie möglich mit Freddy von der Spurensuche zusammensetzen.
Die verbliebenen Spuren an einem Tatort brachten nicht zwangsläufig dienliche Hinweise, doch sie zeigten einen klaren Sachverhalt, schwarz und weiß. Dem gegenüber stand der Eindruck eines Tatorts. Er hatte nichts mit diesen greifbaren Nachweisen zu tun und bediente die andere Gehirnhälfte, zuständig für Gefühle, Sinneswahrnehmungen und Empfindungen, unendliche Grautöne.
Nick war nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, weil er nüchternes Handeln mit Instinkt und Intuition zu verbinden wusste. Er agierte strukturiert, gewährte jedoch seinem Empfinden eine Stimme. Freddy schwamm auf seiner Welle. Der Mann war ein ausgezeichneter Kriminaltechniker, hatte aber auch ein gutes Auge, das mehr wahrnahm als Reifenspuren und Blutspritzer.
Kurz entschlossen griff Nick nach seinem Handy und wählte eine Kurzrufnummer.
Freddy meldete sich nach einmal läuten. »Nick! Schön, dich zu hören. Wie war der Liebesurlaub?« Er stockte. »Entschuldige, ich hatte ganz vergessen, dass –«
»Schon in Ordnung«, unterbrach ihn Nick. »Hast du ein paar Minuten für mich? Heute? Spätestens Morgen?«
»Sofort, wenn du willst. Ich bin im Haus.«
»Perfekt. Bis gleich.« Nick drückte die Auflegen-Taste und legte sein Handy zur Seite. Er kam gerade noch dazu, seinen Kugelschreiber wieder aufzunehmen, als Freddy bereits das Büro betrat.
»Bist du geflogen?« Nick legte den Stift zur Seite.
Der Spurensucher schmunzelte. »Sag einfach Superman zu mir.« Er setzte sich auf einen Sessel. »Etwas Bestimmtes? Weil ich muss dir gleich sagen, wir haben viel gefunden, etwas wirklich Verwertbares sehe ich bis jetzt nicht darin. Aber die Auswertungen laufen noch, Blutabgleich mit den Opfern, Fingerabdrücke et cetera. Vielleicht irre ich mich und es taucht die Nadel im Heuhaufen auf. Es wäre zu wünschen.«
Unwillkürlich musste Nick lächeln. Die »Nadel im Heuhaufen« hatte er selbst zuvor bei Samantha verwendet. Er kommentierte es nicht, weil er sofort zu seiner Frage kommen wollte. »Unabhängig von den Spuren, was hattest du für einen Eindruck vom Tatort?«
Freddy lehnte sich zurück und schloss für einen Moment die Augen. Mit den flachen Händen rieb er sich über das Gesicht. »Um die Wahrheit zu sagen … meine Körperhaare stritten sich um Stehplätze. Du kennst mich, ich habe viel gesehen, ebenso wie du. Bizarre Tatorte, verstümmelte Körper, die Liste lässt sich unendlich fortsetzen, aber dieser Tatort war … war …«, er suchte nach dem richtigen Wort, »unfassbar. Dieser tiefe Hass, der dahinterstecken musste, hat mich richtiggehend schockiert.«
Hass war Nicks Schlagwort. Bereits als er die Fotos am iPad gesehen hatte, war Hass als Motivationsgrund hervorgetreten und etwas anderes, das er noch nicht einzuordnen vermochte. »Eine höchst emotionale Tat, wobei die Planung und Ausführung akribisch erfolgt sein muss«, dachte er laut.
»Die waren in der Tat bestens organisiert. Im Grunde war das Haus tipptopp. Was wir gefunden haben, waren zwangsläufige Überbleibsel, darüber hinaus gab es auf den ersten Blick nichts zu entdecken.« Freddy fixierte Nick. »Lach mich jetzt nicht aus, aber glaubst du, es könnte sich um eine Sektengeschichte handeln?«
»Oje!« Nick hob abwehrend die Arme. »Dir ergeht es also ähnlich. Ich bin zwar noch nicht beim Sektengedanken angelangt, versuche aber verzweifelt, das Bild einer christlich motivierten Tat zu verdrängen.«
»Worin liegt für dich der Unterschied?«
Nick zuckte mit den Schultern. »Du hast recht; private Gleichgesinnte, geführte Organisation, anerkannte Gemeinschaft, es bleibt dasselbe. Wichtig ist allein, den richtigen Ansatz zu finden. Aber nochmals: Ich versuche, das Bild zu verdrängen! Wir denken doch nur sofort in diese Richtung, weil die Opfer gekreuzigt wurden. Das Kreuz hat eine vielfältige Symbolik und die Kreuzigung als Hinrichtungsart gab es bereits vor dem Jahr null und anderorts.«
»Da gebe ich dir recht. Wir könnten etwa genauso einen verworrenen Pfad nach Rom finden«, bemerkte Freddy.
»Wie kommst du auf Rom?«
»Der Sklavenaufstand des Spartacus’ zum Beispiel. Damals wurden sechstausend Rebellen gefangen genommen und entlang der Via Appia gekreuzigt. Stell dir das einmal vor, Nick: sechstausend! Warum fällt uns das nicht auf Anhieb ein?«
»Wirst du der Lyrik untreu und steigst auf historische Romane um?«, fragte Nick. Er wusste, der Spurensucher verfasste in seiner Freizeit Gedichte. Obwohl Nicks Leidenschaft in keiner Weise der Poesie galt, gefielen ihm die knappen, prägnanten Texte seines Kollegen durchaus.
»Nach wie vor schreibe ich meine Gedichtchen. Allerdings trage ich mich tatsächlich mit dem Gedanken einer Entwicklung.« Freddy wiegte den Kopf. »Ich glaube, ich bin bereit für mein erstes Buch. Und du liegst goldrichtig, tendenziell treibt es mich in die Vergangenheit. Ich finde das erste vorchristliche Jahrhundert faszinierend, insbesondere natürlich die Römer – deshalb kam ich ja auf Spartacus.« Er schmunzelte und hievte sich mit einem Ächzen aus dem Sessel. »Sollte ich auf etwas stoßen, melde ich mich sofort.« Er wandte sich zur Tür und hob die Hand zum Gruß. Auf der Schwelle stieß er beinahe mit Samantha zusammen.
»Hi, Freddy.« Sie schob sich an ihm vorbei in Nicks Büro und gab dem Gehenden dabei einen kräftigen Klaps auf den Hintern.
»Als Protagonistin stelle ich mir eine wehrhafte Matrone vor, quasi eine antike Emanze.« Freddy zwinkerte Samantha zu und verließ mit den Worten »Man muss sich seine Inspiration holen, wo man sie kriegen kann« endgültig den Raum.
Samantha sah ihm mit krauser Stirn nach. »Meint der Staubkornsucher mich?«
»Ich schätze, du bekommst eine tragende Rolle in Freddys Roman.«
Sie schüttelte den Kopf. »Idiot! – Maria Gutensteiner.« Geräuschvoll landete eine dünne Mappe auf seinem Schreibtisch.
»Wow, schnell.«
»Es war keine besondere Herausforderung, schon gar nicht für eine Matrone.« Sie verzog den Mund, machte kehrt und verschwand ohne ein weiteres Wort.
Nick zog die Mappe zu sich heran und öffnete sie. Samantha hatte nicht einfach Ausdrucke gesammelt, sondern einen übersichtlichen Lebenslauf der Frau erstellt. Er begann zu lesen.
Maria Gutensteiner war 1941 in Wien geboren worden. In Klammern hatte Samantha hinzugefügt: Sie ist 74 Jahre alt. Automatisch musste er schmunzeln. Was täte ich nur ohne sie?
Er las weiter. Maria Gutensteiner hatte eine einfache Schulausbildung genossen und im Anschluss eine Lehre als Schneiderin gemacht. Es folgten zwei Anstellungen, dazwischen schwarze Löcher. Schwarzarbeit? Arbeitslosigkeit?, überlegte er. 1969 war der Abschluss zur Heimerzieherin vermerkt und im selben Jahr der Arbeitsbeginn als Erzieherin in einem Kinderheim Rotherburg. Das Arbeitsverhältnis endete im Jahr 1975 mit der Schließung des Kinderheims.
Er blätterte um und studierte die nächsten Zeilen. Er stutzte, wiederholte Zeile für Zeile. Im Februar 1976 war die Geburt einer Tochter notiert, Vater unbekannt. Er besah nochmals die erste Seite. Das Kinderheim war im September 1975 geschlossen worden. Sie war also während ihrer Arbeitszeit schwanger geworden. 1976 hatte sie die Villa in Baden erworben, bar bezahlt.
Er ging die letzten Angaben nochmals durch. Weit und breit keine Heiratsurkunde, der Vater des Kindes ist als unbekannt eingetragen, zur Zeit der Geburt war sie – zumindest offiziell – arbeitslos gewesen. Und in einer solchen Situation hatte sie genügend Geld für den Kauf einer durchaus ansehnlichen Villa in Baden? Die nächste Frage lag auf der Hand, ebenso die Antwort: Wer war der Vater? Vermutlich ein reicher, verheirateter Mann. Kurz sinnierte er über seine Vermutung, bevor er sich die letzte Seite vornahm. Sie beinhaltete Detailinformationen über die Tochter: Elisabeth Gardini, verheiratet mit Marco Gardini. Sie lebte in Italien. Eine Adresse in Rom war verzeichnet, ebenso zwei Telefonnummern. In Klammern stand bei der ersten: Handy Elisabeth.
Nick nahm sein Handy und wählte. Es läutete einige Male.
»Pronto?«
Er räusperte sich. »Guten Tag. Spreche ich mit Frau Elisabeth Gardini?«
»Sì … ja. Wer ist dran?«
»Mein Name ist Nick Stein, ich bin Sonderermittler beim Bundeskriminalamt Wien.« Er stoppte und wartete auf eine Reaktion.
»Was kann ich für Sie tun?« Skepsis lag in ihrer Stimme.
»Es geht um Ihre Mutter …«
»Aha.«
Er hatte mit einer besorgten Frage gerechnet, wenigstens mit einer Form von Neugier, aber nicht mit einem monotonen »Aha«. Automatisch stellte er sich auf den sachlichen Ton seiner Gesprächspartnerin ein. »Im Haus Ihrer Mutter in Baden wurde ein Verbrechen verübt. Ich möchte mich bei Ihnen erkundigen, ob –«
»Ist sie tot?«, unterbrach ihn die Frau.
Okay, den spontanen Gedanken an einen Urlaub bei ihrer Tochter kann ich streichen. »Das wissen wir noch nicht«, antwortete er wahrheitsgetreu. Besonderes Feingefühl benötigte er nicht, um zu bemerken, dass ihr die Information, zumindest nach außen hin, nicht naheging.
Die Frau gab ein Geräusch von sich, das er als Seufzer einstufte. »Herr … Stein? Meine Mutter und ich pflegen keinerlei Kontakt. Ich kann Ihnen in keiner Weise weiterhelfen.«
Die Gefühlskälte schwappte wie eine eisige Atlantikwelle an sein Ohr und setzte sich in seinem Gehirn fest. Was muss ein Mensch erlebt haben, der in Bezug auf seine eigene Mutter derart reagiert? »Ich danke Ihnen für die Auskunft.«
»Sie melden sich, wenn Sie etwas wissen?«, fragte sie tonlos.
»Selbstverständlich.«
Mit einer knappen Verabschiedung beendete er das Gespräch. Seine inneren Alarmglocken läuteten; im beruflichen Bereich seine zuverlässigen Begleiter, im privaten zwar ebenso erprobt, leider hörte er in diesen Fällen aber nicht immer auf das Klingeln.