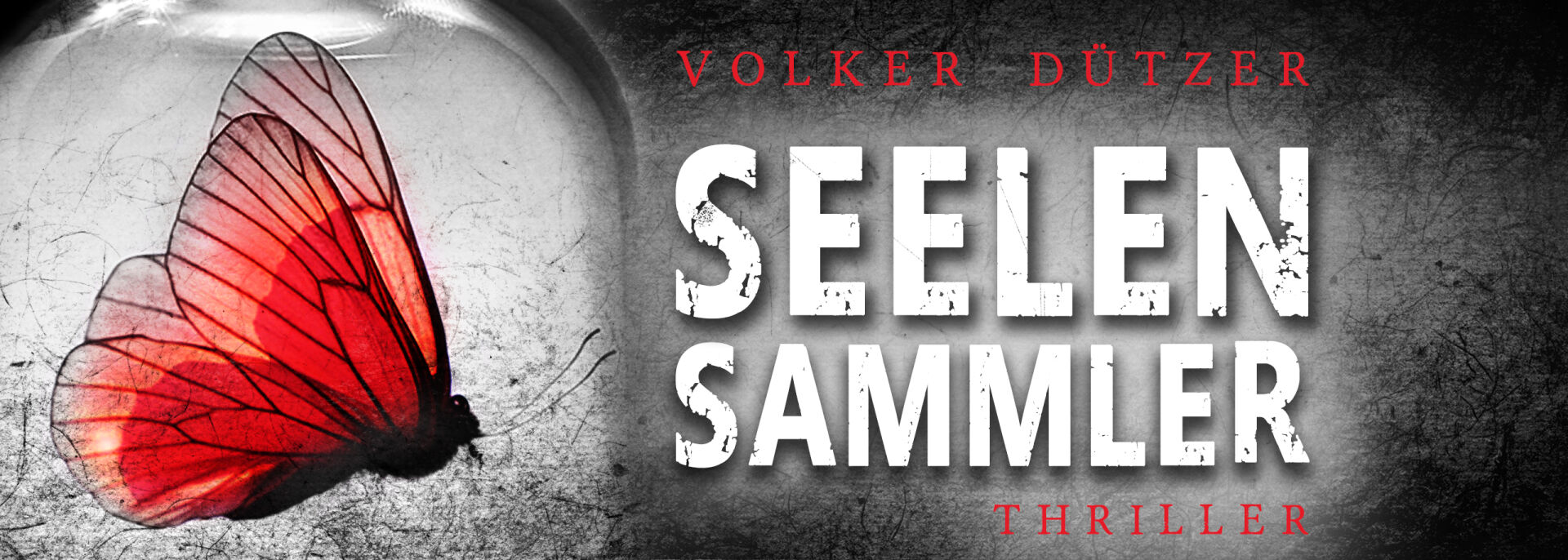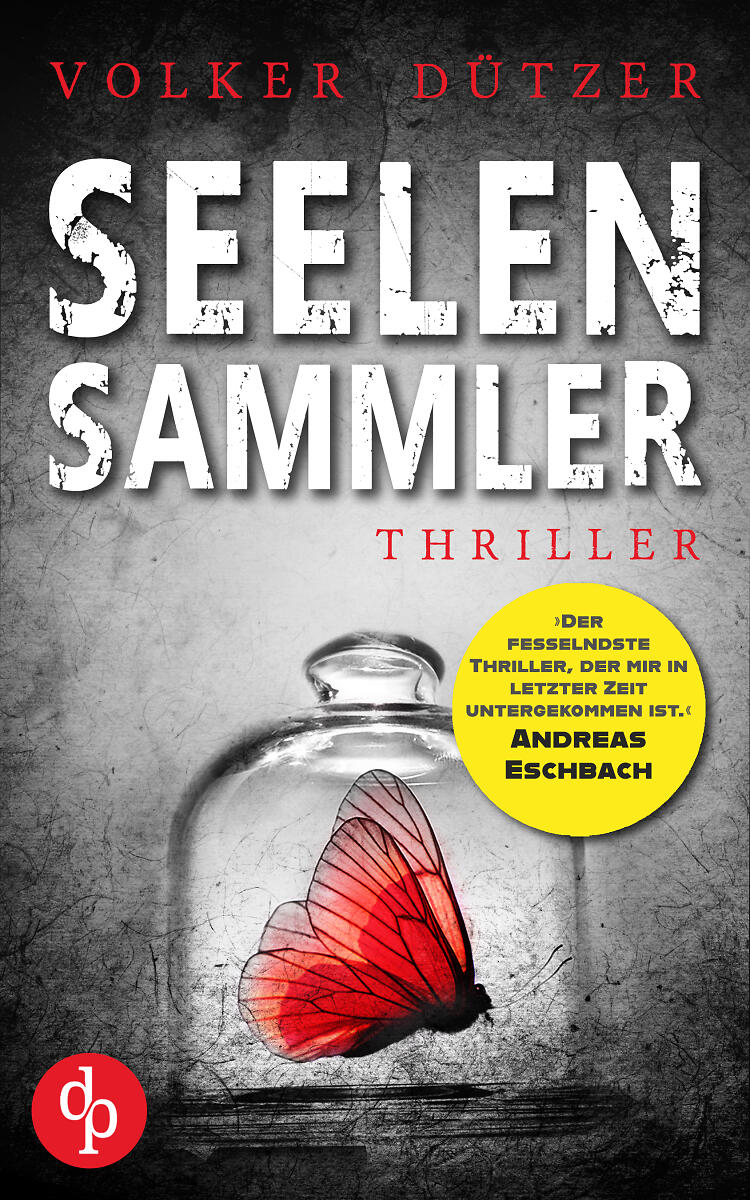1
Der 2. November war kein gewöhnlicher Tag im Leben von Jule Rahn, obwohl er begann wie jeder andere. Jeden Morgen setzte sie den linken Fuß neunhundertdreiundzwanzig Mal vor den rechten, um von der Bushaltestelle am Deutschen Eck zu ihrem Arbeitsplatz im Paracelsus-Labor zu gelangen. Jeden Nachmittag nahm sie denselben Weg zurück. Jule mochte Ordnung. Das Unbekannte, Unvorhersehbare jagte ihr eine Höllenangst ein.
An diesem Montagnachmittag war sie jedoch entschlossen, zum ersten Mal von ihrer exakt berechneten Route abzuweichen. Um die lähmende Angst niederzuringen, bediente sie sich unterschiedlicher Rituale. Sie gaben ihr das Gefühl, dass alles so war, wie es sein sollte. Eines dieser Rituale war das Zählen ihrer Schritte. Das Flüstern der Zahlen, die sich ordentlich wie Perlen auf einer Schnur aneinanderreihten, half ihr, die stets am Rand ihres Bewusstseins lauernden Panikattacken von sich fernzuhalten. Wenn sie einen Fuß auf die Erde setzte, wiederholte sie in Gedanken stumm ihr Mantra: Es kann nicht passieren, nichts passieren, nichts passieren.
Jule war nicht dumm, sie wusste, dass ihr Verhalten nicht normal war, aber sie kämpfte gegen den mächtigsten Gegner, dem sich ein Mensch stellen muss: die eigene Angst.
Der Drang, den Käfig ihrer Zwangshandlungen zu sprengen, war heute so stark wie nie zuvor. Die meisten Tage waren grau, aber dieser war von einem satten Blau erfüllt. So tiefblau wie ein wolkenloser Himmel an einem heißen Sommertag. Blau bedeutete Hoffnung, daher wollte sie den seltenen Anfall von Mut nicht ungenutzt verstreichen lassen.
Mit gesenktem Kopf wich sie den wenigen Passanten aus. Ein scharfer Wind wehte von Norden her über das Rheintal und zwang die Leute, ihre geröteten Nasen und Wangen hinter wärmenden Schals zu verbergen. Der Winter kam früh in diesem Jahr.
Als sie sich allein glaubte, verlangsamte sie ihre Schritte und blieb schließlich stehen. Benutzte sie weiterhin den Uferweg, würde sie nach exakt vierhundertsechzehn weiteren Schritten die Bushaltestelle erreichen. Nichts Außergewöhnliches würde dann geschehen und der Tag wie alle anderen zu Ende gehen.
Zu allem entschlossen, wandte sie sich nach links. Eine Gasse führte zu einer parallel zum Fluss verlaufenden Straße. Folgte sie ihr, würde sie auf eine Gasse treffen, die am Zusammenfluss von Rhein und Mosel endete. Ein kleiner Umweg, ein Kinderspiel, keine große Sache.
Es kann nichts Schlimmes passieren, nichts passieren, nichts passieren.
Einen Umweg von fünfhundert Metern in Kauf zu nehmen erforderte von niemandem Heldenmut. Für Jule allerdings bedeutete der Entschluss ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang, ein ungeheures Wagnis, ein tollkühnes Unterfangen.
Vorsichtig, als würde sie sich in einen Dschungel voller tödlicher Gefahren hineinwagen, setzte sie einen Fuß vor den anderen und entfernte sich immer weiter von ihrer gewohnten Strecke. Ihre Hoffnung stieg, das Gefängnis ihrer Zwangsneurosen für kurze Zeit verlassen zu können, doch nach sechsundachtzig Schritten prallte sie gegen eine unsichtbare Mauer. Ein erdrückendes Gewicht senkte sich auf ihre Brust und machte jeden Atemzug zur Qual. Sie blieb so plötzlich stehen, als wäre sie gegen die Gitterstäbe eines imaginären Käfigs gestoßen. Jule fühlte sich wie eine der Mäuse, die in dem Labor, in dem sie arbeitete, für medizinische Versuche benutzt wurden. Sie irrte im Labyrinth ihrer Furcht umher und suchte panisch nach dem Ausgang, ohne Aussicht, ihn jemals zu finden. Die kümmerliche Handvoll Mut, die sich in ihr Herz verirrt hatte, schmolz zusammen wie Schnee in der Frühlingssonne. Wie hatte sie nur glauben können, auszubrechen würde auf eine so einfache Weise funktionieren?
Sie drehte vor der eingebildeten Barriere um und ging zum Uferweg zurück. Jule Rahn, die kleine menschliche Lokomotive, hatte dreist versucht, von den Schienen zu hüpfen. Wo doch jeder wusste, dass ein entgleisender Zug auf eine Katastrophe zusteuerte.
Jule presste die Lippen zusammen und eilte weiter. Enttäuscht wischte sie eine Träne fort, die sich in ihren Augenwinkel verirrt hatte.
Abgesehen von dem Mann, der auf einer Bank saß, war der Uferweg menschenleer. Die Augen auf den nassen Asphalt gerichtet, ging sie zögerlich weiter. Als sie die Bank erreichte, warf sie dem Mann einen scheuen Blick zu und beschleunigte ihre Schritte. Er war hager wie ein trockener Ast. Die Stoffhose und der weite Wintermantel schlotterten um seine ausgezehrte Gestalt. Ohne ihn anzusehen, spürte sie, dass er den Kopf hob und sie anstarrte. Unbeirrt lief sie weiter, denn er war so wenig real wie die unüberwindliche Mauer der Angst. Manchmal tauchte er monatelang nicht auf, dann wieder quälte er sie im Abstand weniger Tage. Seit vergangenem Freitag hatte sie ihn drei Mal gesehen, so kurz hintereinander wie nie zuvor. Dr. Gottfried hatte ihr erklärt, warum sie ihn und die anderen sah – die Frau mit dem toten Kind auf dem Arm, den blutenden Jungen und die blonden Zwillinge. Es hatte etwas mit Schuldgefühlen zu tun. Jule hatte die Visionen ignoriert, doch je heftiger sie sie verdrängte, desto öfter quälten sie sie. Seit sie begonnen hatte, im Labor mit Menschen zu reden, die nicht da waren, musste sie ihre Therapiestunden ernster nehmen. Sie mochte ihren Job, er war alles, was sie hatte. Niemand wollte eine verrückte Laborantin beschäftigen, die tote Menschen sah, also musste sie sich zusammenreißen und damit aufhören.
Die kahlen Zweige der Weiden klapperten wie von der Sonne gebleichte Knochen im Novemberwind. Zwei Nilgänse segelten tief über das Wasser und steuerten in einem eleganten Bogen auf die andere Rheinseite zu. Die Vögel flogen, wohin sie wollten. Jule zählte Schritte.
Sie ging unter der Horchheimer Brücke hindurch. Menschen fuhren darüber hinweg und gingen ihren alltäglichen Geschäften nach, ohne zu ahnen, welche Seelenqualen die unscheinbare junge Frau tief unter ihnen am Rheinufer ausstand.
Unvermittelt traf Jule das Schicksal mit der Wucht einer Sturmbö, die ihr Leben wie einen Haufen welkes Laub durcheinanderwirbelte. Ein schwerer Gegenstand klatschte neben ihr in den Fluss, ein schmutziger brauner Sprühregen benetzte ihren Mantel. Im flachen Wasser trieb bäuchlings ein menschlicher Körper. Der mit spärlichem grauem Haar bedeckte Kopf ruhte – das Gesicht von ihr abgewandt – auf der mit Grauwacke bewehrten Uferböschung. Aus einer Wunde am Hinterkopf sickerte Blut und sammelte sich in einer Lache zwischen den Steinen. Der Kleidung nach zu urteilen, handelte es sich um einen Mann. Er trug eine beigefarbene Regenjacke, eine graue Hose und abgewetzte braune Schuhe, die auf dem Wasser wippten wie Papierschiffchen. Die Strömung zerrte an den Beinen des Toten. Denn tot musste er sein. Niemand konnte einen solchen Sturz überleben.
Jule starrte auf die Leiche, ohne zu begreifen, was geschehen war. In einer mechanischen Bewegung legte sie den Kopf in den Nacken und blickte zur Eisenbahnbrücke hinauf. Eine Gestalt beugte sich über das Geländer des Fußwegs neben den Schienen. Der Mann trug eine dunkle Steppjacke und eine Wollmütze, ein blauschwarzer Bartschatten bedeckte seine hohlen Wangen. Er sah sie an. Jule hatte das Gefühl, als ob er mühelos durch sie hindurchblicken und ihre Gedanken lesen konnte – ein wildes Durcheinander aus Unsicherheit, Angst und Schrecken.
Der Tote im Wasser hatte seinen Sturz nicht durch Leichtsinn herbeigeführt. Er hatte auch nicht selbst sein Leben beenden wollen. Instinktiv erkannte Jule die Verbindung zwischen den beiden Männern – eine mörderische Verkettung, zu der nun auch sie gehörte.
Sie kniff die Augen zusammen und öffnete sie sogleich wieder. Das Gesicht über dem Brückengeländer hatte sich aufgelöst wie ein Spuk. War der Mann real gewesen oder auch nur ein Trugbild ihrer traumatisierten Seele? Sie blickte zum Ende der Brücke, wo eine stählerne Wendeltreppe nach unten zum Uferweg führte. Die obersten Stufen erzitterten unter dem Gewicht schwerer Stiefel. Gespenster verursachten keinen Lärm in der Welt der Lebenden. Jule wandte sich um und hatte nur einen Gedanken: Fort! Sie hatte etwas gesehen, das nicht für ihre Augen bestimmt gewesen war, und sie würde einen furchtbaren Preis dafür bezahlen, wenn ihr Verfolger sie einholte.
Sie rannte, bis ihre brennenden Lungen sie zwangen, langsamer zu gehen. Immer wieder blickte sie sich um. Da sie den Mann nicht mehr sah, wuchs in ihr die Hoffnung, ihn abgeschüttelt zu haben, doch da prallte sie unvermittelt mit einer dicken Frau zusammen, die einen Rauhaardackel spazieren führte. Jule murmelte eine Entschuldigung und hetzte weiter. Die Frau rief ihr eine Beleidigung hinterher, der Dackel kläffte wütend.
Es kann nichts passieren, nichts passieren.
Ihre hilflosen Versuche, sich selbst Mut zuzusprechen, kamen ihr im Licht dessen, was soeben geschehen war, lächerlich und unwirklich vor. Genauso surreal wie der Mord, den sie beobachtet hatte. Was sie gesehen hatte, musste ein Trugbild ihrer überreizten Nerven gewesen sein, das war die einzige Erklärung. Solche Dinge passierten in Romanen oder Filmen, aber nicht im wirklichen Leben. Wenn sie jetzt umkehrte, würde sie nichts weiter vorfinden als den träge dahinfließenden Rhein – aber keine Leichen und keine finster blickenden Männer, die sie verfolgten.
Jule erinnerte sich an das Poltern auf der Wendeltreppe. Nein, was sie erlebt hatte, war real gewesen. Und daher war auch die Gefahr real, dass sie dem Toten im Rhein Gesellschaft leisten würde, wenn der Mörder sie einholte.
Sie erreichte den menschenleeren Schlossvorplatz. Der Wind wirbelte trockenes Herbstlaub über das Pflaster und heulte um die Eisenstäbe des Zauns, der den Platz zur Straße hin abgrenzte. Sie drehte sich im Kreis, bis ihr schwindelig wurde. Auf der freien, ebenen Fläche würde ihr Verfolger sie so deutlich erkennen wie einen Blutfleck auf einer weißen Tischdecke.
Auf der Suche nach einem Versteck lief sie bis zum Schloss und betrat das Foyer in der Absicht, auf der anderen Seite durch die Gartenanlagen zum Rheinufer zurückzukehren. Von dort waren es nur wenige Minuten bis zur Bushaltestelle. Sie hoffte, dass ihr Verfolger so endgültig ihre Spur verlieren würde.
Bevor sie jedoch die Glasfront auf der dem Rhein zugewandten Seite des Gebäudes erreicht hatte, fiel hinter ihr eine Tür ins Schloss. Das Echo hallte wie ein Schuss durch das leere Foyer, Schritte näherten sich. Eine raue Männerstimme summte leise eine Melodie. Jule blieb gerade genug Zeit, um sich in den Toiletten zu verstecken. Sie schloss sich in einer Kabine ein und wartete. Kein Laut drang von draußen herein. Ihr Herz pochte wild wie eine aus dem Takt geratene Standuhr. Sie war fest davon überzeugt, dass er ihren Herzschlag hören musste, obwohl das unmöglich war.
Der Sekundenzeiger ihrer Armbanduhr umrundete mit quälender Langsamkeit das Zifferblatt. Sie konnte sich nicht ewig hier verstecken. Vielleicht hatte sie sich geirrt und der Unbekannte im Foyer war ein harmloser Tourist. Sie hatte nicht gesehen, wie er das Schloss betreten hatte. Vielleicht gehörte die Stimme auch einem Mitarbeiter der Stadt oder einer Reinigungskraft. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Doch sie durfte sich nicht von einer möglicherweise falschen Vermutung leiten lassen, ihr Leben hing davon ab, ob sie die richtige Entscheidung traf.
Als sie zu glauben begann, dass der Unbekannte das Foyer längst wieder verlassen hatte, öffnete sie leise die Kabinentür. Der Waschraum war leer. Sie schlich bis zum Toiletteneingang, zog die Tür einen Spalt auf und spähte hinaus. Der Mann, den sie auf der Brücke gesehen hatte, schlenderte durch das Foyer und spießte mit seinen Blicken jedes Detail auf. Er hatte ein asketisches Gesicht mit einer scharfen, vorspringenden Nase und dicht zusammenstehenden Augen. Von den Mundwinkeln liefen zwei Falten bis zum Kinn, die seiner Miene Ähnlichkeit mit den starren Zügen einer Marionette verliehen. Jule biss sich in den Handrücken und unterdrückte einen Schrei. Von seinem linken Ohr bis zum Kinn zog sich eine feuerrote, dünne Narbe. Seine Hände steckten in schwarzen Lederhandschuhen. Er ballte die Fäuste und verriet damit seine innere Anspannung. Das Leder knirschte und jagte Jule einen kalten Schauer über den Rücken. Diese Hände hatten einen Menschen getötet. Und sie würden es, ohne zu zögern, wieder tun, wenn ihr Besitzer die Augenzeugin seiner Tat entdeckte. In einer direkten Auseinandersetzung mit ihm wäre sie hoffnungslos unterlegen.
Er blieb in der Mitte des Foyers stehen, blickte sich suchend um und starrte dann auf den Eingang zu den Toiletten. Jule schreckte zurück, presste sich mit dem Rücken fest an die Wand und wünschte sich, mit ihr zu verschmelzen. Wenn er den Waschraum durchsuchte, würde er sie sofort entdecken. Hier gab es nirgendwo ein Versteck, und die Zugangstür ließ sich nicht verriegeln.
Sie hörte das hohle Geräusch seiner Schritte auf den glatten Bodenfliesen … und dann plötzlich den Klingelton eines Mobiltelefons. Er blieb stehen und meldete sich mit einer trockenen Stimme, die wie das Rascheln von verbranntem Papier klang.
Jule riskierte einen weiteren Blick durch den Türspalt. Der Mann stand nun etwa sechs Meter links von ihr und drehte ihr den Rücken zu. Eine bessere Chance zu entwischen würde sie nicht bekommen. Lautlos schlüpfte sie aus dem Waschraum und schlich auf die Glastüren zu, die zum Rheinuferweg führten. Wenn er sich jetzt umdrehte, würde er sie sofort sehen. Doch sie hatte Glück. Unbemerkt verließ sie das Foyer und durchquerte den Schlossgarten. So schnell ihre Beine sie trugen, lief sie am Fluss entlang, wich im letzten Moment einer alten Frau mit einem Rollator aus, rempelte Passanten an und rannte kopflos weiter.
Gegen 17 Uhr erreichte sie die Haltestelle am Deutschen Eck. Der Bus, den sie an grauen Tagen benutzte, war bereits vor zwanzig Minuten abgefahren. Sie musste auf den nächsten warten, der erst in einer halben Stunde eintreffen würde. Blieb sie allerdings zu lange am selben Ort, stieg die Gefahr, dass der Mann mit der Narbe sie aufspürte.
Atemlos hetzte sie Richtung Innenstadt. Dort hoffte sie auf zahlreiche Passanten zu treffen, auf gut besuchte Ladenpassagen und Cafés, wo sie in der Menge untertauchen konnte. Ihre Angst vor überfüllten Geschäften und dicht gedrängten Menschenmassen war geringer als die Furcht vor dem Mörder. Er musste davon ausgehen, dass sie sich sein Gesicht eingeprägt hatte, sonst wäre er ihr nicht gefolgt. Dass sie Hals über Kopf vor ihm geflohen war, würde ihm außerdem beweisen, dass sie begriffen hatte, was er getan hatte. Er konnte es sich gar nicht leisten, sie am Leben zu lassen.
Jule überquerte den Zentralplatz und betrat das Mittelrheinforum. Ihre Brillengläser beschlugen in der warmen Luft. Hastig nahm sie die Brille ab und wischte sie sauber. Da sie normalerweise jede Menschenansammlung mied, waren ihre Sinne von der Vielzahl der Eindrücke überfordert. Menschen redeten durcheinander, ein Kind schrie mit heller Stimme, aus versteckten Lautsprechern dudelte Musik. Über großformatige Bildschirme flackerten Werbespots. Aus einem Imbiss drang der Geruch von Frittierfett, und die Ausdünstungen zahlloser Menschen umströmten sie.
Sie durfte nicht stehen bleiben, der Mann mit der Narbe würde sie sofort sehen, falls er hierherkam. Also lief sie auf eine der Rolltreppen zu und fuhr nach oben. Orientierungslos hastete sie weiter und gelangte auf eine umlaufende Galerie, die von Boutiquen und kleinen Läden gesäumt wurde. Hier oben herrschte kaum Betrieb, aber die Geschäfte boten eine Vielzahl von Verstecken.
In der Anwesenheit fremder Menschen überkam sie stets ein beklemmendes Gefühl, das schnell zu Schwindel und Panikattacken führte. Sie hatte gelernt, mit ihren neurotischen Ängsten zu leben und sie als Teil ihres Selbst zu akzeptieren. Der Preis, den sie dafür zahlte, waren Einsamkeit und verpasste Chancen. Die Vorstellung, fortan ein Leben auf der Flucht zu führen, ließ die unterdrückte Verzweiflung aus ihr hervorbrechen.
Vielleicht ließ der Unbekannte von ihr ab, wenn er merkte, dass sie nichts gegen ihn unternahm. Aber machte sie sich nicht strafbar, wenn sie verschwieg, was sie gesehen hatte? Hatte das Opfer möglicherweise noch gelebt? Hätte der Mann gerettet werden können, wenn sie nicht geflohen wäre, sondern einen Notarzt herbeigerufen hätte?
Sie beruhigte sich damit, dass niemand den Sturz aus fünfzehn Metern Höhe überlebte. Schon gar nicht, wenn er auf einen Stein prallte und ein faustgroßes Loch im Kopf hatte.
Sie zwang sich, an den Schaufenstern entlangzuschlendern, um sich nicht von den anderen Passanten zu unterscheiden. Jemand drückte ihr den Werbeflyer eines Speed-Dating-Cafés in die Hand, das in Kürze eröffnen würde. Hastig steckte sie den Flyer in ihre Manteltasche. Die Vorstellung, in einem solchen Café im Minutentakt die Bekanntschaft fremder Männer zu machen, erschreckte sie fast mehr als der Gedanke an das grausame Erlebnis am Fluss.
Wie konnte jemand an solch unwichtige Dinge wie Speed-Dating auch nur denken? Wie konnte überhaupt jemand an etwas anderes denken als an dunkel gekleidete Männer mit fürchterlichen Narben, die alte Menschen von Brücken warfen?
Was mochte der Alte getan haben, um bei dem Täter eine so große Wut zu erzeugen? Oder war er einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und Opfer eines Raubüberfalls geworden? Sie würde es wohl nie erfahren. Und sie wollte es auch nicht wissen. Alles sollte so bleiben, wie es war, und sich nicht verändern. Nur ein vorhersehbares, langweiliges Leben ließ sich kontrollieren. Chaos bedeutete Unsicherheit, Gefahr, Angst und Panik.
Sie versuchte, sich damit zu trösten, dass sie in einer großen Stadt wohnte. Über hunderttausend Menschen lebten in Koblenz. Die Chancen, dass er sie niemals finden würde, standen nicht schlecht. Er kannte weder ihren Namen noch ihre Telefonnummer und wusste nicht, wo sie arbeitete. Je länger sie sich vor ihm verbergen konnte, desto mehr würde seine Erinnerung an ihr Gesicht verblassen.
Doch dann blitzte ein neuer, erschreckender Gedanke in ihrem Kopf auf: Ihm musste nun klar sein, dass sie den Rheinuferweg zu einer bestimmten Uhrzeit benutzte. Er könnte ihr dort auflauern, morgen oder an einem anderen Tag, wenn sie nicht mehr damit rechnete. Ihr Leben war aus den Fugen geraten wie ein entgleister Zug. Keine Macht der Welt konnte die kleine Lokomotive Jule Rahn wieder in die Spur zurückheben. Es war vorbei. Sie würde in eine andere Stadt ziehen, eine neue Arbeitsstelle suchen müssen.
Aber das war unmöglich. Einen geringfügig anderen Weg zum Labor zu nehmen, hatte sie bereits an die Grenzen ihrer psychischen Belastbarkeit geführt. Sie würde niemals in der Lage sein, ihr Leben so umfassend neu zu gestalten. Sie konnte lediglich Kleinigkeiten in ihrem Alltag verändern, die andere Menschen überhaupt nicht bemerken würden. Mit ihrer eigenen Unfähigkeit zur Veränderung sprach sie selbst das Todesurteil über sich.
Aber es gab noch eine Alternative. Die Polizei musste ihr helfen. Wenn sie die Wahrheit berichtete, würden die Beamten keine andere Wahl haben, als den Mörder aufzuspüren. Ja, sie würde der Polizei erzählen, was sie gesehen hatte. Das war der Ausweg! Sie würden den Mörder jagen, ihn fassen und für immer wegsperren. Dann drohte ihr keine Gefahr mehr.
Jule senkte den Kopf und verkrampfte die Finger ineinander. Nein, es würde nicht funktionieren. Sie würden sie auslachen. Sie würden davon ausgehen, dass der Mann Opfer eines Unglücks war, oder ihn für einen Selbstmörder halten. Warum sollte jemand einen alten Mann von einer Brücke in den Rhein stoßen? Die Vorstellung war geradezu absurd. Sie würden sie für eine hysterische alte Jungfer halten, die sich wichtigmachen wollte, die um Aufmerksamkeit bettelte, weil ihr Leben langweilig und fad war wie eine Tütensuppe. Wie ein grauer Tag.
Der Vorführer in Jules Kopf setzte unaufhaltsam sein destruktives Kino in Gang. Irgendwann würden sie ihre Leiche im Rhein finden, mit einem ausgefransten, tödlichen Loch im Kopf.
„Sie hat wohl doch die Wahrheit gesagt“, hörte sie den Kommissar sagen. „Ein Jammer, dass wir ihr nicht geglaubt haben. Aber wer hätte das ahnen können?“
Unschlüssig, was sie nun unternehmen sollte, trat Jule an die Brüstung der Galerie. Drei Stockwerke unter ihr schimmerte der auf Hochglanz polierte Boden der Eingangshalle. Was es wohl für ein Gefühl war, zu sterben? Was hatte der alte Mann empfunden, als er über das Geländer gestürzt war? Es hieß, ein Sterbender sähe sein Leben in Sekunden an sich vorüberziehen. Hatte er Zeit gehabt, um über sein Leben nachzudenken? Wahrscheinlich dachte man gar nichts. Es passierte wie alles andere, einfach so. Keine große Sache.
Sie beugte sich über das Geländer und schauderte. Plötzlich hatte sie das Gefühl, dass jemand dicht hinter ihr stand und sie anstarrte. Sie fuhr herum. Graue Augen betrachteten sie teilnahmslos. Die feuerrote Narbe leuchtete grell auf der blassen Haut. Vor ihr stand der Mann, den sie auf der Brücke gesehen hatte.