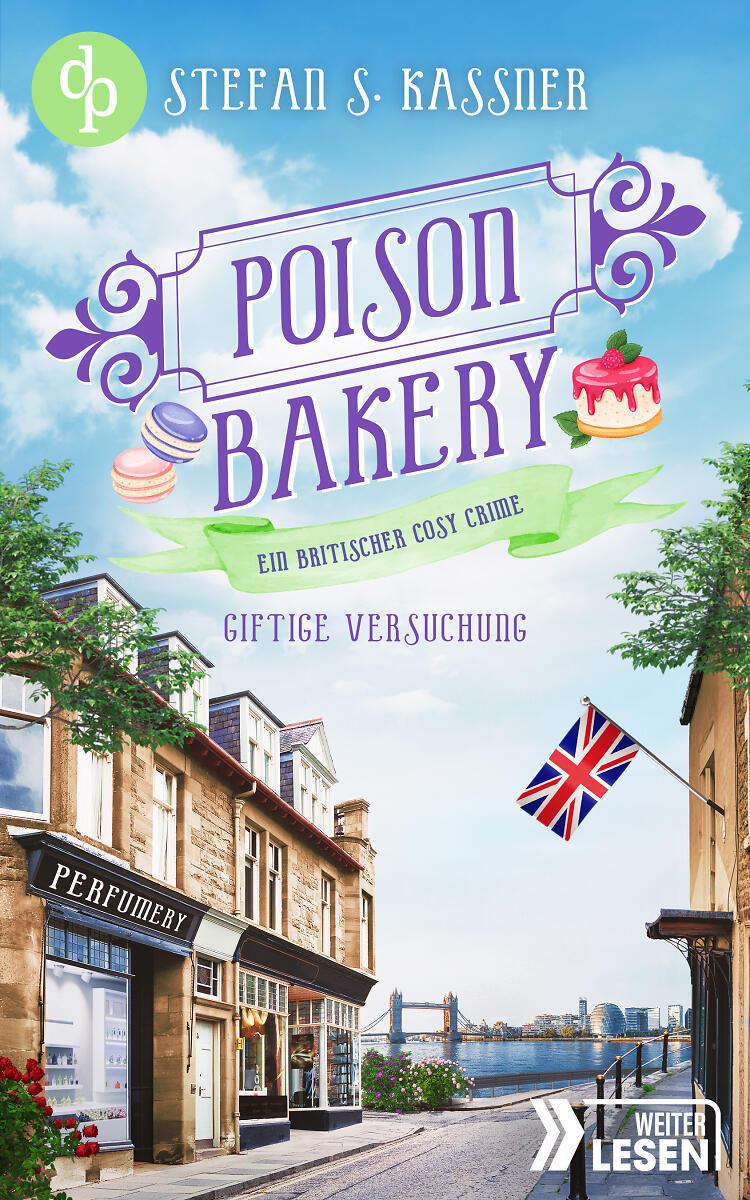Kapitel 1
„Zwischendurch muss er mal wieder den Checker raushängen lassen, damit niemand seine Männlichkeit infrage stellt.“ Aron streicht Shaun über die Wange und grinst verschmitzt dabei.
Nicht zum ersten Mal heute Abend möchte ich die beiden fest an mich drücken. Der Ausdruck in Terrys Gesicht sagt mir, dass es ihr ebenso geht.
„Ich gehe mal Nachschub holen.“ Ich deute auf die leere Weinflasche, die ich vom Tisch genommen habe.
„Ich helfe dir.“ Terry steht auf und folgt mir zur Theke.
Endlich halten wir das längst überfällige WG-Treffen ab, was auf bestem Wege ist, zu einer Party zu werden. Gott sei Dank haben wir uns dazu entschieden, die Feier im Café abzuhalten, in unserer Küche würde der Platz bei sieben Personen knapp sein. Denn unsere WG-Jungs Shaun und Randall vergrößern durch ihre jeweiligen Partner Aron und Gaby die Runde und natürlich ist auch Philipp, Terrys Freund und meine vorherige On-Off-Affäre, mit von der Partie. Nicht nur aus diesem Grund eine schwierige Angelegenheit für mich, sondern auch, weil Terry sich seitdem verändert hat.
Die Freude über Arons und Shauns Glück lässt mich sogar die Bitterkeit schlucken, dass ich die Ursache für eine ungerade Teilnehmerzahl dieser Zusammenkunft bin. Immer noch erhoffe ich Gewöhnung daran, Single unter lauter Paaren zu sein, doch das Gegenteil ist der Fall.
Heute Abend aber stehen für mich unsere WG-Jungs im Mittelpunkt. Meiner Ansicht nach waren beide noch vor Monaten Meilen von einer festen Bindung entfernt. Und nun sitzen wir hier zusammen. Das Schönste daran ist das Glitzern in den Augen der Jungs und der einende Eindruck, dass diese Beziehungen positiven Einfluss auf sie haben.
„Süß die beiden, oder?“ Terry ist dabei, die Weinflasche zu entkorken.
„Total. Unsere beiden Jungs.“
Terry legt den Arm um mich und schaut mit mir zusammen zum Tisch, an dem Shaun gerade eine Story zum Besten gibt, wie er und Aron auf einer Party oben ohne tanzend für Aufruhr sorgten. Wozu keine ausgeprägte Phantasie notwendig ist, denn es scheint schwer vorstellbar, dass jemand dem Duo widerstehen kann. Egal, ob hetero oder schwul.
„Ist bestimmt nicht einfach, nur von Pärchen umgeben zu sein?“
Ich zucke mit den Schultern. „Ich gönne euch allen …“, beginne ich, aber Terry fährt dazwischen: „Das weiß ich. Das weiß jeder der Anwesenden. Und ebenso, dass es Kacke ist, dann Single zu sein. Also, lass das ruhig zu.“
„Helfen wird es auch nicht.“
„Schon klar, aber wenn du dich nicht mal auskotzt, zumindest mir gegenüber, bekommst du noch ein Magengeschwür.“ Terry drückt mich an sich. „Der Richtige kommt schon noch, ganz sicher.“
„Lass uns zurückgehen, sonst fange ich noch an zu heulen.“
„Sorry. Ich wollte dich nicht aufwühlen.“
Ich winke ab und erspare uns, Terry darauf hinzuweisen, dass sie genau das getan hat. In letzter Zeit führen ihre Versuche, mich aufzumuntern oder mir die Nachvollziehbarkeit meiner Gefühle zu versichern, eher dazu, dass ich mich schlechter fühle. Selbstverständlich ist das nicht Terrys Absicht, aber der Eindruck, dass diese Gespräche mehr der Erleichterung ihres Gewissens als meinem Seelenheil geschuldet sind, lässt sich dennoch schwer abschütteln.
Zurück am Tisch ärgert mich am meisten, dass die Gelassenheit ob des Alleinseins durch Terrys Ansprache passé ist. Denn jetzt komme ich mir einsam vor, vermisse jemanden an meiner Seite, der mir liebevoll durch das Gesicht streicht und mir etwas ins Ohr flüstert, wie Aron es in diesem Augenblick bei Shaun tut. Shauns Gesicht entnehme ich, dass es sich um Schweinereien handelt.
Ich fülle das Glas mit Weißwein und hoffe, dass ich mir die düsteren Gedanken schön trinken oder zumindest betäuben kann. Aron entpuppt sich als Retter, denn er weiß so viele schreiend komische Episoden aus seinem Leben zu berichten, dass wir von einer Lachsalve in die nächste stürzen und die bald nicht mehr verlassen.
Meinen schmerzenden Bauch haltend, kullern mir Tränen die Wangen hinunter, dennoch kann ich nicht aufhören zu giggeln. Den Mitfeiernden geht es nicht anders, und da ich mittlerweile über meinem Körper zu schweben scheine, wird mir klar, dass ich high bin, wie der Rest der Runde.
Ich betrachte die leergegessene Platte mit Brownies und mir schwant, dass Terry dahintersteckt. So wie wir nicht aufhören können zu lachen und immer zusammenhangloser stammeln, vermute ich, dass ihr Cannabis in den Teig gefallen ist. „Was hast du da reingemischt?“, zische ich Terry zu, nachdem ich sie am Arm gefasst habe.
„Ich dachte, das macht die Stimmung etwas lockerer“, flüstert sie und grinst schuldbewusst.
„Das ist nicht in Ordnung.“ Der Gedanke, ob ich eine Szene machen oder zumindest Terry ins Gewissen reden soll, versinkt in der entspannenden Wirkung des THCs. Der Rausch spült die Traurigkeit fort und erreicht, was ich mir gewünscht habe, dass mir meine Einsamkeit egal ist.
Wie viel Zeit in diesem Zustand der Entrückung verstreicht, kann ich nicht sagen. Ebenso wenig, über welche Themen wir philosophieren, sämtlich vom Aussprechenden vorgebracht, als wären es Erkenntnisse, die in ein Lehrbuch gehörten. In der Art wie: „Habt ihr euch mal überlegt, wie viel Kuchen man wegwirft, weil immer Krümel bleiben? Wenn man die sammeln und daraus neue Kuchen machen würde, könnte man viel Geld verdienen.“
Irgendwann ebbt die Leichtigkeit ab, und es zeigt sich, dass ein Rausch, egal, wie er verursacht wird, nichts wegspült, sondern allenfalls zudeckt. Und dass dieser Schutz weggezogen wird, kurz bevor man den Boden der Realität erreicht, um hart aufzuschlagen. Dieser Moment ereilt mich in meinem Zimmer, allein im Bett. Ich heule los, und als mir bewusst wird, dass ich mir nicht einmal Mühe geben muss, leise zu sein, da ich, mal wieder, mutterseelenallein in unserer Wohnung bin, weine ich umso lauter. Mantraartig wiederhole ich den Satz in meinem Kopf, dass der Richtige da draußen auf mich wartet, doch es bleibt eine hohle Phrase, der ich keinen Glauben schenke.
Schließlich übermannt mich der Schlaf und bringt mir einen wirren Traum, in dem ich auf Norah treffe, die noch lebt und über das Geländer der London Bridge klettert, um herunterzuspringen. Ich versuche, auf sie zu zustürmen, doch meine Hände greifen ins Leere.
Geschockt erwache ich, und nach einem Glas Wasser und tiefem Durchatmen gelingt es mir sogar, erneut in den Schlaf zu finden, nur um im folgenden Traum Bruce über den Weg zu laufen, dem ich meine Liebe gestehe. Kaum bin ich damit fertig, taucht Lindsey auf, wirft sich ihm an den Hals, und die beiden küssen sich leidenschaftlich.
Diesem Erwachen folgt kein erneutes Einschlafen. Stattdessen trinke ich einen Tee und greife schließlich zu Baldriantropfen. Damit gelingt es mir endlich, den Rest der Nacht ohne die Dämonen der Vergangenheit zu verschlafen.
Kapitel 2
„Wir haben heute Ruhetag.“ Den verschlafenen Kopf in den Wolken möchte ich die Tür gleich wieder schließen.
„Nur einen Kaffee. Ich störe Sie auch nicht beim Aufräumen.“
Ich hebe den Blick und sehe dem Gast erstmalig ins Gesicht. Grüne Augen, dunkles Haar und ein Dreitagebart, für mich das entscheidende Accessoire für einen Mann. Warum ist mir nicht schon beim Blick zum Eingang aufgefallen, dass er nicht unattraktiv ist? „In Ordnung.“ Ich halte die Tür auf, und der Dunkelhaarige schlüpft an mir vorbei ins Café.
„Hatten Sie eine Feier?“
„So ist es.“ Ich deute auf einen Hocker am Tresen. „Es macht Ihnen nichts aus, Ihren Kaffee dort zu trinken?“
„Ganz im Gegenteil. Ich sitze gerne erhöht.“
Das bringt mich zum Lächeln. „Ich ebenfalls.“
Der Dunkelhaarige lacht. „Und ich befürchtete schon, Sie fragen mich, was das für ein blöder Anmachspruch ist?“
„Ist es das denn?“ Ich hebe eine Braue.
„Was denn?“
„Ein Anmachspruch?“ Staunend höre ich mir selbst zu. Bin ich etwa dabei zu flirten? Und das auf eine Art, die Terry zur Ehre gereichen würde?
Der Dunkelhaarige legt den Kopf schief und grinst mich an. „Vielleicht …“
Ja, er gefällt mir und ebenso, dass er kein Modeltyp ist wie Bruce. Das mag sich gemein anhören, ist aber durchaus positiv gemeint. Zu attraktives Aussehen wirkt einschüchternd. „Dann bin ich gespannt, was Sie sonst noch auf Lager haben.“ Ich gehe hinter den Tresen und klopfe den Siebträger der Kaffeemaschine aus. „Was darfs denn sein. Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato?“
„Cappuccino bitte.“
„Kommt sofort.“
„Sind Sie Terry oder Linn?“, fragt er mit Blick auf den Schriftzug unseres Cafés, der oben an der Wand über der Theke hängt.
„Linn.“
Er streckt die Hand aus. „Conor.“ Nervös lachend, zieht er sie wieder zurück. „Zu förmlich, oder?“
Ich schlucke den frechen Kommentar, ob das ebenfalls ein Anmachspruch ist, runter und sage stattdessen: „Wir können uns auch duzen?“ Mal nicht diejenige zu sein, die die Nervosität lähmt, beflügelt mich.
„Gerne.“
„Bist du auf dem Weg zur Arbeit, Conor?“
„Sozusagen. Wobei es da keinen festen Ort gibt.“
„Das musst du mir genauer erklären.“ Ich serviere ihm den Cappuccino.
„Ich bin Journalist.“
„Hört sich spannend an.“
„Mehr, als es wirklich ist. Ich bin kein Enthüllungsreporter, sondern schreibe eine Kolumne für den Lokalteil. Was sich so in der City ereignet, von der Krankenhauseinweihung bis zum Tanzabend eines Seniorenheims.“
„Es sei denn, der Seniorentanz artet zum satanischen Ritual aus, weil der DJ versehentlich Ozzy Osbourne spielt.“
„Und das rückwärts, womit die geheime Botschaft sich direkt ins Unterbewusstsein bohrt.“
Wir lachen beide.
„Aber im Ernst – es muss nicht immer das große Drama sein.“ Ich streiche mir eine Haarsträhne hinters Ohr.
„Witzig. Genau das sage ich immer, wenn man mich zu meiner Arbeit befragt.“
„Echt?“ Ich sehe in Conors grüne Augen und registriere das Kribbeln im Bauch. „Für mich ist das ein Problem unserer Zeit, dass alles aufgebauscht wird. Als würde es nur noch Katastrophen auf der einen und unglaublich gutaussehende, von Erfolg verwöhnte Menschen auf der anderen Seite geben.“
Conor nickt. „Ganz schön einschüchternd, oder?“
„Total.“
Conor betrachtet schweigend die Milchschaumkrone auf seiner Tasse, und ich frage mich, ob das ein seltsamer Gesprächseinstieg ist, den wir wählten? Doch anstatt wie sonst darüber nachzugrübeln, halte ich es für unwichtig. Diese Unterhaltung nimmt einen natürlichen Verlauf, der von meiner Seite nicht dadurch geprägt ist, mich in Szene zu setzen, um zu gefallen.
„Für welche Zeitung schreibst du denn?“, nehme ich den Gesprächsfaden wieder auf.
Conors Blick wirkt einen Augenblick verloren, als müsse er sich erst wieder bewusst machen, wo er sich befindet. „Sorry, war in Gedanken ganz woanders.“ Er räuspert sich. „Ich schreibe für den London Telegraph.“ Conor sieht sich um. „Aber ich will dich nicht von deiner Arbeit abhalten.“
Ich mache eine wegwerfende Handbewegung. „Die läuft nicht fort. Und ich habe heute ohnehin nicht vor zu öffnen.“
„Nein? Oh sorry, und da dränge ich mich auf.“
„So komme ich zu einer anregenden Unterhaltung.“
Zarte Röte schießt ihm in den Kopf, und das Kribbeln in meinem Bauch meldet sich erneut. Ich bin zwar nicht schockverknallt wie damals bei Bruce, aber Conor weckt definitiv mein Interesse, das zunimmt.
„Dann bin ich froh.“ Die Erleichterung ist ihm anzuhören, was ich niedlich finde. „Und du führst das Café mit einer Freundin, die Terry heißt?“
„Ganz schön scharfsinnig“, entgegne ich. „Man könnte meinen, du bist Journalist.“
„Touché.“ Conor nimmt einen Schluck von seinem Cappuccino. „Ich habe eine Idee. Hättest du Lust, dass ich über dich schreibe?“ Er bemerkt meinen erstaunten Blick und beeilt sich hinzuzufügen: „Nicht über dich als Privatperson, sondern über das Café. Wie du auf die Idee kamst, das Café zu eröffnen, wie dein Alltag aussieht. Womöglich hast du etwas Ungewöhnliches erlebt?“ Er rührt in seiner Tasse. „Wobei das nicht notwendig ist. Es muss ja nicht immer das große Drama sein.“ Er zwinkert mir zu.
Ich will entgegnen, dass ich das mit Terry absprechen und sie ebenfalls im Artikel erwähnt werden muss, doch dann frage ich mich, ob das tatsächlich nötig ist? Ist es nicht an der Zeit, dass ich einen Alleingang vollführe, ohne dass Terry den Ton angibt? „Einverstanden. Ich würde mich freuen.“ Mit einem Lappen wische ich über die Kaffeemaschine. „Und ich habe wirklich schon ein paar außergewöhnliche Geschichten hier erlebt.“
„Das klingt vielversprechend.“
„Ich war sogar Verdächtige in einem Mordfall.“
„Nicht dein Ernst!“
Ich erzähle Conor in groben Zügen vom Pinguin-Fall und genieße sein Erstaunen und die Aufmerksamkeit, die allein mir zuteilwird. Da ich bei der Wahrheit bleibe und Terrys und Philipps Rollen nicht unerwähnt lasse, meldet sich kein schlechtes Gewissen zu Wort, das mich mahnt, nicht als Einzelperson den Ruhm vieler einzuheimsen.
„Wow!“ Conor macht große Augen, als ich am Ende meiner Schilderungen angelangt bin. „Da wird ein Beitrag nicht ausreichen. Ist es okay für dich, wenn ich das mit meinem Chefredakteur bespreche? Wir könnten daraus eine kleine Serie machen, und es ist zugleich kostenfreie Werbung für euer Café.“
„Hört sich super an.“ Einen Augenblick überlege ich, Conor auch von Norah zu erzählen, bin aber nicht sicher, ob ich das möchte. Die Trauerfeier ist zwei Wochen her und milderte den Schmerz ab, der dennoch nicht verklungen ist. Außerdem ist es ein Unterschied, über den Pinguin zu sprechen, zu dem ich keine Verbindung hatte, als über Norah, die mir trotz des kurzen Kontakts etwas bedeutete. Es erscheint mir falsch, das an die Öffentlichkeit zu bringen.
„Cool. Dann melde ich mich bei dir. Am besten gibst du mir deine Nummer?“
Ich muss lachen, und Conor schaut mich fragend an. „Sorry. Ich dachte nur gerade, dass das die beste Anmachmasche wäre, die ich jemals erlebt habe. Wenn es denn eine wäre.“
Conor grinst. „Wäre das nicht schon ein wenig gestört?“
„Zumindest ambitioniert.“
Conor lacht nun ebenfalls. „Treffender Begriff. Du solltest schreiben.“
„Lieb von dir, aber ich bleibe lieber beim Backen.“
„Beim nächsten Mal werde ich einen deiner Kuchen probieren.“ Conor zieht seine Geldbörse aus der Gesäßtasche. „Was bin ich dir schuldig?“
„Du bist eingeladen.“
„Echt? Und dabei hattest du nicht mal geöffnet.“
„Eben. Deshalb werten wir das mal als den Besuch eines Bekannten.“
„Bekannter?“ Conor nickt anerkennend. „Aufgrund der Dauer des Treffens und da es sich um einen Erstkontakt handelt, sehe ich das als Verdienst.“
„Erstkontakt? Irgendwie denke ich da an Ufos und grüne Männchen.“
„Um ehrlich zu sein, manchmal fühle ich mich auch wie eines.“
„Da sind wir schon zwei.“ Der Blick, den wir daraufhin austauschen, lässt mich wohlig erschaudern. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich einfach so jemanden treffe, der mich versteht?
Du solltest nicht zu schnell die dicke Freundschaft wittern, ermahne ich mich.
Conor schaut auf seine Armbanduhr. „Ich muss dann los. Gibst du mir noch deine Nummer?“
„Klar.“ Ich diktiere sie ihm, und er tippt sie in sein Handy, anschließend begleite ich ihn zur Tür, wo wir uns voneinander verabschieden.
Mein Blick geht zur Uhr über dem Tresen. Noch eine Stunde, bis ich hier mit Terry zum Aufräumen verabredet bin. Ein schlechtes Gewissen beschleicht mich, da ich froh bin, dass Terry nicht auf Conor traf. Ansonsten hätte ich mir wieder viele wohlgemeinte Ratschläge anhören können und die wiederkehrende Nachfrage, wie denn der Stand mit Bruce ist.
So bin ich froh, dass ich mir zunächst selbst klar werden kann, was ich möchte. Definitiv hat mich nicht der Blitz getroffen wie bei Bruce. Dennoch gefällt mir Conor, wobei ich derzeit nicht sagen kann, ob sich amouröse Gefühle entwickeln werden, oder er jemand sein könnte, mit dem ich mich anfreunde.
Kapitel 3
„Das glaub ich nicht!“
Einen derartigen Ausspruch aus Terrys Mund zu hören, bedeutet schon etwas, und so folgt mein Blick sogleich ihrem, der sich der Person angeheftet hat, die in diesem Augenblick das Café betritt.
Nach dem gestrigen Tag, der durch Aufräumarbeiten geprägt war, herrscht heute wieder regulärer Betrieb, worüber ich froh bin. Denn so grübele ich nicht ständig über Conor und ob er jemand ist, der eine wichtigere Rolle in meinem Leben einnehmen könnte. Happy bin ich, dass es mir gelang, Terry nichts davon zu erzählen, so dass ich der einzige Mensch bin, der mir selbst gegenüber Rechenschaft ablegen muss.
„Mein Gott, jetzt stell dich doch nicht so dämlich an!“, schallt es zu uns herüber. Der Ausruf stammt von der Person, die sogar Terry zum Staunen brachte: Overknees aus Schlangenleder, rot gelockte Mähne und munter in ihr Handy brabbelnd, das sie vor dem Mund hält und zur Freude aller Gäste auf Lautsprecher gestellt hat.
„Das übernehme ich.“ Terry stürmt auf die Dame zu. „Miss. Das geht nicht.“
Die Rothaarige wirft Terry einen entgeisterten Blick zu.
„Wir haben heute das Treffen einer Migräne-Selbsthilfegruppe.“
Die Frau lässt sich auf einen Stuhl fallen und beendet das Gespräch. „Der versteht es ohnehin nicht. Da ist jedes Wort zu viel.“
„Sie sagen es, zu viele Worte.“ Terry wischt über den Tisch. „Darf ich Ihnen etwas bringen? Ein Headset, Hörgerät oder stilles Wasser?“
Ich gehe auf den Tisch zu, da ich fürchte, einschreiten zu müssen. Dieses Mal geht Terry zu weit.
Die Rothaarige mustert Terry von Kopf bis Fuß, nickt anerkennend und sagt grinsend: „Da hat jemand nicht nur Humor, sondern auch noch Mut. Das gefällt mir.“
Irritiert bleibe ich stehen und registriere erleichtert, dass die Gespräche der übrigen Gäste, die angesichts des Auftritts von Miss Overknees zum Erliegen kamen, wieder aufgenommen werden.
„Ich nehme einen Kaffee und den kalorienreichsten Kuchen, den Sie haben.“ Die Dame lehnt sich zurück und beginnt, auf ihrem Handy herumzutippen.
„Wie Ihr wünscht, Mylady.“ Terry macht einen Knicks, den die Rothaarige nicht mitbekommt und steuert auf mich zu.
„Was ist das denn für Eine?“, zische ich.
Terry begleitet mich zur Theke. „Keine Ahnung. Aber da sie jetzt ruhig ist, kann ich sie schlecht rauswerfen, oder?“
„Stimmt wohl.“ Ich betrachte die Rothaarige. „Diese Stiefel. Schlangenlederoptik, das muss frau sich erst mal trauen.“
„Passt zu ihr.“ Terry öffnet die Kuchentheke und holt die Schwarzwälder Kirschtorte heraus.
Die Lady betrachtet sich mittlerweile in der Selfie-Kamera ihres Smartphones. Ich schätze sie auf Ende fünfzig, doch aus den Posen, die sie Richtung Handy vollführt, das komplette Programm mit Duckface und Klimperaugen, sind selbst Terry und ich herausgewachsen. Um ehrlich zu sein, wir waren ohnehin nie die Typen für diese billige Zurschaustellung.
„An wen erinnert die mich?“, denke ich laut.
„Chlorgas? Das verursacht ein ähnliches Brennen in den Augen.“ Terry stellt die Tasse Cappuccino, die sie zubereitet hat, zu dem Teller mit dem Tortenstück aufs Tablett.
„Natürlich!“, stoße ich hervor, denn soeben glotzt Miss Overknees mit eben jenem Blick in ihre Handykamera, die die Assoziation herstellt. „Die Schlange Kaa.“
Terry sieht mich an, als wäre ich nicht ganz bei Trost, dann umspielt ein Lächeln ihre Mundwinkel. „Aus dem Dschungelbuch? Das passt.“ Sie greift das Tablett. „Dann gehe ich mal die Schlange füttern, bevor sie sich auf unsere Gäste stürzt.“
Terry serviert, und der Betrieb läuft weiter, während mein Blick immer wieder zur Schlange wandert, die unvermittelt aufspringt, um das Café zu verlassen. Meine anfängliche Befürchtung, sie prelle die Zeche, entpuppt sich als Trugschluss. Denn Madame trainiert vor unserem Café ihre Lungen, indem sie eine Kippe nach der anderen gierig inhaliert und synchron in ihr Handy krakeelt.
Ich zähle nicht mit, wie viele Zyklen aus Rausgehen zur Rauch-Brüll-Orgie und enthusiastischem Kuchen- und Kaffeevertilgen die Schlange durchläuft, auf ihrer Rechnung haben sich schließlich drei Stücke Kuchen und sechs Tassen Cappuccino angesammelt, so dass ich hochrechnen kann.
Als sie das Café verlässt, raune ich Terry zu. „War sie auch nur einmal zur Toilette?“
„Hast du ihre Haut gesehen? Die ist so trocken, ich glaube, dass jeder Tropfen Flüssigkeit in ihrem Innern augenblicklich verdampft, da bleibt nichts mehr für die Blase.“
Schräg gegenüber des Cafés ist eine Parfümerie. Keine dieser Ketten, sondern ein edler Laden, der nur Düfte im oberen Preissegment anbietet. Mich überrascht, dass dieses Geschäft eine Frau wie die Schlange anzieht, als ich beobachte, wie sie darin verschwindet.
So unangenehm sie auch war, solch extreme Persönlichkeiten faszinieren mich. Neben der Möglichkeit, meine Backpassion ausüben zu können, ist es der Grund, warum ich das Café mag, das einen Schmelztiegel der Kulturen, Stimmungen und unterschiedlichen Historien bildet. Womöglich hat Conor recht, und ich sollte die Erlebnisse aufschreiben. Ausreichend Material käme definitiv zusammen.
Die Frage, mit wem die Schlange die ganze Zeit telefoniert hat, treibt mich ebenso um wie die, wo sie die drei Stücke Kuchen, die sie verspeist hat, als wäre es die erste Mahlzeit nach einem Hungerstreik, gelassen hat. Doch mit ihrer hektischen Art verbrennt sie im Vergleich zu mir den vermutlich dreifachen Kaloriengehalt. Tauschen möchte ich dennoch nicht, denn sie wirkt zudem wie die Art Frau, die in Bälde an einem Herzinfarkt versterben wird.
Am Ende des Arbeitstages setze ich mich an die Buchhaltung, als das Telefon klingelt. „Hallo?“ Ich lausche angestrengt, kann aber niemanden hören.
In dem Augenblick, als ich auflegen möchte, ertönt ein zartes Stimmchen: „Entschuldigung. Sie sind das doch mit den Kuchen?“
Ich runzele die Stirn. „TerryLinns genau. Wir betreiben ein Café und bieten auch Backen und Lieferung von Kuchen und Torten für Ihre Feier an.“
„Ach, entschuldigen Sie. Ich habe so selten Kontakt mit der Außenwelt, da tue ich mich ein wenig schwer.“
„Kein Problem. Was kann ich denn für Sie tun?“ Dieses Gespräch wird von Sekunde zu Sekunde seltsamer. Was soll bitte „selten Kontakt mit der Außenwelt“ bedeuten?
„Es geht um unsere Schwester Nelly. Sie hat in zwei Tagen ihr zehnjähriges Klosterjubiläum und sich damit eine kleine Feier verdient. Verstehen Sie?“
„Oh, ja.“ Eine andere Entgegnung fällt mir nicht ein. Zumindest schwant mir nun, woher der Anruf kommt. „Sie sind eine der Nonnen aus dem Kloster? Aus dem auch das Blockflötenquartett stammt?“ Bei der letzten Frage muss ich breit grinsen, erinnere ich mich doch an das Penistorten-Armageddon.
„So ist es.“ Die Stimme der Nonne wirkt entspannter. „Das Benediktinerinnenkloster der heiligen Maria Magdalena. Mein Name ist Schwester Agnes.“
„Es freut mich, Sie kennenzulernen, Schwester Agnes.“
„Oh, Sie kennen mich bereits, oder zumindest sind wir uns schon persönlich begegnet. Ich spiele die dritte Blockflöte in unserem Quartett.“
„Natürlich.“ Ich hoffe, das klingt überzeugend. Um ehrlich zu sein, ich habe kein Gesicht vor Augen. Aus den Reihen des pfeifenden Quartetts erinnere ich einzig die gestrenge Edith und Tomatia, alias Pastinaka. Ich vermute, dass es sich bei Letztgenannter um Jubilarin Nelly handelt. „Schwester Nelly spielt die vierte Flöte? Sie stand ganz außen und …“ Die Überlegung, dies unverfänglich zu formulieren, benötigt einen Moment. „Sie spielte besonders inbrünstig.“
„Das ist zutreffend. Nelly legt sich stets heftig ins Zeug. Nicht immer notensicher, jedoch mit dem Wunsch im Herzen, ihre Zuhörer zu erreichen.“
Ich verkneife mir den Kommentar, dass ihr das definitiv gelingt, denn es erscheint unmöglich, die Ohren vor derart hochfrequentem Gefiepe zu verschließen. „Was haben Sie sich denn vorgestellt?“
„Wie bitte?“
„Welche Sorte Kuchen? Oder eine Torte? Schwebt Ihnen eine besondere Form vor?“ Ich hoffe, dass Schwester Agnes nicht auf die Idee kommt, eine Blockflötenform für den Kuchen anzufordern, die dann große Ähnlichkeit mit der Gestalt des Backwerks hätte, welches das Flötenquartett aus dem Konzept brachte.
„Ginge ein Sportwagen?“
„Ein was?“ Mir klappt die Kinnlade nach unten. Mit allem hätte ich gerechnet, aber nicht damit.
Agnes stößt ein nervöses Kichern aus. „Sie sind etwas überrascht?“
„Nun ja …“
„Wir Schwestern sind nicht alle streng traditionell. Natürlich eint uns der Glaube und dass dieser Priorität hat, aber ansonsten haben wir recht unterschiedliche Vorlieben.“
„Und Schwester Nelly haben es Sportwagen angetan?“
„So ist es. Das ist auch unser Plan zu ihrem Jubiläum. Schwester Edith wird das nicht gefallen, aber sei es drum. Nelly tut so viel Gutes, da hat sie sich das verdient. Sie bietet Kurse an für junge Menschen, denen es schwerfällt, einen Job zu finden. Der Benediktinerorden hat sich schon immer kulturell und im Bildungsbereich engagiert, wobei einige von uns, mich eingeschlossen, eher zurückgezogen leben. Nelly aber konnte bereits vielen Menschen auf den Weg helfen.“
Langsam frage ich mich, ob Agnes ihre Klausur überdenken sollte. Erhöhte Mitteilsamkeit, die ich jedoch nicht aufdringlich, sondern vielmehr aufschlussreich empfinde, lässt auf Vereinsamung schließen. „Denken Sie an einen bestimmten Sportwagen?“
„Einen bestimmten?“
„Na, zum Beispiel einen Porsche oder Ferrari?“
„So genau können Sie das umsetzen?“
„Werden uns alle Mühe geben.“
„Nelly erzählt gerne von einem Auto, das sie besaß, bevor sie in unser Kloster eintrat. Ich glaube, das war ein Porsche.“ Eine Pause entsteht, dann fährt Agnes fort: „Ja, ich bin mir sicher. Porsche. 911. Kann das sein?“
„Ich schaue mal kurz nach.“ Ich bewege die Maus, um den Bildschirmschoner zu beenden und tippe dann in die Suchmaske „Porsche 911“ ein. „Den gibt es.“
„Ach, toll. Da wird sie sich freuen.“
„In zwei Tagen?“
„Genau.“
„Dann benötige ich noch die Uhrzeit und die Adresse.“ Ich notiere die Informationen und erfahre zudem, dass Nelly gerne Schokoladenkuchen isst. Nach Beendigung des Gespräches freue ich mich nicht nur auf das Backen, sondern bin auch gespannt darauf, das Kloster kennenzulernen. Ich kann mich nicht erinnern, jemals eines besucht zu haben, so dass sich meine diesbezüglichen Eindrücke auf die „Sister Act“- Filme beschränken. Womöglich schlummert in den Nonnen etwas, das nur darauf wartet, der Kontrolle entzogen und dadurch entfesselt zu werden?