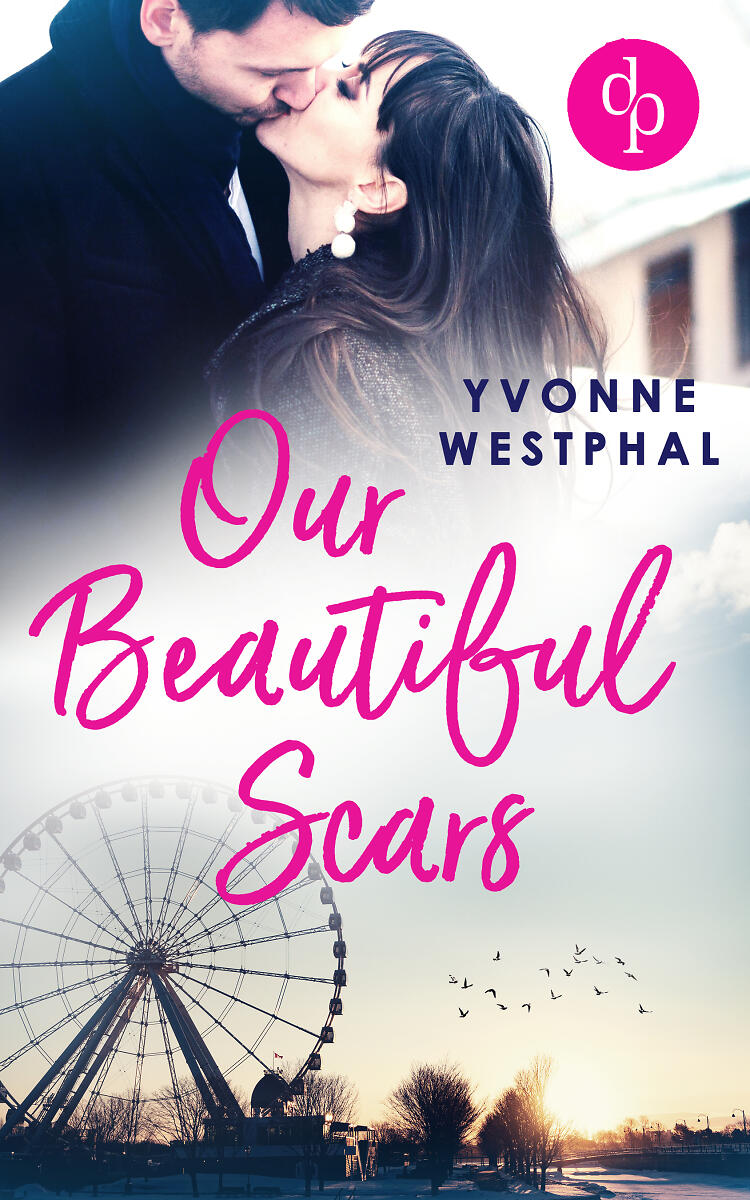1 Wenn Happy Ends enden
Danny
Scheidung.
Das Wort kreiste über meinem Kopf wie ein Schwarm Krähen über einem Schlachtfeld. Meine beste Freundin hatte es noch nicht ausgesprochen, aber das hatte meine Mutter damals auch nicht.
Meine Mutter hatte einfach still und heimlich unser Leben zerstört – oder war es mein Vater gewesen? Wer trug mehr Schuld? Der, der Fehler beging, oder der, der sie geschehen ließ? Der, der die Welt zerstörte, oder der, der nicht um sie kämpfte?
Ich schätzte, am Ende war sich jeder selbst der Nächste, und da war Blut auch nicht dicker als Wasser. Jedenfalls in der Vorstellung meiner Eltern, selbst in der meines großen Bruders.
Aber nicht in meiner Vorstellung.
Und deswegen schwebte mein Daumen über der Wahltaste auf meinem Handy, obwohl ich nichts weniger wollte als diese Nummer zu wählen. Ich hasste telefonieren, und ich war nicht sonderlich scharf auf die Stimme der Person am anderen Ende. Ein Teil von mir wollte streng genommen nicht einmal aufhalten, was sich da vielleicht gerade anbahnte.
Aber der größere Teil von mir konnte nicht tatenlos zusehen. Ich hatte es versprochen, hatte es eidesstattlich bezeugt. Und hier ging es nicht um mich. Hier ging es um jemanden, der mir viel mehr bedeutete als ich mir selbst.
Hier ging es um Nicole. Meine beste Freundin.
Ich atmete tief ein und hielt mir das Handy ans Ohr. In meinem Kopf verwandelte sich das monotone Tuten in einen Countdown zum Beat, den ich im Geiste darunter mischte. Dann versteifte ich mich.
„Hauck Cosmetics, Sie sprechen mit Raphael Thomas.“
Er klang skeptisch. Klänge ich auch, wenn mich jemand an einem Freitagabend um kurz nach zehn auf meinem Firmenhandy anrufen würde.
„Hier ist Daniel.“ Ich verzichtete darauf, meinen vollen Namen zu nennen, weil außer mir ohnehin kaum jemand in Deutschland diesen Vornamen englisch aussprach. Und weil ich meinen Nachnamen hasste, genau wie den Mann, dem ich ihn zu verdanken hatte. Frank Rothe. Den Mann, den unsere Mutter zu unserem Vater auserkoren und an dessen erbärmliches Leben sie uns gekettet hatte, während sie selbst es nur ein paar Jahre mit ihm ausgehalten hatte. Dann hatte sie uns sitzen gelassen, meinen Bruder und mich, und weil mein Vater keine Bilder von ihr besaß, konnte ich mich nicht einmal mehr an das Gesicht der Frau erinnern, die mich geboren hatte.
Aber das Schlimmste war: Ich konnte es ihr nicht verdenken. Ich konnte meine Mutter nicht hassen, nicht so wie meinen Vater. Aber hier ging es nicht um die beiden, hier ging es nicht einmal um mich. Deswegen trommelte ich ungeduldig mit den Fingern gegen die Kante meines Laptops.
Raphael sagte erwartungsgemäß erst mal – nichts. Es war nicht so, dass wir uns verabscheuten, zumindest nicht mehr in dem Ausmaß wie vor sieben Jahren, als wir uns in einem Club geprügelt hatten. Aber Freunde waren wir auch nicht, selbst wenn wir vor rund eineinhalb Jahren Trauzeugen auf derselben Hochzeit gewesen waren. Er als bester Freund des Bräutigams, ich als bester Freund der Braut.
Ich warf einen kurzen Blick durch den dunklen Hausflur zur Badezimmertür, die immer noch verschlossen war. Nicole brauchte sonst nie so lange im Bad.
„Woher hast du diese Nummer?“, fragte Raphael.
Ich klaubte einen Fussel von der Tagesdecke auf meinem Bett, strich nicht vorhandenen Staub von der Tastatur meines Laptops. „Aus dem Internet“, antwortete ich wahrheitsgemäß.
„Ich bin ziemlich sicher, dass diese Nummer nicht im Internet steht“, entgegnete Raphael. Er war zu intelligent, um ihm etwas vorzumachen, also zuckte ich bloß mit den Schultern und schloss den Browsertab mit einer beiläufigen Tastenkombination.
„Wenn man weiß, wo man suchen muss, findet man alles“, erwiderte ich knapp. Aber hier ging es auch nicht um semi-legal beschaffte Handynummern aus schlecht gesicherten Datenbanken. „Hast du in letzter Zeit mal mit Milias geredet?“
Ein gereiztes Stöhnen. „Ich rede ungefähr jeden Tag mit Milias, du müsstest dich schon ein bisschen konkreter ausdrücken.“
Ich unterdrückte ein Fluchen. Raphael gab sich Mühe, aber ich spürte seine Überheblichkeit durchs Telefon hindurch. Er belächelte mich, weil er vom richtigen Ende der Stadt und vom besseren Ende der Gesellschaft kam. Weil er Abitur und Karriere gemacht hatte, in einer teuren Eigentumswohnung lebte und mit einem italienischen Model zusammen war, während ich mit dreiundzwanzig noch zu Hause wohnte. Er glaubte, er wüsste, wer ich war, glaubte wie die ganze verdammte Welt, mich zu kennen.
Raphael wusste einen Scheiß. Genau wie alle anderen.
Ich war nicht mehr der kaputte Junkie von damals, der seine beste Freundin gebraucht hatte, um halbwegs auf sein verpfuschtes Leben klarzukommen. Ich war erwachsen – sofern man das Anfang zwanzig sein kann –, ich war clean und ich war kurz davor, eine halbe Million Abonnenten auf YouTube zu knacken. Nicht dass mich die Zahl irgendwie zu einem besseren Menschen machte, aber die meisten Plattenfirmen und Clubbesitzer – und erschreckend viele Frauen – fuhren halt auf so was ab.
Nein, ich war nicht mehr der kaputte Typ von damals. Und jetzt würde ich für meine beste Freundin da sein, so wie sie an jedem beschissenen Tag für mich da gewesen war. Denn jetzt brauchte sie mich.
Ich glaubte nicht an Märchen und schon gar nicht an Happy Ends. Aber ich würde verdammt noch mal dafür sorgen, dass Nicole ihr Happy Ever After und ihre junge Ehe mit ihrem Traummann behielt. Denn anders als ich glaubte sie an die große Liebe, und sie verdiente alles Glück dieser Welt.
„Wir müssen reden, Raphael.“
Liv
„Du Glückliche! Aaron ist einfach ein Traummann!“, jubelte eine jener mädchenhaften Quietsche-Stimmen, die mir spontanen Brechreiz verursachen konnten und die zu keiner anderen Nagellackfarbe als Pink passten.
Bei dem Gedanken versuchte ich einen kurzen Blick auf meine eigenen Fingernägel zu unterdrücken – und versagte auf ganzer Linie. Mein Kopf tat leider nur selten, was ich ihm befahl. Unzufrieden betrachtete ich also das abgesplitterte Violett, kratzte noch ein bisschen mehr vom Daumennagel und ballte dann die Faust, um die hässlichen Ränder zu verstecken.
Als ich den Treppenabsatz zum Obergeschoss erreichte, in dem unsere Zimmer lagen, quietschte eine zweite Stimme: „Ja, oder? Ich bin so aufgeregt! Das wird das perfekte Happy End unserer Beziehung!“
Jetzt schnaubte ich tatsächlich, jedoch nicht wegen der Tonlage. Ja, Stimmen wie diese waren mein natürlicher Feind, aber nicht diese spezielle Stimme. Denn diese hier gehörte dem einzigen Menschen, der mir noch etwas bedeutete: meiner Cousine Lilly, deren gutmütiges Kichern meine Brust erwärmte, während ihre Worte meine Glieder in Eiswasser tauchten.
Wer hatte eigentlich dieses Märchen vom Happy End in die Welt gesetzt? Ach ja: Märchen. Aufgeschrieben von minnesingenden Romantikern, die entweder noch nie wirklich verliebt gewesen waren oder sadistisch genug, um jungen Mädchen Flausen von der großen Liebe in den Kopf zu setzen. Denn was hatten Träume, Dichter vergangener Zeiten und die große Liebe gemeinsam?
Richtig, sie waren tot.
Und während ich an Lillys halb angelehnter Tür vorbeiging und den Schlüssel zu meinem eigenen Zimmer hervorzog, lagen mir ungefähr ein Dutzend Erwiderungen auf der Zunge. Aber keine davon wollte ich in Lillys Gegenwart aussprechen, denn Lilly war … na ja, Lilly war eine Märchenprinzessin. Die Prinzessin, die ich vor Jahren in mir begraben hatte. Sie war der Inbegriff von Gutmütigkeit, von Sanftmut und Liebe.
Und sie war nicht allein.
„Also, wenn du das anziehst, dann wird es zwar ein Ende, aber nicht unbedingt ein glückliches“, höhnte die andere Stimme, die zu Jessica Schneider gehörte, der selbsternannten Abschlussballkönigin aus Lillys Jahrgangsstufe. Sie selbst nannte sich Queen Bee. Ich nannte sie Queen Bitch. Die Abneigung beruhte auf Gegenseitigkeit.
Und obwohl ich es besser wusste – wie gesagt, mein Hirn kooperierte nicht so gern – und ich Lillys Nachmittag nicht versauen wollte, blieb ich nun doch stehen und drückte die weiße Kassettentür zu Lillys puderrosa Feenreich auf. Was ich sah, ließ mich kurzzeitig den Kaugummi in meinem Mund vergessen.
„Was ist denn hier los?“
Meine Cousine war nackt.
Na ja. Fast nackt. Sie trug Unterwäsche. Fliederfarbene Spitzenunterwäsche, die mit einem weißen Schleifenband akzentuiert war. Sie sah hübsch aus. Aber Lilly sah immer hübsch aus, mit den vollen rostroten Locken, die ihr fast bis zum Po reichten, und der hellen Haut, die anders als bei den meisten Rothaarigen nicht von Sommersprossen übersät, sondern milchweiß war. Genau wie meine. Bloß, dass sie damit unschuldig und rein aussah, während sich mein Teint meist auf einer Skala zwischen totem Schneewittchen und Frankensteins Braut bewegte.
„Wonach sieht’s denn aus? Wir machen uns schick für die Party gleich! Was du wüsstest, wenn du auch manchmal unter Leute gehen würdest. Aber ich schätze, für beides braucht man Freunde.“
Als hätte meine Erscheinung irgendeinen Einfluss auf die Anzahl meiner Freunde, ließ Jessica einen vielsagenden Blick über mein Outfit wandern, von meinen selbst bemalten Chucks über die zerrissene Jeans und das schwarze Tanktop bis zu dem Dornentattoo, das sich um meinen linken Oberarm wand wie ein Armreif. Ich hatte es selbst entworfen. In doppelter Hinsicht.
Ich ließ Jessicas Beleidigung – die ausgesprochene und alle unausgesprochenen – an mir abprallen und machte mir nicht einmal die Mühe, ihr zu antworten. Obwohl mir durchaus ein halbes Dutzend Erwiderungen auf der Zunge lag, einschließlich der, dass – apropos Freunde – ihr fünf Jahre älterer Exfreund Tobias richtig mies im Bett war. Aber anstatt ihr das unter die Nase zu reiben, begnügte ich mich damit, mich in den Türrahmen zu lehnen, ihr ungerührt in die Augen zu sehen und demonstrativ eine Kaugummiblase platzen zu lassen.
Jessica hielt meinem Blick keine zwei Sekunden lang stand, und ich ließ den meinen befriedigt zu Lilly wandern, die mich fröhlich begrüßte.
„Liviii! Findest du etwa auch, dass ich das heute unmöglich anziehen kann?“
Ich versuchte angesichts der schrecklich verniedlichten Koseform meines Namens keine Miene zu verziehen, während sie mit beiden Händen über ihren halbnackten Körper gestikulierte.
„Das ist Unterwäsche“, teilte ich ihr mit. „Ich würde halt noch was drüberziehen, aber das ist deine Sache.“
Jessica schnaubte, doch ich ignorierte es, weil Lilly fröhlich grinste. Und das war alles, was zählte.
„Danke für den Tipp, Liv, hilfreich und charmant wie immer!“ Sie knickste leicht. Lilly knickste immer, wenn sie sich bedankte. „Aber glaubst du, es würde Aaron gefallen?“
Meine Augenlider fielen halb zu. Daher wehte also der Wind. „Du willst mit Aaron schlafen? Im Club, oder was?!“
„Nein, natürlich nicht im Club“, protestierte Lilly und errötete leicht. Es würde ihr erstes Mal sein. „Aber wir fahren danach bestimmt noch zu ihm.“
„Mit all seinen Kumpels“, stellte ich tonlos fest. Nur über meine Leiche. Aaron war zwar ein netter Kerl und schon seit Februar mit Lilly zusammen – also fast neun Monate. Trotzdem waren meine Augen kaum mehr als Schlitze und meine Stimme ein tonloses Grollen. Wenn es um Lillys Unschuld ging, war ich bereit bis zum Äußersten zu gehen.
Was ich streng genommen auch getan hatte …
Entschlossen schob ich den Gedanken beiseite und schluckte den plötzlichen Kloß im Hals hinunter. Er hinterließ ein furchtbares Kratzen und das Gefühl, gleich zu ersticken. Erst da fiel mir auf, dass ich den Kaugummi mit runtergeschluckt hatte. Ich hustete angewidert.
„Duh, natürlich mit seinen Kumpels!“, nahm Jessica Aarons Verteidigung zum Anlass, mich wieder zu attackieren. „Die meisten Leute feiern ihren Geburtstag wie normale Menschen mit Sozialleben: zusammen mit ihren Freunden.“ Ihre Worte prallten an mir ab wie Gummigeschosse an einem Kampfpanzer.
„Jessi, lass das!“, wisperte Lilly und fragte dann mich: „Warum kommst du nicht mit, Liv?“
Ich schnaubte. Wenn sie gerade versuchte, uns mit diesem Vorschlag zu einem Waffenstillstand zu bewegen, sollte sie beruflich wohl besser nie die diplomatische Laufbahn einschlagen. Aber Lillys Miene war so hoffnungsvoll, dass ich den Blick abwenden musste, um meine Gefühle unter Kontrolle zu halten.
Ich ging nicht auf Partys. Schon gar nicht in diesen Szene-Clubs, denn die Musik war miserabel, die Drinks überteuert, und der Abend endete immer nur damit, dass mein Kopf all meine Abwehrmechanismen überlistete und einen Film abspielte. Immer und immer wieder denselben, so lange, bis ich die Filmrolle einfach zerschnitt. Ich war nämlich auch ziemlich gut darin, meinen Kopf zu überlisten. Leider brauchte ich dafür meistens Unterstützung nicht ganz gesundheitsfördernder Substanzen, und wenn Sandro mich noch mal halb ohnmächtig aus einem Club zerren müsste … Das wollte ich ihm nicht antun. Sandro war der einzige wirkliche Freund, der mir noch geblieben war. Obwohl er gegen dieselben Dämonen kämpfte wie ich – und mindestens genauso oft verlor.
„Nein, danke.“
„Bitttteee!“ Plötzlich kniete Lilly vor mir und streckte mir die Hände entgegen wie Maria Magdalena vor Pontius Pilatus. „Dann kannst du selbst dafür sorgen, dass sich alle Jungs benehmen! Bodyguard Liv zur Stelle!“ Sie salutierte kichernd, so wie ich es ihr seit Jahren vorgemacht hatte, und brachte mich tatsächlich ein wenig zum Lächeln.
Jessica lachte höhnisch. „Weil du sie sonst in stilechter Gothic-Psychobraut-Manier umbringst, oder was?“
Ich lächelte zuckersüß und steif wie Chucky, die Mörderpuppe. „Glaub mir, wenn irgendjemand ihr wehtut, bringe ich ihn nicht nur um. Ich sorge dafür, dass man seine Leiche nicht mehr findet.“
Jessicas Lächeln verblasste zu einer irritierten Grimasse. Ich starrte sie so lange nieder, bis sie sich in die Ausrede flüchtete, eine Freundin abholen zu müssen, ihre Lackhandtasche ergriff und sich mit zwei übertriebenen Wangenküssen von meiner Cousine verabschiedete.
„Treffen um elf, Honey?“
Lilly nickte und Jessica versuchte sich an mir vorbeizudrängeln, aber ich machte ihr nicht einen Zentimeter Platz. Schließlich rempelte sie mich zischend an und floh die Treppe hinunter.
Lilly warf mir einen tadelnden Blick zu, während sie sich nachdenklich ein tannengrünes Kleid vor die Brust hielt. „Du könntest ruhig ein bisschen netter sein.“
„Nett ist auch nur der kleine Bruder von scheiße“, erwiderte ich. Lilly lachte und schüttelte den Kopf, während sie ein violettes Top mit für ihre Verhältnisse ziemlich tiefem Ausschnitt aus dem Schrank zog und dazu einen senfgelben Minirock mit hoher Taille auswählte.
Ich hielt ihr eine Strumpfhose hin. „Es ist eisig draußen.“
Es war ja auch fast November, eine Woche vor Halloween.
Da fiel sie mir unvermittelt um den Hals, halbnackt wie sie war. „Danke, Livi. Für alles!“
Aus Reflex versteifte ich mich. Ich hasste Körperkontakt. Doch bei Lilly kämpfte ich den Reflex nieder und erwiderte ihre Umarmung. Lilly lächelte mich an und ließ sich aufs Bett plumpsen. Ich setzte mich neben sie.
„Es bedeutet mir viel, dass du heute mitkommst. Um ehrlich zu sein, bin ich echt ein bisschen nervös, aber ich bin bereit. Glaube ich jedenfalls.“ Sie verzog das Gesicht. „Es tut nicht weh, oder?“
Ich verdrängte tausend Erinnerungen und zwang ein Lächeln auf mein Gesicht, während ich erneut in ihre schokoladenbraunen Augen sah. Noch etwas, das wir teilten. Milchweiße Haut und schokoladenbraune Augen. Bloß dass Lilly rote Haare hatte wie ihr Vater, und ich fast schwarze wie unsere beiden Mütter.
„Aaron wird dir nicht wehtun“, sagte ich entschlossen. Ich streckte die Hand aus, um ihr eine Strähne hinters Ohr zu streichen.
Sie schlug erleichtert die Augen nieder, riss sie dann sofort wieder auf und rutschte noch näher an mich heran. „Und er kriegt keinen Ärger, oder? Ich meine, ich bin schließlich fast achtzehn und wir sind zusammen und –“
„Keine Sorge, er kriegt keinen Ärger.“, beruhigte ich sie, während meine Gedanken kurz in die Vergangenheit abschweiften. Ich lächelte schmerzlich – und erstarrte jäh, als ich ihren Stiefvater Hagen im Flur stehen und ins Zimmer starren sah. Ins Zimmer auf meine unschuldige Cousine, die in Unterwäsche auf ihrem Bett saß! Wie von einem Feuersturm erfasst sprang ich auf, versperrte ihm das Blickfeld und starrte ihn nieder, während ich den Satz beendete: „Er ist schließlich dein Freund und nicht dein Vormund!“
Ich bohrte meine Augen noch fünf wütende Herzschläge lang in die von Hagen, bis seine Mundwinkel zuckten. Er hob demonstrativ friedfertig die Hände aus den Taschen seiner teuren Chinos, aber mein Gesichtsausdruck blieb kalt wie Stahl, bis er die verzierte Treppe in den zweiten Stock erklommen hatte, in dem sein Arbeitszimmer lag. Dann schlug ich die Tür so heftig zu, dass es beinahe vom Stuck an der Decke rieselte, setzte ein Lächeln auf und drehte mich zu Lilly um.
„Und das kannst du mir glauben. Ich weiß, wovon ich spreche.“
Immerhin war mein letzter Freund mehr als fünf Jahre älter als ich gewesen. Wieder glitten mein Blick und meine Gedanken ab. Vielleicht war eine Party doch keine so schlechte Idee. Hoffentlich war die Musik gut. Wie viel Geld hatte ich noch in meinem Zimmer? Egal, Stefanie würde uns bestimmt etwas leihen.
Stefanie war Lillys Mutter, meine Tante, in deren Haus ich seit fast zwölf Jahren wohnte. Sie war Immobilienmaklerin und hatte zweimal ziemlich gut geerbt, weswegen Geld keine unserer Sorgen war. Und genau wie ihre Tochter war sie ein herzensguter Mensch. Aber als ich vor zwölf Jahren meine Mutter verloren hatte, hatte sie damit ihre Schwester verloren. Und als dann vor sieben Jahren auch noch ihr Ehemann gestorben war, war sie genauso zerbrochen wie ich.
Meine gesamte frühe Jugend lang hatten wir drei uns wie Charlies Engel allein durchgeschlagen und waren damit wirklich glücklich gewesen. Zumindest hatte ich das gedacht. Aber Stefanie hatte sich mit Anfang vierzig noch nicht bereit gefühlt, Beziehungen abzuschwören, und weil sie eine schöne, kluge und recht wohlhabende Frau war, hatte sie auch schnell wieder jemanden gefunden. Ein Dutzend Martins, Thorstens, Stefans und Bernds waren gekommen und gegangen, die ich mal mehr, mal weniger gemocht hatte. Dann hatte sie den attraktiven, schmeichlerischen – und zehn Jahre jüngeren – Architekten Hagen kennengelernt, der mit seinen sechsunddreißig Jahren und dem narzisstischen Blender-Charme eher einem großen Stiefbruder als einem Vater-Schrägstrich-Onkelersatz glich. Aber das war mir scheißegal! Fakt blieb: Er war doppelt so alt wie Lilly und inoffiziell ihr Stiefvater. Und Fakt Nummer zwei: Ich hasste es, wie er sie ansah.
„Ja, ich weiß, dass du mit einem fünf Jahre älteren Gesetzeshüter zusammen warst, aber bitte keine Details! Ich will mein Bild von Polizisten nicht ruinieren“, kicherte Lilly und katapultierte mich aus den düsteren Gedanken mitten in den Vorhof der Hölle. Bevor ich es verhindern konnte, sank ich in mich zusammen. Wie konnte man jemanden so sehr vermissen? Sein Tod war zweieinhalb Jahre her! Länger als wir uns überhaupt gekannt hatten. Und immer noch fühlte sich meine Brust an, als würde meine Lunge jeden Moment kollabieren. Einfach jede Funktion einstellen. Wie seine damals.
Ich schüttelte fassungslos den Kopf. Der richtige Mensch braucht nur einen Moment, um dein Herz zu berühren. Der falsche Umstand nur eine Sekunde, um dein Herz zu zerfetzen. Aber dein Herz braucht ein ganzes Leben, um wieder zu heilen.
Falls es das überhaupt jemals kann.
Ich holte tief Luft und brauchte zwei Anläufe, um die Gedanken abzuschütteln. Glücklicherweise bemerkte Lilly nichts davon, weil ihr Herz noch nicht ganz gebrochen war. Sie hatte ihren Vater verloren, aber sie war von ihrer Mutter und ihren Freunden aufgefangen und so sehr geliebt worden, dass es in ihrem Leben schlichtweg keinen Platz für Trauer gab.
Sie freute sich noch auf das Leben. Zum Beispiel auf ihr erstes Mal heute Abend, über das sie immer noch redete, als wäre es die Pforte zum Paradies.
„Das wird so toll! Und mit dir an meiner Seite …“, sie hob glücklich die Arme, „fühle ich mich wie Cinderella mit ihrer guten Fee.“
Sie strahlte, aber mein Lächeln fühlte sich hölzern an.
Ich hasste Märchen. Doch Lilly freute sich auf ihr Happy End, denn sie wusste noch nicht, dass ein Ende niemals glücklich war. Ein Ende tat immer weh. Das Einzige, was noch mehr wehtat, war, ein Ende zu überleben. Weitermachen zu müssen, obwohl nichts mehr übrig war, woran man sich festhalten konnte. Obwohl jeder Mensch, der einem etwas bedeutet hatte, tot war.
Es tat scheiße weh.
„Also schön“, gab ich mich geschlagen. „Ich werde mich auf dieser Party blicken lassen. Hoffentlich ist wenigstens die Musik gut!“
Jetzt bekamen Lillys Augen einen völlig neuen Glanz. „Oh mein Gott, ja! Ich sage nur: D.TresqX!“
„Gesundheit.“
Lilly kicherte. „Hallo?! Erde an Livi, hast du die letzten Monate unter einem Stein gewohnt? Sag bloß, du kennst D.TresqX nicht!“
„Wenn das eine neue Szenedroge ist, bringe ich dich um.“
Jetzt brach sie in Lachen aus, zog sich einen flauschigen Pulli über den Kopf und robbte auf ihrem Bett an den Laptop heran, der auf ihrem Kopfkissen thronte wie eine zusammengerollte Katze.
„Nein, das ist der neue Underground-DJ! Jeder in meiner Klasse hört seine Musik, und das Beste ist einfach, dass er von hier kommt! Aus unserer Stadt! Wie cool ist das bitte?“
Als ich sah, dass sie einen Browsertab öffnete, stand ich mit abwehrend erhobenen Händen vom Bett auf. „Ich will jetzt auf keinen Fall irgendwelche Instagram-Bilder sehen!“
Schlimm genug, dass ich durch Sandros neue Freundin ständig unfreiwillig Kontakt damit hatte. Obwohl, so neu war die auch nicht mehr. Eineinhalb Jahre! Zeit war ein seltsames Ding, flog manchmal so schnell und konnte sich doch so endlos dehnen.
Lillys Kichern holte mich zurück in die Gegenwart. „Keine Sorge, ich zeige dir keine Instagram-Bilder. Er hat da nämlich keinen Account“, fügte sie ein wenig bedauernd hinzu. Dann öffnete sie YouTube, tippte vier Buchstaben in die Suchleiste und bekam sofort ein halbes Dutzend Mal den unaussprechlichen Namen mit verschiedenen Zusätzen angezeigt, die alle auf das Wort Remix endeten.
Ich rollte mit den Augen – die mir kurz danach fast herausfielen, als ich die Aufrufzahlen unter dem Video sah, das sie anwählte. Mein mathematisch unterentwickeltes Hirn brauchte einen Moment, um der achtstelligen Zahl einen Namen zu geben.
„Elf Millionen Aufrufe?!“
2 Von Traumprinzen und Luftschlössern
Danny
„Kacke …“, sagte Raphaels Stimme an meinem Ohr, nachdem ich ihm knapp zusammengefasst hatte, was Nicole gesagt hatte – und insbesondere das, was sie nicht gesagt hatte. „Ich stimme dir zu, klingt nicht, als hätte Milias Scheiße gebaut, und das hätte ich ziemlich sicher auch gemerkt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie sich gestritten hätten. Aber was ist dann los? … Was denkst du, Daniel?“
Ich blinzelte, ein wenig aus dem Konzept gebracht von dieser entwaffnend aufrichtigen Frage. Zupfte an meiner Unterlippe, um meine Finger zu beschäftigen, während meine Gedanken Worte wie Puzzlestücke drehten und wendeten in dem Versuch ein Bild zusammenzufügen, dessen Vorlage ich verloren hatte.
Keine Frage, Nicole war immer noch bis über beide Ohren in diesen Sonnyboy verliebt, dessen charismatisches Lächeln und italienische Bräune ihn schon damals zum Schulschwarm gemacht hatten.
Was ich denke? Ich denke, sie realisiert gerade, dass sie im Begriff ist, ihr ganzes Leben mit ihrem allerersten Freund zu verbringen, und fragt sich, was da draußen wohl noch auf sie gewartet hätte. Aber das sprach ich nicht aus, denn Nicoles intimste Zweifel gingen niemanden etwas an. Ich hatte Raphael lediglich angerufen, um mich zu vergewissern, dass Nicole tatsächlich nur ein bisschen durcheinander war, und nicht doch etwas Ernsthaftes ihre Beziehung bedrohte. Und ich erwog gerade aufzulegen, als Raphael fragte: „Aber sie ist nicht schwanger, oder?“
Ich unterdrückte ein Zischen, während ich blind mein Passwort in meinen Laptop tippte, und dachte im Affekt: Nein, weil die zwei im Gegensatz zu euch wissen, wie man verhütet.
Der Satz lag mir auf der Zunge wie brennende Säure, aber ich schluckte ihn hinunter. Weil es wohl kaum ein Kind auf der Welt gab, das so sehr geliebt wurde wie Valerias und Raphaels Sohn. Und weil das unfair gegenüber allen ungeplanten Kindern dieser Welt war, einschließlich des siebenjährigen Mädchens, das nebenan im Kinderzimmer schlief. Ich warf noch einen Blick in den dunklen, stillen Flur, während ich auf dem Laptop mit einer Tastenkombination mein Musikprogramm öffnete, zweimal Tabulator drückte und fünf Mal die Pfeiltaste betätigte. Ein kurzer Kontrollblick bestätigte mir, dass ich auf der richtigen Playlist gelandet war.
„Nein, Nicole ist nicht schwanger“, antwortete ich kühler als beabsichtigt, während ich Enter drückte und mich vorlehnte, um die Fernbedienung vom Sideboard zu angeln und die Lautstärke der Anlage so weit herunterzuregeln, dass Daisy nebenan nicht aufwachen würde. Dann hörte ich den Schlüssel der Badezimmertür, würgte Raphael mit einem knappen „Wir sprechen später weiter“ ab und warf mein Handy aufs Kopfkissen, bevor Nicole in der Tür erschien.
Einen Moment lang sahen wir uns einfach nur an, wie sich Menschen ansehen, die sich schon ihr halbes Leben lang kennen. Dann lächelte sie missglückt und strich sich die hellblonden Strähnen hinter beide Ohren, wischte mit den Fingern unter ihren Augen entlang. „Ich sehe furchtbar aus, oder?“
Ich lächelte zurück. „Nur wie ein Katzenbaby, das drei Tage lang nicht geschlafen hat.“
Jetzt erreichte der Frohsinn wieder ihre Augen und sie lächelte auf diese Weise, die niedliche Grübchen in ihre Wangen malte. Dann musste sie tatsächlich unterdrückt gähnen. „So fühle ich mich auch, um ehrlich zu sein …“ Sie ließ ziellos den Blick schweifen, der fast automatisch zur Decke wanderte, an die mein Projektor einen sanft wabernden Sternenhimmel warf. Das Dunkelblau, Violett und Türkis verwandelten mein winziges Dachzimmer in die unendlichen Weiten der Arktis voller Polarlichter.
„Hat bestimmt überhaupt nichts damit zu tun, dass du zwei Nachtschichten hinter dir hast“, zog ich sie auf.
Nicole kicherte und ich grinste zufrieden, klappte meinen Laptop zu und schob ihn zurück, damit sie sich setzen konnte. Sie ließ sich gegen meine Schulter sinken und ich legte einen Arm um sie, hielt sie einfach nur fest.
Ein paar Atemzüge lang sagten wir gar nichts, blieben stumm und gaben der leisen Musik Raum, die Stille zu füllen.
Schon nach den ersten Takten regte sich Nicole, hob den Blick und sah mich zwischen Unglauben, Rührung und Wehmut an.
„Ist das …?“
Ich lächelte schwach, nickte. Ja, das war sie. Das war ihre Playlist.
Dieser Mix war acht Jahre alt. Der allererste, den ich jemals gemacht hatte, damals, als sie ihren Opa verloren hatte. Slow Rock, R&B und sanfter Electro Soul, abgemischt auf ruhige 80 Beats per Minute. Damals hatte ich die Lieder noch kaum verändert, nur leicht angepasst, um sie auf ein Tempo zu bringen und nahtlos ineinander zu blenden.
Heute veränderte ich fast alles, jedoch ohne die Seele des ursprünglichen Songs zu zerstören. Takt, Tempo, Tonart. Oft wiederholte ich einzelne Teile oder ließ ganze Strophen aus, blendete zwei, drei, vier Songs und verschiedene Tonspuren ineinander.
Mein Vater hatte gesagt, dass sich das keiner anhören wolle.
Meine ersten Abonnenten auf YouTube hatten gesagt, dass sie meine Mixes in Dauerschleife hörten.
Also hatte ich angefangen, mehrstündige Mixes hochzuladen. Mehr Songs, mehr Instrumente, mehr eigene Noten. Immer noch mixte ich Rock mit Elektro, und am liebsten harten Alternative Rock und Nu Metal mit EDM, so unvorstellbar das für die meisten auch klang. Bis sie es hörten.
Aber immer noch war kein Mix so ehrlich wie dieser hier. Weil kein Mix so persönlich war. Weil kein anderer Mix für einen Menschen war, der mir etwas bedeutete.
Genau wie damals lösten die gefühlvollen Gitarren und der sanft-energische Beat ihre verkrampften Muskeln, machten ihren Körper und ihre Seele empfänglich für die Emotionen, die Musik vermitteln konnte. Wiegte sie in den Armen des Takts und baute sie auf, trug sie davon und brachte ganz allmählich das Strahlen zurück auf ihr Gesicht, bis sie genügend Endorphine gesammelt hatte, um aus eigenem Antrieb mit zu wippen.
Nicole kannte jede Note, jeden Beat dieser achtundvierzig Minuten genauso gut wie ich, summte jede Melodie leise mit.
Als sie sah, dass ich sie beobachtete, wie sie im Sitzen auf meiner Bettkante tanzte, stieß sie mich spielerisch an und kicherte. Dann stützte sie sich nach hinten auf die Unterarme und schaute zu den langsam tanzenden Lichtpunkten an meiner Decke. Und wieder saßen wir stumm nebeneinander, lauschten einfach nur der Musik, genossen die Gesellschaft des anderen und hingen unseren Gedanken nach. Eben die Art von Vertrautheit, die man nur mit Geschwistern und besten Freunden hat. Die Art von Vertrautheit, die ich vor gefühlten Ewigkeiten mit meinem großen Bruder gehabt hatte. Mein Bruder, der ein Loch in meine Seele gerissen hatte.
Ich atmete tief durch, um den Gedanken abzuschütteln, und zog aus Gewohnheit mein Handy aus der Hosentasche, um auf die Uhr zu sehen. Mist, schon kurz vor elf?!
Plötzlich rastlos wischte ich die ungelesene Nachricht unserer gemeinsamen Bekannten Vanessa beiseite, die heute im Club Fotos von mir machen wollte, und schaltete das Handy wieder aus, wollte die Zweisamkeit noch einen Moment festhalten. Aber Nicole hatte meine Unruhe längst bemerkt und richtete sich auf. „Du musst los, oder? Oh Gott, Danny, dein erster großer Auftritt, das ist so aufregend! Ich wünschte, ich könnte dabei sein …“
Ich fuhr mir durch die Haare, aber sie fielen mir sofort wieder in die Augen. „Ist kein großes Ding“, sagte ich, während es in Wahrheit ein Riesending war. Das Ace war einer der angesagtesten Clubs der Stadt, und wenn das heute gutging, würde ich vermutlich bis an mein Lebensende in Lennys Schuld stehen. Zugegeben, das stand ich auch so schon, weil er mir einen Job besorgt hatte, obwohl ich keinen Schulabschluss hatte, und weil er mich manchmal auf seiner Couch schlafen ließ, wenn ich mal wieder mit meinem Vater gestritten hatte. Er ließ die halbe Welt auf seiner Couch schlafen. Lenny war einer der guten Samariter, von denen es kaum noch welche gab. Ich wollte ihn nicht enttäuschen.
Mein Bein begann zu wippen. Ich merkte es erst dadurch, dass Nicole ihre Hand auf mein Knie legte, um es zu stoppen. Das hatte sie schon immer getan, und immer noch wärmte diese kleine Geste meine Welt wie meine ganz persönliche Sonne.
Abermals strich ich mir die Haare aus den Augen und sah unsinnigerweise noch mal auf die Uhr. Kurz nach elf. Verdammt! Aber ich konnte Daisy nicht allein in der Wohnung lassen. Sie war sieben!
„Ich muss eh auf Frank warten.“
Wo blieb der eigentlich? Er müsste längst von der Spätschicht zurück sein! Wenn er sich heute ernsthaft absichtlich verspätete und sich in irgendeiner Bar zukippte, damit ich den Gig verpasste, dann …
Ich schnaubte, ohne den Gedanken zu vollenden. Nichts würde dann passieren. Machten wir uns nichts vor, ich war schließlich nicht mein Bruder. Ich würde meinen Vater nicht verprügeln und ich würde ihn auch nicht mehr anschreien. Über das Stadium des Rumbrüllens waren wir längst hinweg.
Nein, nichts würde passieren. Bloß noch mehr Enttäuschungen, noch grimmigeres Schweigen und noch tiefere Schluchten zwischen uns.
Ein kurzer Ausdruck des Bedauerns huschte über Nicoles Züge, als sie den Vornamen meines Vaters von meinen Lippen hörte. Sie fand es schade, dass ich ihn nicht Dad nannte, aber damit hatte ich vor langer Zeit aufgehört. Und „Frank“ war immer noch netter als „der Alte“.
„Ich glaube, ich habe vorhin den Fernseher gehört …“, merkte sie dann an.
Ich stand so schnell auf, dass Nicole zusammenzuckte. „Der hätte sich ja auch mal bemerkbar machen können“, ärgerte ich mich und griff nach meinem Laptop auf dem Bett, um ihn zusammen mit meinen Kopfhörern in meinen Rucksack zu stopfen. Dann ging ich zu meinem Schreibtisch, zog ein halbes Dutzend Stecker aus dem Dock und packte sie auch ein. Man konnte nie genug Kabel dabeihaben.
„Vielleicht wollte er dich nicht stören, weil er dachte, du hättest … eine Frau hier?“
Sie kräuselte niedlich die Nase, aber ich schnaubte trotzdem. „Er weiß, dass du hier bist, und er weiß ganz genau, dass du verheiratet bist.“
Nicole schob die Hände zwischen die Knie, und ich kämpfte kurz mit meinen Gefühlen. Kurz darauf setzte ich mich wieder neben sie, und jetzt war ich es, der ihre Hände in meine nahm und ihr Ruhe einflößte. „Willst du jetzt darüber reden?“, bot ich behutsam an.
Sie schüttelte den Kopf, begann aber trotzdem: „Du denkst bestimmt, ich bin total bescheuert. Und irgendwie ist das ja auch bescheuert! Ich meine, ich bin glücklich. Wirklich! Ich bin nur … Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist …“
„Ich schon.“ Nicole sah mich an wie ein Gläubiger den Papst, halb erwartungsvoll ob der himmlischen Verkündigung, halb furchtsam vor der schrecklichen Offenbarung. Ich holte tief Luft und sagte dann, was ich Raphael vorhin nicht gesagt hatte: „Du bist dreiundzwanzig und seit deinem sechzehnten Lebensjahr mit demselben Typen zusammen. Sieben Jahre, überleg mal, das ist ein Drittel deines Lebens!“ Ich schüttelte kurz den Kopf, immer wieder erstaunt über diese beachtliche Zeitspanne. Sieben Jahre waren Daisys ganzes Leben. Wer schaffte so was denn heute noch? Wer schaffte so was überhaupt? Meine Eltern jedenfalls nicht. Dann fügte ich hinzu: „Und Milias war dein erster Freund. Dein einziger Freund. Ist doch klar, dass du dich irgendwann mal fragst, was da sonst noch so ist. Die meisten testen das alles ja schon durch, bevor sie achtzehn werden.“
Nicole zog ihre süße Stupsnase kraus. „Das ist schlecht, oder?“
„Bist du verrückt?! Das ist beeindruckend! Und das sage ich nicht, weil ich euer Trauzeuge war, sondern weil ich wirklich Respekt davor habe, Nicole. Ich mein’s ernst! Ihr könnt verdammt stolz auf das sein, was ihr zwei habt. Wer kann schon von sich behaupten, die Liebe seines Lebens bereits mit sechzehn gefunden zu haben?“
Nicoles smaragdgrüne Augen füllten sich erneut mit Tränen, als sie an einem gerührten Lächeln scheiterte. „Wenn du das sagst, klingt es so … perfekt!“
Ich lächelte, während sich mein Magen zusammenzog. „Vielleicht ist es das auch.“
„Aber warum ist es dann so … komisch?“
Mein Blick glitt ins Leere, während ich hilflos mit den Schultern zuckte. „Vielleicht ist das Leben wie ein Gemälde. Und wir sind zu oft viel zu nah dran, um das ganze Bild zu sehen. Dann sehen wir jeden Bildfehler, jeden falschen Pinselstrich und verlieren uns in den winzigen Makeln. Aber es fällt schwer, einen Schritt zurückzutreten und das ganze Kunstwerk zu bewundern.“
Nicoles Unterlippe begann zu zittern, als sie sich wieder gegen meine Schulter sinken ließ. Ich legte einen Arm um sie und hielt sie einfach nur fest. Das süßeste Mädchen auf der Welt, das in den letzten Jahren zur schönsten Frau geworden war.
„Du kannst es immer noch, Danny …“
Ich blinzelte, schluckte trocken. „Was?“
„Andere Menschen mit Worten heilen.“
Ich hatte plötzlich einen Kloß im Hals. Nicole sah mich traurig an. „Egal wie schlecht es dir geht, du rettest immer zuerst andere. Aber wer rettet dich?“
Ich dachte einen Moment über die Frage nach. Fand die Antwort frustrierend und zuckte mit den Schultern.
„Du weißt doch: schwimmen oder ertrinken“, wiederholte ich, was ich in der Entzugsklinik gelernt hatte. Die Klinik, die ihre Mutter bezahlt hatte. Weil Frank es nicht getan hatte.
Nicole lächelte. Ich lächelte auch: „Ich schwimme, wenn du auch schwimmst.“
Als sie verstand, dass ich damit meinte, dass sie für ihre Beziehung kämpfen sollte, wurde ihr Lächeln breiter. Ich stand auf und zog sie von meinem Bett hoch. Ich war kurz davor, zu meinem eigenen Set zu spät zu kommen.
„Soll ich dich nach Hause bringen?“