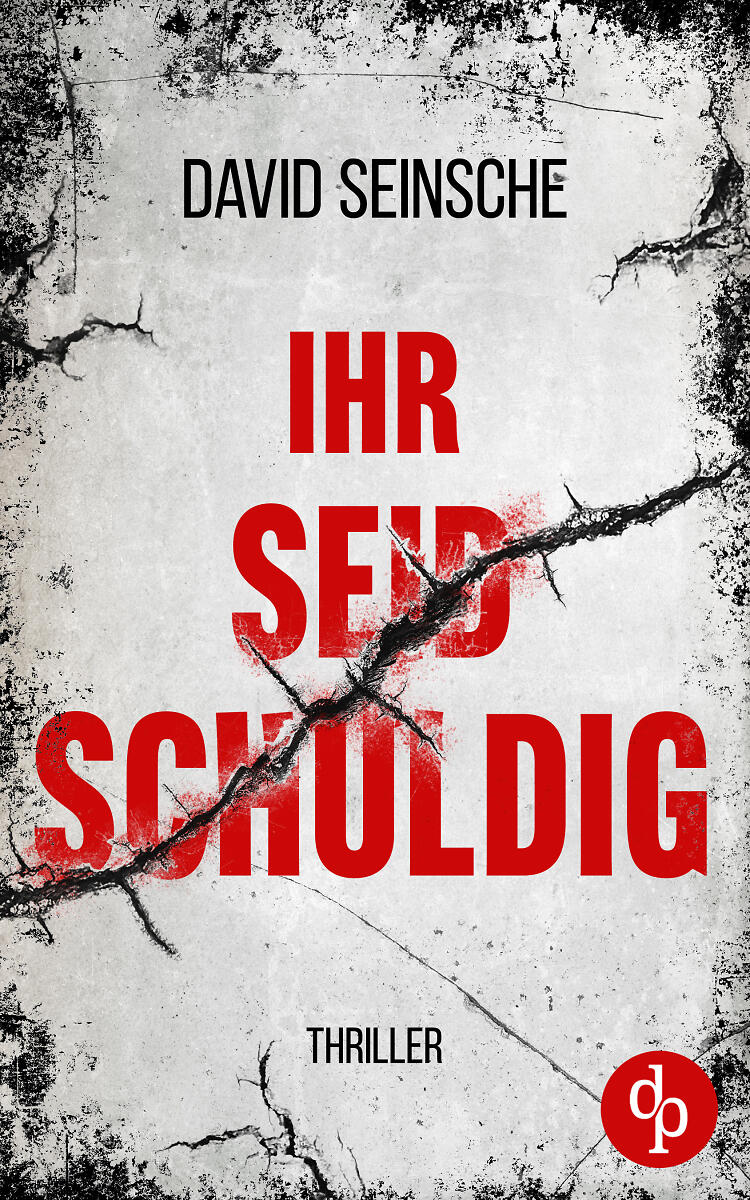Prolog
»In der Verhandlung des Falles Der Staat gegen Jacob Mason wird heute das Schlussplädoyer erwartet«, sprach die Reporterin in ihr Mikrofon. »Danach wird sich die Jury zur Beratung zurückziehen. Zum momentanen Stand ist davon auszugehen, dass Mason in allen Punkten schuldig gesprochen und zur Höchststrafe verurteilt werden wird.«
Die Frau, die an diesem sonnigen Tag vor dem New Yorker Gerichtsgebäude stand und in eine tragbare Kamera sprach, hieß Sharon Powers und war seit bald fünf Jahren als Berichterstatterin tätig. Gemeinsam mit ihr hatten sich noch einige weitere Nachrichtenteams eingefunden, um live für ihre jeweiligen Sender zu berichten. Im Hintergrund befanden sich viele Schaulustige, die den Prozess über die vergangenen Wochen mal mehr, mal weniger intensiv verfolgt hatten. Jacob J. Mason, dreiundvierzig Jahre alt, war seit seiner Verhaftung vor einigen Monaten das Hauptthema in allen regionalen und überregionalen Medien gewesen, denn – zumindest laut der New Yorker Staatsanwaltschaft – war er für nachweislich mindestens drei Vergewaltigungen verantwortlich. Während sich zwei seiner Opfer derzeit in psychiatrischer Behandlung befanden, hatte das dritte Opfer einen drastischeren Weg gewählt und sich in aller Öffentlichkeit mit einem Küchenmesser die Pulsadern aufgeschnitten. Ihr Tod hatte eine Welle der Entrüstung in der größten Stadt der Vereinigten Staaten losgetreten, und nicht wenige hatten für Mason die Todesstrafe gefordert. Der amtierende Bürgermeister der Metropole, ein parteiloser Mann namens Steven Whatney, hatte sich ebenfalls öffentlich geäußert und gefordert, dass die Justiz volle Härte zeigen müsse, um etwaige Nachahmer fernzuhalten. Daraufhin hatten sich einige Kritiker zu Wort gemeldet und erklärt, dass Whatney ihrer Meinung nach viel mehr für die Prävention tun müsse, anstatt jetzt einen Sündenbock für seine verfehlte Politik zu suchen. Alles in allem war die Stimmung in New York sehr angespannt.
»Da kommt er«, erklärte die Reporterin, schob sich eine Strähne ihres blondierten Haares aus der Stirn und wies mit der freien Hand auf einen gepanzerten Wagen, der soeben langsam die Straße herunterfuhr und nur wenige Meter vor dem Haupteingang des Gerichtsgebäudes zum Stehen kam.
Der Kameramann schwenkte herum und fokussierte das Fahrzeug, aus dem nun zwei schwer bewaffnete Polizisten stiegen, bevor der Angeklagte folgte, die Hände und Füße gefesselt. Nachdem die beiden Bewaffneten den Mann in Empfang genommen hatten, stiegen noch zwei weitere Beamte aus. Als sie Mason in ihre Mitte genommen hatten, gingen sie die extra abgesperrte und mit weiteren Polizisten gesicherte Gasse entlang und dann die marmorierten Stufen zum Hauptportal der Justizhalle hinauf. Schaulustige aus allen Richtungen drängten sich so weit wie möglich heran, um einen Blick auf Mason erhaschen und Fotos für die sozialen Medien machen zu können. Einige der Versammelten brüllten lautstark Parolen, in denen die sofortige Exekution des Gefesselten gefordert wurde. Mason selbst blickte stoisch vor sich auf den Boden und schien die ihn umgebende Menschenmasse nicht einmal wahrzunehmen. Am oberen Treppenabsatz angekommen, blickte er kurz zur Statue der Justitia hinauf. Schon seit vielen Jahrzehnten stand diese reglos auf ihrem Sockel, die Augen verbunden, in der einen Hand eine Waage und in der anderen ein Schwert haltend. Er betrachtete die Statue für einige Sekunden, als würde er einen stummen Dialog mit ihr führen, bevor er von den Beamten weitergeschoben und in das Innere des Gebäudes gebracht wurde. Dort wandten sie sich einer breiten, gewundenen Treppe zu, die sie in den im Obergeschoss befindlichen Saal Nummer Vier leitete. Dort, wo die Hauptverhandlung stattfand, war es heute in Erwartung der Schlussplädoyers gerammelt voll. Obwohl die Verhandlung öffentlich war, waren so gut wie alle Sitze mit Pressevertretern besetzt, und an den Seiten und im Mittelgang hatte sich eine Riege Polizisten postiert, um für ein Höchstmaß an Sicherheit zu sorgen. Schließlich war es in der Vergangenheit bereits mehrfach vorgekommen, dass jemand geistig Fehlgeleitetes das Gesetz in die eigene Hand genommen und versucht hatte, die Angeklagten zu ermorden. In den beiden vordersten Sitzreihen hatten sich Angehörige der Opfer eingefunden und beobachteten das Geschehen. Sie hofften, heute Gerechtigkeit zu erfahren. Wie Sharon Powers bereits ausgeführt hatte, wurde aufgrund der Beweislast allgemein damit gerechnet, dass der Fall klar war und die Jury noch am selben Tag das Urteil verkünden würde.
Mason wurde von seinen Bewachern nach vorne gebracht und auf seinen Platz geschoben, wo sich bereits sein Anwalt Peter Wright, niedergelassen hatte und konzentriert seine Papiere sortierte. Als er mit seiner Ordnung zufrieden zu sein schien, neigte er sich zu Mason hinüber. Die beiden tuschelten kurz miteinander, bevor sich der Verteidiger erneut seinen Unterlagen widmete. Mason starrte derweil auf einen Punkt etwa zwei Meter vor sich.
»Erheben Sie sich!«, rief der Gerichtsdiener, ein fast sechzigjähriger untersetzter Mann mit lauter Stimme.
Die versammelten Männer und Frauen stellten umgehend ihre gedämpften Unterhaltungen ein und folgten der Aufforderung, als der Richter der Verhandlung, Walter Higgins, den Raum betrat. In seinem Gefolge traten die sieben Hauptgeschworenen ein und begaben sich an ihre Plätze, einem eigens dafür eingerichteten Bereich zur Rechten des Verhandlungsführers. Higgins war ein dreiundfünfzigjähriger Mann und hatte in den über zwanzig Jahren, die er bereits als Richter diente, Straftäter aller Couleur verurteilt. In Fachkreisen galt er als harter, aber fairer Verhandlungsführer, der sich weder von seinen persönlichen Überzeugungen noch von seiner Stimmung, sondern ausschließlich von den geltenden Gesetzen leiten ließ.
»Nehmen Sie Platz«, sagte er mit seiner sanften, durch ein Mikrofon verstärkten Stimme. »In wenigen Minuten werden wir die Schlussplädoyers hören. Zuvor möchte ich aber sowohl der Anklage als auch der Verteidigung eine letzte Möglichkeit geben, Beweise vorzulegen.«
Er fixierte über seine Brille hinweg zuerst die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, die ihren Kopf allerdings verneinend schüttelte, und wandte sich dann Mason und dessen Anwalt zu.
»Euer Ehren«, sagte Wright. »Ich denke, dass ich für uns alle spreche, wenn ich darum bitte, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren.«
»Und das wäre?«
»Wir können es alle kaum erwarten, diese Verhandlung abzuschließen. Wir alle haben viel Zeit investiert und möchten nach Hause.«
»Sie können jederzeit gehen, wenn Sie müde sind«, erwiderte Higgins süffisant, was ihm ein leises Kichern aus dem Zuhörerbereich einbrachte.
»Ich korrigiere meine Wortwahl«, erklärte der Anwalt geduldig. »Ich für meinen Teil könnte noch Monate hier verbringen, aber ich denke insbesondere an die ehrenwerten Mitglieder der Jury, die sicher erschöpft sind und gerne nach Hause zu ihren Familien und ihrem geregelten Leben möchten.«
»Ihre Fürsorge ist wahrlich rührend«, sagte der Richter ironisch.
»Herr Vorsitzender, wir wissen beide, dass die Staatsanwältin – wie drücke ich es am besten aus? –, sehr ausführliche Plädoyers abgibt. Um zu vermeiden, dass wir uns noch einmal vertagen müssen, bitte ich daher darum, keine neuen Beweise mehr zuzulassen. Des Weiteren ersuche ich um die Erlaubnis, als Erster zu den Geschworenen sprechen zu dürfen.«
»Frau Staatsanwältin, haben Sie Einwände?«
»Keine Einwände, Euer Ehren«, erklärte die Frau, deren auf ihrem Pult platziertes Namensschild sie als Alexandra Gunner auswies.
»Dann legen Sie mal los, Mister Wright«, wies Higgins den jungen Anwalt an.
Wright stand auf, strich über seinen ebenso teuren wie perfekt sitzenden Anzug und betrat dann die freie Fläche zwischen seinem und dem Tisch des Richters. »Euer Ehren«, setzte er mit erhabener Stimme an. »Verehrte Geschworene. Ich werde mich kurzfassen, denn während der Verhandlung wurden bereits alle relevanten und einige nicht relevante Dinge gesagt. Ich werde also nicht darauf eingehen, dass die Staatsanwaltschaft des Öfteren Verhältnisse dargelegt hat, die den Begriff Beweis sehr weit dehnen.«
»Genauso oft haben Sie Einspruch eingelegt«, erinnerte der Richter ihn.
»Und das aus gutem Grund. Schließlich steht hier nicht nur die Integrität meines Mandanten, sondern auch seine Freiheit und sogar sein Leben auf dem Spiel. So wurde zum Beispiel erklärt, dass der tragische Tod von Miss Gordon direkt auf die Ereignisse zurückzuführen ist, wegen denen mein Mandant angeklagt ist. Heute Morgen erfuhr ich allerdings, dass Miss Gordon schon vor der vermeintlichen Vergewaltigung suizidale Tendenzen aufwies. Sie war stark Medikamentenabhängig.«
»Ist das so?«, fragte Higgins.
»Ich habe einige Dokumente, die dies belegen und die ich im Laufe der Verhandlung vorgelegt habe«, erwiderte der Anwalt sachlich. »Außerdem möchte ich noch einmal in aller Deutlichkeit betonen, dass es keine eindeutigen Beweise dafür gibt, dass sich mein Mandant zum Zeitpunkt dieser ohne Frage verurteilenswerten Taten auch nur in der Nähe der Tatorte befunden hat. Dass sich die Opfer, als sie hier vor diesem ehrenwerten Gericht ausgesagt haben, nicht mehr an die genauen Begebenheiten erinnern konnten, geschweige denn daran, wie ihr Peiniger überhaupt aussah, und sie sich obendrein nicht sicher waren, ob es sich wirklich um meinen Mandanten gehandelt hat, der ihnen dieses abscheuliche Verbrechen angetan hat, spricht doch wohl für sich.«
»Ich darf Sie daran erinnern, dass bei den medizinischen Untersuchungen Spermaproben entnommen worden sind, die eindeutig auf Ihren Mandanten zurückzuführen sind.«
»Und ich darf Ihnen im Gegenzug ins Gedächtnis rufen, dass Mister Mason eidesstattlich zugegeben hat, dass er mit den Damen Sex hatte, nachdem er von ihnen unter Drogen gesetzt worden war«, erwiderte der Anwalt. »Es gibt keine eindeutigen Beweise dafür, dass Jacob Mason, Vater eines kleinen Jungen und Ehemann einer bezaubernden Frau, für die ihm zur Last gelegten Taten schuldig gesprochen werden kann. Vielmehr ist er das Opfer einer Verschwörung von drei Frauen. Er wurde hereingelegt. Er wurde missbraucht. Diese Frauen haben ihn hinters Licht geführt und ihn schamlos ausgenutzt. Meine Damen und Herren der Jury, ich bitte Sie eindringlich darum, sich genau zu überlegen, ob Sie tatsächlich einen Unschuldigen, der unsittlich verführt wurde, für die Taten eines anderen verantwortlich machen wollen. Wollen Sie wirklich einen ehrenwerten Mitbürger, der bei allen, die ihn kennen, beliebt ist, um seine Freiheit bringen? Wollen Sie, dass er für viele Jahre eingesperrt wird, während der wahre Täter weiter frei herumläuft und weitere Frauen entwürdigt? Ich bitte Sie eindringlich, auf Ihren Verstand zu hören. Lassen Sie sich nicht von hetzerischen Anschuldigungen leiten. Geben Sie den Vorurteilen der Staatsanwaltschaft keinen Raum. Hören Sie auf Ihr Gewissen. Vielen Dank.«
Wright blickte nacheinander jedem der Jury-Mitglieder in die Augen und setzte sich dann wieder auf seinen Platz. Während Miss Gunner ihr Plädoyer vortrug, beobachtete er weiter die Gesichter der Jury. Einige von ihnen trugen unbewegte Mienen zur Schau, aber bei mindestens der Hälfte der Anwesenden meinte er, zu lesen, dass sie sich mehr damit beschäftigten, was er gesagt hatte, anstatt der Staatsanwältin Gehör zu schenken. Als die Staatsangestellte nach über einer Stunde Monolog schließlich geendet hatte, räusperte sich Richter Higgins vernehmlich und wandte sich dann an die Jury-Mitglieder. »Verehrte Geschworene, da wir nun die Ausführungen beider Parteien gehört haben, ist es an der Zeit, dass Sie sich zurückziehen und darüber beraten, welches Urteil über Mister Mason gesprochen werden soll. Ich bitte Sie, nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden und mich über den Gerichtsdiener informieren zu lassen, sobald Sie zu einem einstimmigen Entschluss gelangt sind. Die Verhandlung ist vertagt.«
Der Richter saß gerade in seinem Büro und biss herzhaft in sein von zu Hause mitgebrachtes Schinken-Käse-Ei-Sandwich, als es leise an der Tür klopfte.
»Herein«, sagte er vernehmlich.
Die Tür öffnete sich und der Gerichtsdiener trat ein.
»Walt, tut mir leid, dich zu stören, aber die Jury hat mich vor fünf Minuten informiert, dass sie sich geeinigt hat.«
»So früh?«, fragte Higgins kauend.
Der andere Mann zuckte mit den Schultern, um zu zeigen, dass es ihm egal war, wie lang oder kurz die Beratungen waren. Er machte diese Arbeit nun schon seit bald vierzig Jahren, und in dieser Zeit hatte er gelernt, keine Fragen zu stellen, sondern ausschließlich seine Aufgaben durchzuführen.
»Nun gut«, sagte der Richter seufzend. »Sag ihnen, dass wir in einer halben Stunde weitermachen.«
»Ist gut«, antwortete der Diener und zog die Tür von außen zu.
Auf die Sekunde pünktlich hatten sich alle Prozessbeteiligten wieder im Sitzungssaal eingefunden. Higgins ließ sich von dem allgemeinen Gemurmel nicht aus der Fassung bringen und entfaltete den Zettel, der ihm soeben ausgehändigt worden war. In Ruhe las er das Geschriebene durch, faltete das Papier wieder säuberlich und legte es neben sich auf das Pult. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand klopfte er mehrfach vernehmlich gegen das vor ihm angebrachte Mikrofon, bis es im Sitzungssaal still war. Die Luft war zum Zerreißen gespannt.
»Die Geschworenen sind zu einem Urteil gelangt«, verkündete er und blickte in die Runde.
»Die Jury ist darin übereingekommen, dass sie es als nicht zweifelsfrei erwiesen ansieht, dass der Angeklagte für die ihm zur Last gelegten Taten zur Rechenschaft gezogen werden kann. Aus diesem Grunde ist Jacob Joseph Mason freizusprechen und mit sofortiger Wirkung aus der Haft zu entlassen. Die Kosten der Verhandlung sowie sämtliche Auslagen der am Prozess beteiligten Personen sind von der Staatskasse zu tragen.«
Er wandte sich direkt an den Angeklagten und blickte ihm tief in die Augen. »Mister Mason, Sie sind ein freier Mann. Sie dürfen nach Hause zu Ihrer Familie.«
Nur eine halbe Sekunde später entwickelte sich ein Tumult im Saal. Die anwesenden Angehörigen der Opfer schrien durcheinander und zwischen den Worten Skandal! und Was für ein Witz! mischten sich noch andere Begriffe, die Higgins dazu nötigten, mehrfach mit seinem Hammer auf das hölzerne Pult zu schlagen.
»Ruhe!«, rief er donnernd in sein Mikrofon. »Wenn nicht umgehend Ruhe einkehrt, lasse ich den Saal auf der Stelle räumen!«
Die Stimmen wurden zwar gleich darauf leiser, waren aber immer noch vernehmlich zu hören, als Mason die Fesseln abgenommen wurden und er von den ihn begleitenden Beamten nach draußen eskortiert wurde. Auf seinem Gesicht hatte sich ein Lächeln gebildet, welches so breit war, dass es fast wie eine Fratze anmutete. Als er an den Angehörigen der Opfer vorbeikam, warf er ihnen einen triumphierenden Blick zu, bevor er durch eine Nebentür nach draußen geführt wurde, um den wartenden Reportermassen zu entkommen.
Noch am selben Abend saß Mason in seiner Stammkneipe und trank bereits den fünften Whisky, während seine Freunde mit ihm am Tisch saßen und ein ums andere Mal auf den Freispruch anstießen.
»Ihr hättet das Gesicht der Staatsanwältin sehen sollen.« Mason kicherte. »Sie war so felsenfest davon überzeugt, mich dranzukriegen, dass ihr vor lauter Schnappatmung fast die Bluse geplatzt ist, als die Jury mich freigesprochen hat.«
»Sieht sie wenigstens gut aus?«, fragte Tom, der zu seiner Linken saß, einen Bierkrug in der Hand haltend.
»Sie ist nicht der leckerste Bissen auf diesem Planeten, aber ich glaube, sie wäre einem ordentlichen Fick nicht abgeneigt«, erwiderte Mason, hob sein Glas und schüttete sich den Inhalt in einem Zug in den Mund, bevor er lautstark rülpste.
»Steve, Nachschub!«, verlangte er beim Wirt, der auch gleichzeitig der Besitzer des Lokals war.
Während seine Freunde über diese anzügliche Bemerkung bezüglich der Staatsanwältin lachten, bemerkten sie den Fremden nicht, der sie von seinem eigenen Platz am Tresen aus beobachtete. Der Mann trug eine Baseballmütze, die so tief in sein Gesicht gezogen war, dass man seine Augen nicht sehen konnte. Die schummerige Beleuchtung der Kneipe tat ihr Übriges, um seine Gesichtszüge vor den Anwesenden zu verbergen. Vor sich hatte er ein Glas Bier stehen, dessen Inhalt schon seit einigen Minuten unangetastet vor sich hin sprudelte. Seit er die Bar betreten hatte, hatte er noch keinen Schluck getrunken.
»Was sagt eigentlich deine Frau dazu, dass du ein freier Mann bist?«, wollte Jason, ein weiterer Trinkkumpan von Mason, wissen.
»Keine Ahnung«, gab der andere zu. »Ich war nur kurz zu Hause, um mich umzuziehen und bin dann gleich losgezogen. Heute Nacht wird sie sich ganz schön wundern, wenn ich komme … und ich beabsichtige, das gleich mehrfach zu tun«, fügte er anzüglich grinsend hinzu.
Seine Freunde lachten erneut und hoben ihre Gläser. »Auf die Freiheit!«, riefen sie im Chor und schütteten sich den Alkohol in die Kehlen.
Es war schon nach Mitternacht, und die anderen Gäste waren längst aufgebrochen. Nur Mason und seine Freunde saßen weiterhin unbeirrt an ihrem Tisch und tranken, was das Zeug hielt. Der Wirt war bereits dabei, den Tresen abzuwischen und die Stühle auf die Tische zu bugsieren.
»Ich schließe jetzt«, rief er zu den noch immer Trinkenden hinüber.
»Noch eine Runde!«, forderte Mason lallend.
»Freunde, es tut mir wirklich leid, aber auch ich muss mich ans Gesetz halten. Ihr bekommt jeder noch einen Shot, und dann war es das für heute.«
»Spielverderber!«
»Es ist, wie es ist.«
Mason murmelte etwas Unverständliches, ließ es aber dabei bewenden, denn trotz seines alkoholisierten Zustands wusste er, dass er ein Hausverbot riskierte, wenn er es zu weit trieb. Nachdem sie ihre Gläser geleert hatten, legten sie einige Dollarscheine auf den Tisch und standen auf.
»Bis morgen, Steve«, verabschiedete sich Mason.
Die Männer schwankten auf die Straße und stimmten zwar falsch, aber dafür voller Inbrunst, ein schmutziges Lied über Frauen und ihre Vorzüge an. Der Mann, der sie seit Stunden in der Kneipe beobachtet hatte, war schon einige Zeit vor ihnen aufgebrochen und hatte sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite nahe eines bereits geschlossenen Gebrauchtwarenladens postiert. Obwohl es zu dieser Stunde noch immer warm war, trug er zusätzlich zu seiner Baseball-Mütze einen Trenchcoat, in dessen Taschen er seine Hände tief vergraben hatte. Er sah ungerührt dabei zu, wie sich die Betrunkenen fröhlich voneinander verabschiedeten und sich in unterschiedliche Richtungen aufmachten. Die einen, weil sie nach Hause wollten, die anderen, um noch weiter um die Häuser zu ziehen. Als Mason allein in Richtung der nächstgelegenen U-Bahn-Station ging, kam Bewegung in den Fremden. Er folgte dem Betrunkenen in einigen Metern Entfernung. Mason stieg in die eingefahrene U-Bahn ein, und der andere Mann tat es ihm gleich, immer darauf achtend, ausreichend Abstand zu halten und unerkannt zu bleiben. Dies war allerdings nicht weiter schwer, denn mit ihnen fuhren noch einige andere Nachtschwärmer mit. An der Station West Vierte Straße, Ecke Washington Square stieg Mason aus. Sein Schatten folgte ihm und ließ ihn nicht aus den Augen. An der Oberfläche angekommen, wandte sich der Freigesprochene nach Osten und ging die Vierte Straße hinab. Der Weg führte die beiden Männer am Washington Square Park vorbei, einer kleinen Grünzone inmitten der Millionenstadt. An einer ausladenden Eiche blieb Mason kurz stehen und schien zu überlegen, bevor er ein wenig in den Park hineinging, und dabei an seiner Hose nestelte. Schließlich schaffte er es, den Knopf und den Reißverschluss zu öffnen. Geräuschvoll erleichterte er sich an einem der zahlreichen Laubbäume, die zu Dutzenden in dem Park wuchsen.
Mason war zu betrunken, um zu bemerken, dass sich hinter ihm die Gestalt näherte. Er nahm auch nicht die im fahlen Laternenlicht glänzende Klinge wahr, die sie in der Hand hielt. Als er einen stechenden Schmerz am Hals spürte, dachte er für einen Moment, von einer Wespe gestochen worden zu sein. Schließlich war es Sommer, und die lästigen Biester tummelten sich überall, wo es etwas Grün gab, selbst im Zentrum von New York City. Als Mason mit einer Hand über seinen Hals fuhr, um sich an der schmerzenden Stelle zu kratzen, spürte er etwas Feuchtes zwischen seinen Fingern. Er sah nach unten und stellte überrascht fest, dass seine Hand Blut überströmt war. Erst jetzt bemerkte er, dass auch sein Hemd feucht wurde. Er versuchte, zu schlucken, aber es gelang ihm nicht, ebenso wenig, wie er atmen konnte. Mason wollte um Hilfe schreien, aber seiner Kehle entrang sich nur ein leises Röcheln. Schließlich versagten ihm seine Beine den Dienst, und er sackte zusammen wie ein nasser Sack. Er zuckte noch einige Male, bevor er still dalag, die Hose geöffnet und sein Geschlechtsteil nach draußen hängend. Der Mann, der ihm von der Kneipe aus gefolgt war, ging in die Hocke und verharrte für einige Minuten so, bevor er die Klinge von beiden Seiten gründlich an dessen Shirt abwischte, sich umdrehte und in der Nacht verschwand.
Kapitel 1
»Guten Morgen Carl«, begrüßte ihn seine Partnerin Nicole Fulton, als er mit einem Pappbecher dampfenden Kaffees in der Hand das gemeinsame Büro des FBI im Jacob K. Javits Federal Building am Federal Plaza im südlichen Manhattan betrat.
»Morgen Nici«, antwortete er.
»Du siehst aus, als hättest du die ganze Nacht durchgesoffen«, merkte sie an, während sie ihn von oben bis unten musterte.
Carl Maddox war ein fünfunddreißigjähriger, hochgewachsener Mann, rund einen Meter fünfundachtzig groß und von sportlicher Figur. Seine dunklen Haare waren halblang und normalerweise sorgfältig nach hinten gekämmt, doch heute standen sie in alle Himmelsrichtungen ab. Sein Gesicht war markant und verlieh ihm das Aussehen eines Models. Nicole Fulton, knapp siebenunddreißig Jahre alt, war hingegen eher von zierlicher Statur und Größe, was sie jedoch durch ihr selbstbewusstes Auftreten mehr als wettmachte. Einmal, als sie und ihr Partner einen ruhigen Moment gehabt hatten, hatte sie ihm erzählt, dass sie in der Grundschule immer zu den Kleinsten gehört hatte und sich entsprechend oft gegen andere Kinder zur Wehr hatte setzen müssen, was sie für ihr weiteres Leben geprägt hatte.
»Hattest du etwa Damenbesuch?«, fügte sie ihrer Anmerkung augenzwinkernd hinzu.
»Wenn du mit Damenbesuch meine alte Nachbarin meinst, die mich auf ein Glas Rotwein eingeladen und dann mit mir zwei komplette Flaschen gekippt hat, bestätige ich das«, erklärte er und ließ sich ächzend auf seinem Bürostuhl ihr gegenüber nieder.
»Die gute alte Wilma«, sagte Fulton seufzend. »Immer für einen Schluck gut.«
Lächelnd erinnerte sie sich daran, wie sie vor einigen Wochen bei Carl zum Abendessen eingeladen gewesen war. Sie waren gerade dabei gewesen, das von ihrem Kollegen zubereitete asiatische Mahl zu verspeisen, als die alte Dame geklingelt und die beiden auf einen, wie sie es nannte, kleinen Umtrunk eingeladen hatte. Wilma hatte bereits die siebenundachtzig Jahre überschritten, war aber noch immer so robust, dass deutlich jüngere Menschen im Vergleich zu ihr wie ein Grashalm gegen eine Eiche wirkten. Nach eigener Aussage war sie noch immer so gut in Schuss, weil sie sich mit Alkohol und Zigaretten konservierte. Nicole bezweifelte zwar, dass es auf Dauer gesund war, jeden Tag zwei Flaschen Wein und eine Stange Zigaretten zu rauchen, hatte es aber vermieden, Widerspruch einzulegen. Schließlich hatte sie die Stimmung nicht trüben wollen.
»Steht heute irgendetwas an?«, fragte Maddox in ihre Gedanken hinein.
»Nein, bisher alles ruhig«, erwiderte sie und lehnte sich zurück. »Hast du eigentlich mitbekommen, dass Jacob Mason gestern freigesprochen wurde?«
»Habe ich«, antwortete ihr Partner und schnaubte verächtlich. »Ziemlich seltsam, dass dieser Typ als unschuldig eingestuft wurde.«
»So ist das eben mit der Justiz. Manchmal werden Entscheidungen getroffen, die für Außenstehende nicht nachvollziehbar sind.«
»Guten Morgen«, grüßte ihr Vorgesetzter, ein gestandener Mittfünfziger namens Frank Lauders, der unbemerkt an den Tisch der beiden Beamten getreten war.
»Guten Morgen, Frank«, antworteten Maddox und Fulton wie aus einem Munde.
»Schon das Neueste gehört?«, wollte Lauders wissen.
»Sie meinen, dass Mason auf freiem Fuß ist?«, fragte Maddox zurück.
»Das ist schon kalter Kaffee«, sagte ihr Vorgesetzter und winkte ab. »Die neueste Meldung ist, dass der Kerl heute früh tot aufgefunden wurde.«
»Wirklich? Was ist passiert?«
»Anscheinend wurde er ermordet. Die Halsschlagader wurde sauber durchtrennt.«
»Autsch.« Maddox fasste sich unwillkürlich an seinen eigenen Hals.
»Das ist aber noch nicht alles«, fuhr Lauders fort. »Derjenige, der ihn auf dem Gewissen hat, hat ihm auch gleich noch das Geschlechtsteil abgeschnitten und es ihm in den Mund gestopft.«
»Dürfte ein interessanter Anblick gewesen sein«, kommentierte Fulton. »Also wurde Mason nicht zufällig ausgewählt.«
»Wie kommen Sie darauf?«, fragte ihr Vorgesetzter in unschuldigem Ton.
»Warum sonst sollte er seinen eigenen Pimmel im Mund haben?«, erwiderte sie.
»Genau da kommen wir ins Spiel«, erklärte Lauders. »Oder genauer gesagt, Sie beide. Ich möchte, dass Sie sich der Geschichte annehmen. Sie haben doch gerade nichts Wichtiges am Laufen, oder?«
»Nope«, antwortete Maddox.
»Gut. Dann legen Sie mal los. Ich überlasse es Ihnen, wie Sie vorgehen wollen. Sie beide sind erfahren genug, dass Sie keinen Babysitter brauchen.«
»Haben wir eine Deadline, bis wann wir Ergebnisse vorlegen müssen?«
»Momentan sieht es für die Öffentlichkeit einfach nur nach einem weiteren Toten aus. Wir konnten die Details aus der Presse raushalten. Die wissen bisher nicht einmal, dass es sich um Mason handelt. Sie haben also etwas Zeit.«
»Hoffen wir, dass es so bleibt«, erklärte Fulton.
Sie und ihr Partner hatten in ihrer gemeinsamen Karriere schon des Öfteren mit der Presse zu tun gehabt, und in den allermeisten Fällen war es darauf hinausgelaufen, dass ihre Ermittlungen durch übereifrige Reporter gefährdet worden waren. In einem Fall hatten sie sogar einen Zugriff verschieben müssen, weil ein Journalist den Verdächtigen gezielt gewarnt hatte.
»Viel Spaß«, wünschte Lauders und schickte sich an, zurück in sein Büro zu gehen.
»Wissen wir denn mit Sicherheit, dass es sich um Mason handelt?«, rief ihm die Agentin hinterher.
»Sofern es nicht zwei Menschen in New York gibt, die eine Lilie mit den Buchstaben JM auf der linken Backe tätowiert haben und sich das gleiche Gesicht teilen, sind wir sicher.«
Mit diesen Worten ging Lauders zurück in den hinteren Teil des Raums, wo sich hinter einer Milchglastür sein eigenes Büro versteckte.
»Wo befindet sich der Tatort?«
»Washington Square Park«, rief der Vorgesetzte und ließ die Tür hinter sich zufallen.
Maddox stand auf und richtete seine Kleidung. »Wollen wir?«, fragte er seine Partnerin.
»Auf geht´s«, erwiderte diese.
Zu Fuß war es zu weit, und wer New York kannte, fuhr nicht mit dem Auto über die dicht befahrenen Straßen Manhattans, vor allem nicht am Vormittag. Daher entschieden sie sich, zur wenige Hundert Meter entfernten Church Street zu gehen und von dort aus mit dem Bus auf direktem Wege zu ihrem Zielort zu fahren. Obwohl zur morgendlichen Rushhour viele Menschen unterwegs waren, schafften sie es, noch zwei Sitzplätze im vorderen Bereich zu ergattern, als der Bus auch schon anfuhr und sich auf der eigens für ihn eingerichteten Spur an den sich stauenden Autos einfädelte.
»Wie geht es deinen Eltern?«, fragte Fulton.
»Wie immer«, antwortete Maddox. »Dad bastelt mal wieder an irgendetwas herum, Mom liest Krimis und regt sich darüber auf, wie sehr die Bücher von der Realität abweichen. Sie meckert immer, dass Ermittlungen in Wirklichkeit nur aus wenig Action und dafür mehr aus Papierkram bestehen. Außerdem nervt es sie, dass die Ermittler in den Büchern immer abgehalftert sind, ihre Ehe den Bach runtergeht, sie sich dem Alkohol hingeben und dennoch mit Brillanz jeden Fall lösen.«
»Ist deiner Mutter denn nicht klar, dass kein Mensch von Ermittlern lesen will, die ihr Leben voll im Griff haben?«, gab seine Partnerin zurück. »Das ist doch stinklangweilig.«
»Du weißt doch, wie sie ist. Sie steht mit beiden Beinen in der Realität.«
»Hast du sie schon mal gefragt, ob sie nicht selbst einen Roman schreiben will? Ich meine, als ehemalige Ermittlerin müsste sie die Wirklichkeit doch perfekt beschreiben können.«
»Ja, habe ich. Sie meinte nur, dass sie nicht die Geduld habe, ein Buch zu Ende zu schreiben, nur um dann von sämtlichen Verlagen abgewiesen zu werden.«
»Das sieht ihr doch wieder ähnlich«, kommentierte Fulton schmunzelnd. »Aber anscheinend gefallen ihr diese Krimis trotzdem, sonst würde sie sich etwas anderes zum Lesen besorgen.«
Maddox zuckte mit den Schultern. »Solange sie sich nicht zu sehr aufregt … du weißt ja, dass ihr Herz nicht mehr das Beste ist.«
»Das hat sie mir erzählt. Ich hoffe, dass sie noch lange durchhält.«
»Das hoffe ich auch. Komm, wir müssen aussteigen.«
Der Washington Square Park war zwar um einiges kleiner als der weltbekannte Central Park, aber gehörte dennoch zu den bekanntesten Grünflächen von New York City. Inmitten des Stadtteils Greenwich Village gelegen, trafen sich hier Menschen aller Couleur, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Die nahe gelegene Universität sorgte dafür, dass im Park vor allem Studenten anzutreffen waren, aber auch Arbeitnehmer aus dem gesamten Stadtteil zog es oft hierher, um ihre Mittagspause dort zu verbringen. Am nördlichen Eingang des etwas weniger als vier Hektar großen Parks befand sich ein imposanter Triumphbogen, der zur Einhundertjahrfeier des Amtsantritts von George Washington gebaut und im Jahr 1895 endgültig eingeweiht worden war.
Die beiden Beamten näherten sich von der Südseite und sahen schon von Weitem die Absperrbänder sowie die geschäftig herumlaufenden Polizisten und Spurensicherer, während sich eine kleine Gruppe Schaulustiger jenseits der Absperrung befand und das Geschehen mit ihren Handys filmte. Natürlich durfte auch die lokale Presse nicht fehlen, die emsig, aber erfolglos versuchte, ein offizielles Statement zu erhalten.
»Fulton und Maddox«, stellte die Beamtin sich und ihren Partner vor, als sie bei einem der Uniformierten an der Absperrung angekommen waren.
Beide zeigten unauffällig ihre Marken vor, damit keiner der in der Nähe befindlichen Reporter etwas bemerkte. Schließlich wollten sie weder dafür verantwortlich sein, dass etwas durchsickerte, noch wollten sie ihre Zeit mit der Beantwortung sinnloser Fragen verschwenden. Der Beamte ließ sie nach einer kurzen Ausweisprüfung passieren und hob das Absperrband hoch, sodass die beiden darunter hindurchschlüpfen konnten.
»Hallo Sam«, begrüßte Fulton den Detective, der gerade dabei war, mit einem abgenutzten Bleistift etwas auf einem Stück Papier zu notieren.
Selbstverständlich war die Polizei heutzutage mit Tablets und anderen technischen Geräten ausgestattet, aber Sam gehörte zur alten Garde, die am liebsten noch immer mit Stift und Papier hantierten. Auf Fultons Nachfrage hin hatte ihr der Detective einmal gesagt, dass bei einem Stift niemals die Batterie leer werden würde.
»Nici«, gab Sam zurück und hob die Arme, um die Agentin herzlich zu begrüßen.
»Kennst du meinen Partner schon?«, fragte Fulton, als beide wieder voneinander abgelassen hatten. »Carl Maddox. Carl, das ist Sam Hiller, einer der besten Detectives, die das New York Police Department zu bieten hat.«
»Freut mich«, sagte der Beamte und schüttelte dem Agenten kräftig die Hand. »Nennen Sie mich Sam.«
»Gern«, antwortete Maddox lächelnd.
»Wie sieht es aus?«, wollte die Agentin wissen.
»Wie ein Mord halt so aussieht«, erklärte Hiller trocken. »Wir haben den Toten eingehend durchgecheckt und in die Pathologie abtransportieren lassen. Die Spurensicherer sind noch damit beschäftigt, das Gelände abzusuchen, aber eines kann ich euch jetzt schon sagen: Der Typ, der Mason auf dem Gewissen hat, hat genau gewusst, wie man tötet.«
»Woraus schließt du das?«, fragte Fulton neugierig.
»Der Hals war sauber aufgeschnitten, eine schöne Linie von links nach rechts. Auch das Geschlechtsteil wurde fein säuberlich abgetrennt.«
»Weisen die Schnitte irgendwelche Unregelmäßigkeiten auf?«
»Das endgültige Urteil würde ich den Pathologen überlassen, aber für mich sah es aus, als ob der Täter in einem Stück geschnitten hätte.«
»Denken Sie, dass sich der Täter mit Chirurgie auskennen könnte?«, fragte Maddox.
»Das ist nicht auszuschließen«, bestätigte der Detective nickend. »Er könnte allerdings auch Erfahrung als Metzger haben. Die sind oft richtig gut und wissen, wie man schneidet. Was die Geisteshaltung des Täters angeht, gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass er so etwas schon einmal gemacht hat.«
»Warum?«
»Normale Menschen ziehen nicht einfach so los und bringen jemanden um.«
»Zumindest äußerst selten«, fügte Maddox hinzu und wandte sich an seine Partnerin. »Nici, wir sollten die Akten durchforsten, ob es einen ähnlichen Fall schon einmal irgendwo gab. Das könnte uns helfen, besser zu verstehen, mit was für einer Art Mensch wir es hier zu tun haben.«
»Vermutlich mit jemandem, der etwas gegen Vergewaltiger hat«, antwortete Fulton. »Sam, zeige uns bitte den Fundort der Leiche.«
»Hier entlang«, antwortete Hiller und winkte die beiden Beamten mit sich.
Hinter einer schmalen Baumreihe befand sich der Ort, wo das Opfer am frühen Morgen von einer jungen Studentin gefunden worden war. Soweit der Detective wusste, war die junge Frau joggen gewesen, als sie die Leiche entdeckt hatte. Auf dem waldigen Boden waren noch immer die Umrisse des Toten im feuchten, plattgedrückten Gras zu sehen. Maddox ging in die Hocke und betrachtete die Stelle nachdenklich. Dann strich er mit der flachen Hand mehrfach darüber.
»Was macht er da?«, flüsterte Sam an Fulton gewandt.
»Ist eine seiner Marotten«, gab sie in ebensolchem Flüsterton zurück.
»Ihr braucht nicht zu flüstern«, erklärte Maddox, ohne den Blick vom Boden abzuwenden. »Ich gebe zu, es sieht so aus, als hätte ich mir das aus irgendeinem schlechten Film abgeschaut, aber auf diese Weise bekomme ich ein besseres Gefühl dafür, wie die Tat abgelaufen sein könnte. Sam, lag das Opfer auf dem Bauch oder auf dem Rücken?«
»Auf dem Rücken.«
»Lag er irgendwie unnatürlich?«
»Wie meinen Sie das?«
»Zur Seite gedreht, den Kopf schräg, die Arme oder Beine von sich gespreizt?«
»Nein«, erklärte Sam. »Als wir ihn fanden, lag er da, als würde er ein Sonnenbad nehmen. Die Arme befanden sich parallel zum Oberkörper, und die Beine waren ebenfalls gerade ausgestreckt.«
»Handflächen nach oben oder unten?«
»Nach unten.«
»Hmm … Okay, das weist darauf hin, dass er nicht einfach so umgefallen ist, sondern hingelegt wurde. Gab es Spuren eines Kampfes? Hatte Mason Kratzer im Gesicht oder auf den Armen?«
»Nein, jedenfalls habe ich nichts entdecken können.«
»Das führt uns zu der Frage, ob er seinen Angreifer überhaupt bemerkt hat.«
»Du meinst, wenn er von vorne angegriffen worden wäre, dann hätte er den Täter gesehen und sich gewehrt?«, fragte Fulton.
»Vielleicht kannte er ihn sogar und hat sich genau deswegen nicht gewehrt«, bestätigte Maddox. »Oder er wurde von einem ihm Unbekannten auf der Straße angesprochen und unter einem Vorwand hierher gelockt.«
»Könnte aber doch genauso gut sein, dass er von hinten attackiert und vom Täter aufgefangen wurde, bevor er hinfiel«, wandte die Agentin ein.
»Ja, das stimmt«, bestätigte ihr Partner. »Sam, gibt es irgendwelche Schleifspuren, die zu diesem Ort führen?«
»Nein«, antwortete der Detective.
»Also wurde er an Ort und Stelle getötet«, stellte Maddox fest.
»Meinst du, er hatte bereits ein neues Opfer im Auge, mit dem er sich hier getroffen hat, und dann wurde der Spieß umgedreht?«
»In New York ist alles möglich. Aber irgendwie glaube ich nicht daran.«
»Also jemand, der ihn gezielt getötet hat.«
Zur Antwort nickte Maddox nur.
»Schöner Mist …«, sagte Fulton. »Okay, ich denke, wir haben hier erst mal alles gesehen. Lass uns ins Büro zurück gehen und die Recherche starten.«
»Einverstanden.«
»Wollt ihr mit der Presse reden?«, fragte der Detective und warf einen Blick auf die Reportergruppe jenseits der Absperrung.
»Eigentlich nicht«, erklärte sie. »Ich bin nicht so die geübte Rednerin, und ich denke, je weniger die wissen, desto besser ist es für den Moment.«
»Okay«, erklärte Sam. »Ich halte mich ebenfalls raus. Das ist jetzt euer Fall.«
Fulton wusste, dass er es nicht böse meinte, sondern der Grund dafür war, dass es für niemanden nützlich war, wenn sich zwei unterschiedliche Behörden in dieselben Ermittlungen einmischten. Sie alle hatten bereits zu spüren bekommen, was passieren konnte, wenn sich zwei unterschiedliche Teams in die Quere kamen.
»Wie geht es eigentlich Corinne?«, fragte sie den Detective.
»Mal so, mal so«, gab er zurück. »Momentan ist sie okay, aber das kann sich jederzeit wieder drehen.«
»Halte durch. Wenn du etwas brauchst …«
»… dann weiß ich, wo ich dich finden kann«, vervollständigte Sam ihren Satz.
Die Agenten verabschiedeten sich von dem Detective und gingen den Weg zurück, den sie gekommen waren. An der polizeilichen Begrenzung wurden sie von einer Horde Reporter empfangen.
»Haben Sie eine Stellungnahme für uns?«, rief einer.
»Wer ist das Opfer?«, wollte ein anderer wissen.
Fulton und Maddox wechselten einen kurzen Blick, bevor sich der Agent vor der Presse aufbaute und tief Luft holte, während sie sich im Hintergrund hielt.
»Zu diesem Zeitpunkt können wir noch keine Informationen herausgeben«, erklärte er sachlich.
»Warum nicht?«, fragte ein junger Mann, der sein Diktiergerät vor sich herumtrug wie das olympische Feuer.
»Sie sind noch nicht lange im Geschäft, oder?«, gab Maddox zurück und sprach gleich darauf weiter, ohne eine Antwort abzuwarten. »Denn wenn Sie es wären, wüssten Sie, dass dies die Standardprozedur ist. Die Ermittlungen befinden sich noch ganz am Anfang, und alles, was wir jetzt über den Fall sagen, könnte sich im Nachhinein als falsch erweisen. Wenn Sie davon noch nichts gehört haben, fragen Sie einmal Ihre erfahreneren Kollegen danach. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich habe zu arbeiten.«
In solchen Momenten empfand Fulton echte Ehrfurcht vor ihrem Partner, denn er ließ sich niemals in die Enge treiben, blieb aber dennoch stets höflich. Er wandte sich ihr zu, und als sie auf gleicher Höhe waren, marschierten sie Seite an Seite im Gleichschritt weiter. Innerlich amüsierte sie sich über das Bild, das sie beide abgeben mussten, aber nach außen hin verzog sie keine Miene. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass Maddox´ Mundwinkel ganz leicht nach oben geneigt waren.
Ja, sie waren ein eingespieltes Team, dachte sie, während sie gemeinsam zur Bus-Station an der Ecke gingen und die Reporter hinter sich zurückließen.
»Okay, wo fangen wir an?«, fragte Maddox, als sie sich wieder in ihrem Büro am Federal Plaza befanden und an ihren einander gegenüberstehenden Schreibtischen saßen.
»Die Pathologie wird sicher einige Zeit brauchen, bis Ergebnisse vorliegen«, vermutete Fulton. »Lass uns damit beginnen, dass wir uns genau ansehen, wer Masons Opfer waren, und wo sie sich zum Tatzeitpunkt befunden haben.«
»Sollte nicht weiter schwierig sein. Eine der Frauen hat sich selbst umgebracht. Die scheidet also offensichtlich aus. Die beiden anderen sind, soweit ich weiß, in der Psychiatrie.«
»Offen oder geschlossen?«
»Keine Ahnung«, gab er zu. »Aber das klären wir.«
»Was ist mit den Angehörigen der Opfer?«
»Die nehmen wir uns gesondert vor«, antwortete Maddox, während er auf dem vor ihm liegenden Schreibblock Notizen vornahm. »Auch Masons Freunde werden wir durchleuchten. Ich wette, dass er seine Freilassung ausgiebig gefeiert hat.«
»Wir sollten auch seine Frau nicht vergessen«, wandte Fulton ein. »Viele Morde geschehen schließlich durch enttäuschte Ehefrauen.«
»Fangen wir doch direkt bei ihr an. Lass uns mal eben schauen, wo sie wohnt.«
Der Agent drückte auf einen Knopf an seinem Computer und weckte diesen aus dem Stand-by. In die FBI-Suchmaschine tippte er den Namen des Toten ein und ließ das System für einige Sekunden suchen.
»Hier«, sagte er und tippte mit seinem Stift gegen den Flachbildschirm. »Elmhurst. Main Street, Ecke Einundsiebzigste Straße.«
»Nicht übel«, erklärte die Agentin. »Nicht die beste Gegend, aber immer noch gut zu wohnen. Wollen wir gleich hin?«
»Lass uns vorher noch schauen, wo sich die beiden Vergewaltigungsopfer befinden. Sollten sie in der Nähe wohnen, können wir vielleicht gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.«
Er tippte erneut einen Befehl ein und betrachtete dann die Suchergebnisse.
»Und?«, fragte Fulton, als ihr Partner schwieg.
»Eine, ihr Name ist Sarah Peterson, ist in der geschlossenen Anstalt. Die andere, Ellen Jannings, befindet sich in der offenen Psychiatrie. Ihr letzter gemeldeter Wohnort ist in Forest Hills, Jewel Avenue, Ecke Yellowstone Boulevard.«
»Weit weg von Masons Wohnung?«
»Nicht so weit«, erklärte Maddox. »Nur ein paar Kilometer. Ich denke, dass wir einen Wagen nehmen sollten. Mit den Öffentlichen ist es zu umständlich.«
»Einverstanden. Im Fuhrpark kriegen wir sicher etwas Brauchbares.«
»Warte, ich starte noch Anfragen zu den Angehörigen der beiden Frauen. Dann können wir los.«
Nach wenigen Minuten war alles erledigt, und Maddox und Fulton gingen zum Aufzug, um in die Tiefgarage des Gebäudes zu gelangen. Dort befand sich der kleine, aber gut ausgestattete Fahrzeugpool des New Yorker FBI.
»Hallo Johnny«, begrüßte Fulton den jungen Mann, der sich in einer kleinen Bude im Zentrum des Tiefgeschosses befand.
Der dreiundzwanzigjährige Junge war gerade damit beschäftigt, irgendwelche Daten von einem Papierbogen in seinen Computer zu übertragen. Als er den Kopf hob und die beiden Agenten vor sich sah, lächelte er breit.
»Hey Nici, hey Carl«, sagte er. »Schöner Tag heute?«
»Ich kann mich nicht beklagen«, gab Fulton zurück. »Wie geht es dem Baby?«
»Alles paletti«, antwortete Johnny. »Er schläft zwar unregelmäßig und wacht normalerweise immer genau dann auf, wenn es am Unpassendsten ist, aber dafür geht mir stets das Herz auf, wenn mich der Kleine erkennt und anlächelt.«
»Schön zu hören. Sag mal, wir brauchen einen Wagen. Nichts Ausgefallenes, muss uns nur von A nach B bringen.«
»Kein Problem. Ich habe erst gestern einen nagelneuen Mustang reinbekommen.«
»Vielleicht etwas weniger Auffälliges«, meinte Carl lächelnd.
»Okay, dann habe ich noch einen BMW hier. Etwas älter, aber ziemlich robust. Du weißt ja, was man über deutsche Autos sagt.«
»Klingt gut.«
Der junge Mann warf einen Blick zur Seite auf ein Brett und suchte mit dem Finger die einzelnen Haken ab. Dann griff er nach einem Schlüsselbund und hielt ihn der Agentin hin. »Funkgesteuert, du musst nur …«
»Johnny, ich weiß, wie man mit Autos umgeht«, erklärte Fulton.
»Sorry, die Macht der Gewohnheit. Du ahnst ja nicht, wie viele unserer hochgeschätzten und altgedienten Kollegen vor der modernen Technik kapitulieren.«
»Ist er vollgetankt?«
»Ja, und frisch gewaschen.«
»Danke dir.«
»Wo geht es denn hin?«
»Das könnte ich dir verraten, aber dann müsste ich dich töten«, erklärte die Agentin augenzwinkernd.
»Schon kapiert. Laufende Ermittlungen und so.«
»Du hattest doch mal überlegt, dich beim FBI zu bewerben«, wandte Maddox ein. »Wie sieht es damit aus?«
»Jetzt, wo das Baby da ist, haben Audrey und ich alle Hände voll zu tun. Da bleibt leider keine Zeit für so etwas.«
»Das tut mir leid«, sagte der Agent. »Aber das wird bestimmt wieder werden.«
»Natürlich«, antwortete Johnny in einem Tonfall, der verriet, dass er nicht wirklich daran glaubte.
»Lass uns später mal auf ein Bier gehen und darüber sprechen, okay?«, bot Fulton an.
»Klar«, bestätigte der junge Mann. »Viel Spaß mit dem Wagen.«
»Danke.«
Der BMW befand sich auf der anderen Seite der Garage, und als die beiden Agenten davorstanden, sahen sie sich kurz fragend an.
»Wer fährt?«, fragte Maddox.
»Stein-Schere-Papier?«, schlug seine Partnerin vor.
Beide hoben die Hände und spielten das altbekannte Spiel. Fulton gewann mit Zwei zu Eins.
»Dann wäre das auch geklärt«, sagte der Agent und stieg auf der Beifahrerseite ein.
An der Bude, wo sich Johnny befand, winkten sie dem Jungen kurz zu und fuhren dann die Auffahrt hoch. Für Laien sah die Tiefgarage so aus wie Millionen andere auf der Welt, aber die beiden FBI-Agenten wussten es besser. Erst kürzlich waren hier umfangreiche Modernisierungen vorgenommen worden. Unter anderem waren in den Seitenwänden und Decken Kameras installiert worden, die sich in einer Entfernung von jeweils zwei Metern zueinander befanden und jede Bewegung registrierten. Vor einiger Zeit hatte die Alarmanlage angeschlagen, als sich eine Maus in die Auffahrt verirrt hatte. Ebenfalls in regelmäßigen Abständen waren massive, zwei Meter hohe und vierzig Zentimeter breite Stahlpoller in den Boden eingelassen worden, die automatisch innerhalb von drei Sekunden ausgefahren werden konnten, um etwaige Angreifer zu stoppen. Die Planungen hierzu hatte es bereits kurz nach dem Attentat auf das Murrah Federal Building in Oklahoma City im Jahr 1995 gegeben, doch wie so oft hatte es viele Jahre gedauert, bis überhaupt auch nur das Budget geklärt worden war. Bis der Umbau tatsächlich durchgeführt worden war, waren noch viele weitere Jahre ins Land gegangen.
Fulton steuerte den Wagen an die Oberfläche und passierte eine sich selbstständig öffnende Schranke und fädelte sich in den fließenden Verkehr ein, fuhr aber nicht den direkten Weg zum Stadtteil Queens.
»Willst du nicht die Brooklyn nehmen?«, fragte Maddox seine Partnerin.
Damit meinte er die im Südosten gebaute Brücke, die Manhattan mit dem Festland verband.
»Da ist momentan eine Baustelle und auf der Manhattan ebenso. Wir fahren stattdessen durch den Hugh L. Carey Tunnel, der bringt uns nach Brooklyn, und dann rüber nach Elmhurst über die Interstate Zwei-Sieben-Acht.«
»Wie du meinst«, entgegnete er und lehnte sich zurück.
Obwohl er bereits seit einigen Jahren in New York wohnte, kannte er sich mit den diversen Straßenverbindungen immer noch eher schlecht als recht aus. Dies war der Tatsache geschuldet, dass er kein eigenes Auto besaß und für größere Entfernungen normalerweise entweder die öffentlichen Verkehrsmittel oder ein Uber benutzte.
»Was denkst du, was Mrs. Mason uns sagen wird?«, fragte Fulton ihn.
»Zu der Nachricht, dass ihr Mann tot ist, oder zu dem Umstand, dass sich das FBI dafür interessiert?«
»Beides.«
Maddox rieb sich das leicht stoppelige Kinn und strich mehrfach über sein Haupthaar, welches er mithilfe des Innenspiegels bändigte. Schließlich wollte er, wenn er Hausbesuche machte, seriös wirken. »Ich schätze mal, sie wird weder über das eine noch über das andere sonderlich erfreut sein. Obwohl sie natürlich weiß, dass ihr Mann ein Straftäter war …«
»Er wurde freigesprochen«, korrigierte ihn Fulton.
»Obwohl es ziemlich klar ist, dass er für die Vergewaltigungen verantwortlich ist«, fügte Maddox hinzu. »Wie auch immer, sie hat vermutlich mehr in ihm gesehen als der Rest der Welt. Sonst hätte sie ihn ja wohl kaum geheiratet und zu ihm gestanden.«
»Da kennst du die Frauenwelt aber schlecht«, erklärte seine Partnerin. »Es gibt so viele Frauen, die bei ihren Männern bleiben, auch wenn diese noch so gewalttätige Drecksäcke sind. Jetzt weiter im Text.«
»Ich schätze, dass es nicht ganz einfach werden wird, sie zum Reden zu bringen. Vielleicht solltest du besser den Hauptteil des Gesprächs übernehmen.«
»Weil ich einfühlsamer bin als du?«
»Auch«, bestätigte er nickend. »Aber vor allem, weil du ganz einfach eine Frau bist. Es ist immer leichter, mit einem Geschlechtsgenossen zu sprechen.«
»Meinetwegen.«
Die Fahrt dauerte beinahe eine Stunde, obwohl es zu Fultons Erstaunen keinen Stau gab. An der vom Büro-Computer mitgeteilten Adresse angekommen, zeigte Maddox auf die Fassade eines mit roten Backsteinen errichteten Hauses, welches sich in nichts von den Häusern der Nachbarschaft unterschied. »Dort«, sagte er.
Die Agentin fuhr noch zwei Mal um den Block und fand dann einen Parkplatz ganz in der Nähe des Gebäudes.
»Sicher, dass Mason hier wohnt?«, wollte Fulton wissen.
»Sofern man unserer Datenbank glauben kann. Wollen wir?«
»Gentlemen first«, antwortete sie und unterstrich ihre Aussage mit einer Handbewegung.
Maddox ging, gefolgt von seiner Partnerin, über die Straße und betrachtete dabei das Gebäude von oben bis unten. Es war zweistöckig und etwa zwei Meter von der Straße zurückgesetzt. Zwischen dem Haus und dem Gehsteig erstreckte sich ein schmales Stück Rasen, wie es für diese Gegend und allgemein in amerikanischen Städten üblich war, wenn man nicht gerade im Zentrum wohnte.
Fehlt nur noch die US-Flagge, dachte er.
Die Haustür befand sich einen Meter über dem Erdboden und konnte über eine dreistufige, steinerne Treppe erreicht werden. Alles in allem sah das Haus ziemlich gepflegt aus, fand er, als er die oberste Stufe erreicht hatte und die Türklingel tief in die Fassung drückte. Aus dem Inneren des Gebäudes ertönte ein melodisches Läuten. Als die Tür nach innen aufgezogen wurde, sahen sich die beiden Agenten einer Frau im Alter von rund vierzig Jahren gegenüber. Sie trug ein geblümtes Kleid, welches den Hals nur ein wenig frei ließ und bis zu den Knöcheln reichte. Ihre braunen Haare waren zu einem lockeren Zopf geflochten, aus dem sich einzelne Strähnen gelöst hatten und locker auf ihren Schultern lagen. Es sah so aus, als ob sie Mrs. Mason gerade beim Hausputz gestört hatten.
»Ja?«, fragte sie mit heller, angenehm modulierter Stimme.
»Mrs. Mason?«, erhob Fulton das Wort.
»Die bin ich, und wer sind Sie?«
»Mein Name ist Nicole Fulton, das ist mein Partner Carl Maddox. Wir sind vom FBI.«
Masons Gesichtsausdruck veränderte sich abrupt, als sie die drei Buchstaben hörte. »Sie sind wegen Jacob hier, oder?«
»Ja«, bestätigte die Agentin.
Die Frau seufzte vernehmlich. »Was hat er jetzt wieder ausgefressen?«
»Mit Verlaub, das würden wir gerne drinnen besprechen, wenn es Ihnen nicht zu viele Umstände macht.«
»Bitte weisen Sie sich erst einmal aus.«
Fulton und Maddox zogen ihre Dienstausweise hervor und zeigten sie der Frau.
»Danke. Man muss heutzutage so vorsichtig sein. Kommen Sie bitte herein. Es ist leider gerade etwas unordentlich.«
»Schon gut, kein Problem.«
Mrs. Mason öffnete die Tür vollends und ließ die beiden Agenten eintreten. »Links ist die Küche, da können wir in Ruhe reden.«
»Ist Ihr Sohn zu Hause?«
»Nein«, entgegnete Masons Ehefrau. »Er ist für einige Tage auf einem Schulausflug. Möchten Sie einen Kaffee?«
»Gern«, antworteten die Agenten nacheinander.
Mrs. Mason ging zur Anrichte, nahm drei saubere Tassen zur Hand und betätigte dann die Kaffeemaschine, die blubbernd zum Leben erwachte.
»Cappuccino? Espresso?«, bot sie an.
»Bitte einfach nur schlichten, schwarzen Kaffee«, erwiderte Fulton.
Nachdem die drei Behälter gefüllt waren, trug Mrs. Mason sie zum Küchentisch hinüber und bedeutete den Beamten, Platz zu nehmen.
»Also, worum geht es?«, fragte sie. »Was hat Jake angestellt, dass das FBI ihn Hause besuchen will?«
»Mrs. Mason, wir kommen am besten direkt zum Punkt. Es tut uns sehr leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber Ihr Mann wurde heute Morgen tot aufgefunden.«
Die Frau hielt für einige Sekunden inne, als müsste ihr Gehör die soeben mitgeteilte Nachricht erst verarbeiten, bevor es sie an ihr Gehirn weiterleitete. Als dies geschehen war, zog sie die Lippen leicht nach oben. »Das ist ein Scherz, oder? Sie sind von irgendeiner Comedy-Show und wollen mich auf den Arm nehmen, oder?«
Fulton schüttelte leicht den Kopf. »Ich wünschte, es wäre so, aber wir sind nicht vom Fernsehen, und erst recht wollen wir Sie nicht veralbern. Ihr Ehemann, Jacob Joseph Mason, ist tot.«
»Wie …«, flüsterte Mrs. Mason.
»Er wurde ermordet.«
»Du meine Güte …«
Daraufhin tat die Frau etwas, was die Agenten nicht erwartet hatten. Sie stand auf, ging zu einem Schrank über der Spüle, öffnete die Türen und zog eine Flasche Scotch heraus. Sie schraubte den Deckel ab und setzte sie direkt an ihre Lippen. Danach zu urteilen, wie viele Schlucke sie nahm, war sie offenbar geübt darin, sich zu betrinken, entschied Maddox, während er sie beobachtete.
Als sie die Flasche schließlich absetzte, sog sie die Luft tief ein und warf ihren Kopf in den Nacken, um dann lauthals loszulachen.
»Sie sind wirklich gut!«, sagte sie zwischen zwei Lachern. »Wie oft haben Sie das geübt? Sie sind doch sicher gelernte Schauspieler, oder?«
»Mrs. Mason …«, sagte Fulton ernst. »Ich versichere Ihnen nochmals, dass wir tatsächlich und leibhaftig vom FBI sind, und das, was ich Ihnen gerade über Ihren Mann gesagt habe, die absolute Wahrheit ist.«
Die Frau sah sowohl Fulton als auch Maddox lange in die Augen, und schließlich schien ihr zu dämmern, dass es die am Tisch sitzenden Leute tatsächlich ernst meinten.
»Sie wollen mir also sagen, dass Jake, kaum dass er freigesprochen wurde, ermordet worden ist?«
»Ja, und wir möchten mit Ihnen darüber sprechen.«
»Na gut. Gesetzt den Fall, dass Sie tatsächlich die Wahrheit sagen, was wollen Sie wissen?«
»Sie glauben uns immer noch nicht«, stellte Maddox fest.
»Wie könnte ich das? Das Ganze ist so absurd, dass es nur erfunden sein kann.«
»Und doch ist es wahr. Wenn Sie uns nicht glauben, rufen Sie bitte beim FBI-Hauptquartier am Federal Plaza an und fragen Sie nach Frank Lauders. Er ist unser Vorgesetzter.«
»Wissen Sie was? Genau das werde ich tun«, erklärte Mrs. Mason, stellte die Flasche auf die Ablage, griff nach ihrem Handy und ging ins Internet, um die Telefonnummer des FBI herauszufinden. Als sie den Eintrag gefunden hatte, tippte sie die Nummer ein und hielt sich das Telefon ans Ohr.
»Frank Lauders bitte«, sagte sie. »Mein Name ist Elisa Mason. Ja, ich warte … Mr. Lauders? Hier sitzen zwei Leute in meiner Küche und behaupten, vom FBI zu sein. Sie heißen Nicole Fulton und Carl Maddox. Sie sagen, mein Mann sei gestern Nacht ermordet worden … Wirklich? Oh … Okay … vielen Dank. Auf Wiederhören.«
Elisa Mason hielt ihr Handy noch für einige Sekunden in der Hand, bevor sie es langsam auf die Ablage neben der Flasche legte. Es schien so, als habe sie alle Kraft verlassen, als sie zu ihrem Stuhl tappte und sich schwer auf die Sitzfläche fallen ließ.
»Mrs. Mason … Es tut mir sehr leid«, sagte Fulton sanft.
»Er hatte sich so gefreut, als er mir am Telefon gesagt hat, dass er freigesprochen wurde«, erwiderte Mason leise.
»Was hat er Ihnen noch gesagt?«
»Er wollte mit seinen Kumpels feiern gehen. Als er heute Morgen nicht zu Hause war, bin ich davon ausgegangen, dass er bei einem seiner Freunde übernachtet hat. Das macht er manchmal.«
»Haben Sie heute schon versucht, ihn zu erreichen?«
»Nein. Ich dachte mir, dass er heimkommen wird, wenn er ausgeschlafen hat. Vorhin, als es an der Tür geklingelt hat, dachte ich, er sei es. Er vergisst manchmal seinen Hausschlüssel, wissen Sie …«
Die Frau stützte ihr Gesicht in die Hände und unterdrückte ein Schluchzen.
»Erinnern Sie sich, ob Jacob Ihnen gesagt hat, wo er feiern will?«
»Nein, aber ich weiß, dass er gerne in seine Stammkneipe geht. Sam´s Irish Pub heißt das Ding. Ziemliche Spelunke, wenn Sie mich fragen, aber ihm gefällt es dort.«
»Danke«, sagte Fulton. »Sagen Sie, Sie haben nicht zufällig die Adressen von Jacobs Freunden, oder?«
»Doch«, erwiderte die Frau. »Jake hat im Arbeitszimmer ein Notizbuch mit den Adressen. Warten Sie, ich hole es für Sie.«
Als Elisa Mason die Küche verlassen hatte, beugte sich Maddox zu seiner Partnerin hinüber. »Glaubst du, dass die Trauer echt ist?«
»Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie durchaus erleichtert ist, dass ihr Mann tot ist. Auch wenn sie jetzt ihren Sohn allein großziehen muss, und auch finanziell wird es bestimmt schwierig für sie werden.«
»Denkst du, dass sie verdächtig ist?«
»Wir sollten es auf jeden Fall nicht ausschließen.«
»Hier ist das Buch«, sagte Mason und überreichte der Agentin ein dünnes Heft.
»Sagen Sie, Mrs. Mason, wo waren Sie eigentlich vergangene Nacht?«, fragte Maddox.
»Ich war hier«, antwortete die Frau. »Ich habe mein Buch weitergelesen und bin dann schlafen gegangen.«
»Wann war das?«
»So gegen elf, schätze ich.«
»Gibt es jemanden, der das bezeugen kann?«
»Moment«, sagte Mason gedehnt und schaute zuerst zum Agenten und dann zu seiner Partnerin. »Denken Sie etwa, dass ich ihn umgebracht habe?«
»Dies ist nur eine Routinefrage«, erklärte Maddox ausweichend.
»Kommt es öfter vor, dass eine Frau ihren Mann heimtückisch ermordet?«
»Öfter, als Sie denken«, gab er zu. »Mrs. Mason, beantworten Sie bitte meine Frage.«
Elisa Mason atmete mehrfach durch. »Nein«, erwiderte sie schließlich. »Ich war allein.«
»Vielen Dank. Meine Partnerin und ich müssen jetzt leider los, aber wir möchten Sie bitten, die Stadt bis auf Weiteres nicht zu verlassen.«
»Um mich verhaften zu können?«
»Um Sie aufsuchen zu können, sollten wir weitere Fragen haben.«
Die beiden Agenten verabschiedeten sich und verließen dann das Haus. Im Auto sitzend, warf Fulton noch einen Blick auf das Gebäude und sah, dass sich hinter einem der Fenster die Silhouette von Elisa Mason abzeichnete.
»Ich glaube nicht, dass sie es getan hat«, sagte sie in die Stille hinein.
»Warum nicht?«
»Nenne es weibliche Intuition. Sie macht auf mich nicht den Eindruck, dass sie zu einem Mord fähig ist.«
»Das Leben kann einem manchmal übel mitspielen. Sie wäre nicht die Erste, bei der sich plötzlich ein Schalter umlegt.«
Fulton nickte. »Schon klar, aber wir sollten uns jetzt noch nicht festlegen. Komm, lass uns zu Jannings fahren.«
Die Gegend, in der eines der früheren Opfer von Jacob Mason wohnte, unterschied sich drastisch von dessen eigenem Haus. Das Gebäude, das sich direkt an der Kreuzung Queens Boulevard, Jewel Avenue und Yellowstone Boulevard befand, war sechs Stockwerke hoch und zu einer Seite hin spitz zulaufend gebaut.
»Bisschen wie das Flatiron«, kommentierte Fulton den Anblick, womit sie das berühmte Gebäude an der Fifth Avenue meinte, welches bekanntermaßen die Form eines aufrechtstehenden Bügeleisens besaß.
»Aber wirklich nur ganz dezent. Hier ist sie«, sagte Maddox und zeigte auf eines der zahlreichen Klingelschilder an der Eingangstür.
»Soll ich wieder das Reden übernehmen?«, fragte die Agentin.
»Nachdem das FBI für Gleichberechtigung eintritt, bin ich jetzt an der Reihe«, gab ihr Partner zurück und drückte den Klingelknopf.
Außer einem leisen Summen, welches dem nächtlichen Quaken eines Frosches nicht unähnlich war, hörten sie nichts, bis die neben den Klingeln angebrachte Gegensprechanlage knisternd zum Leben erwachte.
»Hallo?«, fragte eine metallisch verzerrte Stimme.
»Ms. Jannings? Mein Name ist Carl Maddox. Ich habe meine Partnerin Nicole Fulton bei mir. Wir sind vom FBI und möchten gerne mit Ihnen sprechen.«
»Tut mir leid, ich habe gerade nicht viel Zeit.«
»Es wird nicht lange dauern. Wir wollen wirklich nur mit Ihnen reden. Bitte, lassen Sie uns rein.«
Nach einem kurzen Schweigen am anderen Ende summte der Türöffner. Fulton zog die schmucklose Pforte auf und hielt sie dann für ihren Kollegen offen. Sie folgten der Treppe bis in das vierte Stockwerk, wo sie unschlüssig stehenblieben. An den Wohnungstüren auf dieser Etage befanden sich keine Namensschilder. Sie wollten bereits an einer der Türen klopfen, als sie zu ihrer Linken eine Bewegung wahrnahmen. Die dort befindliche Tür öffnete sich einen Spalt weit.
»Ms. Jannings?«, fragte Maddox.
»Zeigen Sie mir bitte Ihre Marken«, forderte sie die Frau auf der anderen Seite auf, ohne sich selbst zu zeigen.
Die beiden Agenten taten wie verlangt, zückten ihre FBI-Ausweise und hielten sie gut sichtbar in dir Höhe.
»In Ordnung«, beschied ihnen Jannings nach einigen Sekunden und schloss die Tür wieder.
Den klappernden Geräuschen, die von drinnen zu hören waren, nach zu urteilen, entriegelte sie eine Kette. Dann zog sie die Eingangstür gerade so weit auf, dass eine Person hindurchgehen konnte.
»Kommen Sie herein.«
»Vielen Dank«, entgegnete der Agent und trat, gefolgt von Fulton, in die kleine Wohnung.
»Ziehen Sie bitte die Schuhe aus, ich habe gerade gewischt.«
Maddox und Fulton wechselten einen amüsierten Blick. Anscheinend waren heute alle, die sie besuchten, mit Putzen beschäftigt. Sie zogen ihre Schuhe von den Füßen und stellten sie auf den dafür vorgesehenen Platz; eine schmale Matte unter der Garderobe. Jannings beobachtete jede ihrer Bewegungen ganz genau.
Wie ein Tiger, der seine Beute betrachtet, schoss es Maddox durch den Kopf. Oder vielleicht eher wie ein verschrecktes Reh, fügte er im Geiste hinzu.
Sie folgten ihr durch den kurzen Flur in ein Zimmer, welches sowohl den Wohn-, als auch den Kochbereich darstellte.
»Möchten Sie sich setzen?«, fragte die Frau.
»Gern«, erwiderte der Agent und machte es sich auf einem breiten Holzstuhl bequem. Fulton ließ sich neben ihm auf einem Stuhl gleicher Bauart nieder und musterte Jannings unauffällig. Die Frau war jung und trug ihr blondes Haar etwa schulterlang. Ihre Figur war sportlich, ähnlich derjenigen von Mrs. Mason. Alles in allem eine hübsche Person, wenn sie gelächelt hätte. Aber ihre Augen … diese waren zu alt für eine so junge Person, so, als hätte die Frau in ihren Leben zu viel gesehen.
Hat sie auch, sagte Fultons innere Stimme. Sie hat zu viel gesehen und zu viel erlebt.
»Warum möchte das FBI mit mir sprechen?«, fragte Jannings in die Stille hinein.
»Wir ermitteln gerade in einem Fall, der mit jemandem zu tun hat, den Sie kennen«, antwortete Maddox.
»Bitte, sprechen Sie einfach Klartext. Ich habe nicht viel Zeit.«
»Okay«, antwortete der Agent, beugte sich vor und blickte Jannings direkt in die Augen. »Heute Morgen wurde Jacob Mason tot aufgefunden. Er wurde ermordet, und wir wollen herausfinden, wer ihn auf dem Gewissen hat.«
Jannings´ Augen weiteten sich. »Er ist tot?«
»Definitiv.«
»Sind Sie sich auch wirklich sicher?«
»So sicher, wie ich hier sitze«, bestätigte Maddox.
Die Frau antwortete nicht, sondern senkte den Blick und sah zu Boden.
Eine seltsame Reaktion, notierte Fulton im Geiste. Warum freut sie sich nicht?
Als Jannings nach einigen Sekunden immer noch nicht den Kopf gehoben hatte, ergriff der Agent wieder das Wort. »Ms. Jannings? Sind Sie in Ordnung?«
»Ja …«, sagte sie leise. »Es ist nur … ich habe mir nach dem, was er mir angetan hat, immer gewünscht, dass er tot wäre. Jetzt zu erfahren, dass mein Wunsch tatsächlich in Erfüllung gegangen ist, ist so …«
»… befriedigend?«, soufflierte der Agent.
»Nein«, widersprach ihm Jannings. »Ich kann nicht in Worte fassen, was ich gerade fühle. Auf eine seltsame Weise ist da einfach … nichts. Keine Freude, kein Entsetzen, gar nichts.«
»Glauben Sie mir, das ist vollkommen normal. Oftmals braucht das Gehirn eine gewisse Zeit, um die Nachricht vom Tod einer anderen Person verarbeiten zu können.«
»Mag sein«, gab die Frau zurück. »Aber es ist nicht das erste Mal, dass ich nichts fühle. Seit dem … Vorfall vor sechs Monaten fühle ich kaum noch etwas. Wenn ich früher im Park spazieren gegangen bin, habe ich es immer genossen, die Sonne auf der Haut zu spüren und dem Gesang der Vögel zu lauschen. Wenn ich früh morgens aufstand und die ersten Sonnenstrahlen durchs Fenster drangen und mich kitzelten, war ich glücklich, doch er hat mir all das genommen.«
»Sie fühlen sich leer«, sagte Maddox wissend.
»Nicht nur das. Ausgelaugt ist vielleicht das richtige Wort. Wie ein Schwamm, der so lange ausgepresst wurde, dass er jetzt so trocken ist, dass er bröckelt, wenn man ihn anfasst.«
»Ich verstehe Sie.«
»Das glaube ich zwar nicht, aber ich danke Ihnen trotzdem für den Versuch«, antwortete Jannings.
»Hören Sie, es ist bestimmt nicht leicht, über diesen Menschen nachzudenken, aber für uns ist es sehr wichtig, dass wir herausfinden, wer Mason getötet hat. Sind Sie bereit dazu, uns einige Fragen zu beantworten?«
Die Frau schien sich innerlich zu fassen und blickte den Agenten an. »Ja.«
»In Ordnung, dann sagen Sie uns bitte, wo Sie in der vergangenen Nacht waren.«
»Ich war den Großteil der Zeit zu Hause. Ich gehe nicht mehr viel vor die Tür. Nicht seit meinem Zusammentreffen mit Mason.«
»Gibt es eine Person, die bestätigen kann, dass Sie hier waren?«
»Meine Nachbarin, Philippa Baker. Sie wohnt direkt nebenan und kommt oft vorbei, um Zeit mit mir zu verbringen. Gestern war sie lange bei mir.«
»Wie lange?«
»Sie ist erst heute Morgen rübergegangen.«
»Wenn wir Ms. Baker fragen, wird sie dies bestätigen?«
»Davon gehe ich aus«, antwortete Jannings. »Sie ist eine liebe Person, die mich so gut es geht, unterstützt. Sie kauft für mich ein und hilft mir bei diversen Angelegenheiten … und sie hört mir zu, wenn ich jemanden zum Reden brauche.«
»Sie sagten vorhin, dass Sie sich seit dem Vorfall damals gewünscht haben, dass Jacob Mason tot ist. Wie sehr haben Sie sich das gewünscht?«
»In der ersten Zeit kaum, da war ich mit ganz anderen Dingen beschäftigt, wie Sie sich sicher vorstellen können. Aber als ich anfing, in die Therapie zu gehen, entstand der Wunsch, es ihm heimzuzahlen. Wissen Sie, ich wache noch immer jede Nacht auf, weil ich ihn im Traum vor mir sehe. Manchmal sehe ich ihn sogar tagsüber, im Spiegel oder im Fenster. Hin und wieder höre ich auch seine Stimme.«
»Sie haben vor Gericht ausgesagt, dass Sie sich nicht mehr wirklich an sein Gesicht erinnern können«, gab Fulton zu bedenken.
»Viele Dinge, die in der Nacht des Vorfalls geschehen sind, sind verschwommen. Im Traum sehe ich ihn vor mir, auch wenn ich sein Gesicht nicht genau erkennen kann«, räumte sie ein. »Aber ich weiß dennoch, dass er es ist, und als ich vor Gericht ausgesagt habe, da wusste ich ganz sicher, dass ER es war, der da auf der Anklagebank saß.«
Maddox schaltete sich wieder ein. »Wenn Sie die Möglichkeit gehabt hätten, ihn umzubringen, hätten Sie es getan?«, wollte er jetzt wissen.
»Ich denke schon«, antwortete sie und zog einen Mundwinkel nach oben. »Ich schätze, das macht mich schwer verdächtig, oder?«
»Nach allem, was Sie erlebt haben, ist es nur menschlich, so zu denken.«
»Das beantwortet aber nicht meine Frage.«
»Ja«, bestätigte Maddox. »Sie gehören definitiv zu den Verdächtigen.«
Jannings nickte. »Das verstehe ich natürlich. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich es nicht war, und dass ich auch niemanden damit beauftragt habe, es zu tun. Ob Ihnen das reicht, müssen Sie selbst entscheiden.«
»Wie nahe stehen Sie Ms. Baker?«
»Wir sind gute Freundinnen. Schon, seit ich hier wohne, verstehen wir uns gut. In den vergangenen Monaten sind wir uns wirklich nahegekommen.«
»Wie nah?«, hakte Maddox nach.
Zum ersten Mal, seit die Unterhaltung begonnen hatte, lächelte Jannings, wenn auch nur leicht. »Wir sind kein Liebespaar, wenn Sie das meinen«, erklärte sie. »Wir sind sehr gute Freundinnen. Ein wenig wie Mutter und Tochter, nur auf eine angenehme Art und Weise, ohne die Ärgernisse, die ein Familienleben mit sich bringt.«
Der Agent warf Fulton einen kurzen Blick zu. Als diese ganz leicht den Kopf schüttelte, wandte er sich wieder der Frau zu. »Danke für Ihre Zeit, Ms. Jannings. Momentan haben wir keine weiteren Fragen. Es wäre aber schön, wenn wir Sie erreichen könnten, sollten wir doch noch etwas wissen wollen. Und reden Sie bitte mit niemandem über diesen Fall. Wir wollen die Ermittlungen so ungestört wie möglich durchführen.«
»Ich bin hier und werde mit niemandem sprechen«, sagte Jannings und breitete die Arme leicht aus.
Die Agenten verabschiedeten sich und traten in den Flur hinaus. Direkt hinter ihnen fiel die Tür ins Schloss und wurde verriegelt.
»Wollen wir jetzt Ms. Baker aufsuchen?«, fragte Maddox.
»Klar.«
Sie klopften an die Tür, welche direkt vor ihnen lag, und staunten nicht schlecht, als diese nur zwei Sekunden später geöffnet wurde.
»Guten Tag«, grüßte sie eine dunkelhäutige alte Dame mit schlohweißem Haar, die so klein war, dass sie den beiden Agenten gerade bis zum Bauchnabel reichte.
»Guten Tag«, erwiderte der Agent den Gruß und sah zu ihr hinunter. »Sind Sie Ms. Baker?«
»In voller Lebensgröße«, erwiderte die Frau und lächelte spitzbübisch.
Die Agenten wollten sich vorstellen, aber die alte Frau winkte nur ab.
»Ich habe schon mitbekommen, wer Sie sind«, erklärte Baker. »Die Wände sind hier nicht besonders dick.«
»Erst recht nicht, wenn man lauscht«, fügte Fulton hinzu.
Die alte Frau zuckte mit den Schultern. »Ich bin nur vorsichtig, gerade, wenn es um Ellen geht.«
»Sie hat uns einiges von Ihnen erzählt. Dürfen wir hereinkommen?«
»Natürlich. Bitte.«
Baker trat zur Seite und ließ die beiden FBI-Beamten in ihre Wohnung. »Behalten Sie ruhig Ihre Schuhe an«, gab sie kund. »Was wollten Sie denn von Ellen?«
»Wir ermitteln in einem Mordfall und haben einige Informationen von Miss Jannings benötigt.«
»Ist der Drecksack also endlich weg vom Fenster?«
»Wen meinen Sie damit?«, fragte Maddox.
»Na Mason. Dieser Scheißkerl, der Ellen auf dem Gewissen hat.«
»Aktuell dürfen wir nichts über die Ermittlungen preisgeben.«
»Danke, das genügt mir schon als Antwort. Sie wollen sicher wissen, wo sich Ellen zum Tatzeitpunkt befand. Ich war bei ihr.«
»Sie wissen ja noch gar nicht, wann der Mord geschehen ist«, antwortete Fulton misstrauisch.
»Die Wände …«, sagte Baker und zeigte zur Unterstreichung ihrer Aussage zu ihrer Linken. »Ich bin gestern Nachmittag zum Einkaufen gegangen, habe Ellen alles mitgebracht und bin dann bis heute früh bei ihr geblieben. Wir haben uns unterhalten, uns lange angeschwiegen und uns dann wieder unterhalten. So ist es oft. Das arme Ding hat einiges mitgemacht.«
»Ja, das ist uns bekannt«, sagte Maddox.
»Sie wissen aber wahrscheinlich nicht, dass es nicht das erste Mal war, dass sie vergewaltigt wurde. Ihr Vater hat sie als kleines Mädchen regelmäßig missbraucht.«
»Hat sie Ihnen das erzählt?«
»Ja. Die psychiatrische Behandlung in allen Ehren, aber es gibt Dinge, die erzählt man nicht mal einem Therapeuten. Mir hingegen vertraut sie.«
»Dann weiß sie hoffentlich auch, dass Sie uns gerade ihre Lebensgeschichte erzählen, als wäre es eine Story aus einem Roman.«
»Sie vertraut mir«, wiederholte Baker. »Jedenfalls versichere ich Ihnen, dass Mason nicht von Ellen getötet worden ist. Dazu ist sie nicht fähig.«
»Menschen können zu allem fähig sein«, wandte Fulton ein. »Es muss nur der richtige Schalter gedrückt werden.«
»Ich meinte das metaphorisch«, gab die alte Frau zurück. »Ellen verlässt die Wohnung nur, wenn es unbedingt nötig ist. Sie telefoniert nicht, sie hat auch kaum Kontakt zu den anderen Hausbewohnern. Wenn sie etwas benötigt, schreibt sie mir eine Nachricht, und dann gehe ich rüber.«
»Würden Sie alles für Miss Jannings tun?«
»Wenn Sie damit meinen, dass ich jemanden für sie töten lassen würde, dann nicht«, erklärte Baker. »Ich bin überzeugte Pazifistin, seit mein Mann damals bei den Unruhen in Los Angeles getötet wurde.«
»Das tut mir leid«, sagte der Agent.
»Dass ich Pazifistin bin oder dass mein Mann erschossen wurde, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war?«
»Sie wissen, was ich meine.«
Baker lächelte wieder ihr spitzbübisches Lächeln. »Jedenfalls sind weder Ellen noch ich dafür verantwortlich, dass Mason tot ist.«
»Miss Baker, haben Sie in nächster Zeit vor, zu verreisen?«
»Nö«, gab sie zurück.
»Gut. Es wäre nämlich wirklich schade, wenn wir Sie suchen müssten, sollten wir im Laufe der Ermittlungen auf Ihre Mithilfe angewiesen sein.«
»Ich bin gerne für Sie da. Hoffentlich finden Sie den Kerl, der Mason gekillt hat.«
»Warum?«
»Damit er einen Orden bekommt.«
Fulton zog eine Augenbraue hoch, um ihre Missbilligung für diese Aussage kundzutun, aber die alte Frau ignorierte diese Geste geflissentlich.
»Vielen Dank für Ihre Zeit«, sagte Maddox.
»Immer gern.«
»Ich möchte Sie im Übrigen bitten, sich nicht mit der Presse zu unterhalten. Sonst könnten Sie belangt werden wegen Behinderung der Justiz.«
»Schon klar, Jungchen«, antwortete Baker und schloss die Tür.
»Die Frau hat es faustdick hinter den Ohren«, sagte Fulton, als die beiden Agenten wieder im Auto saßen und in Richtung Federal Plaza unterwegs waren.
»Das kannst du laut sagen«, bestätigte Maddox. »Ich denke übrigens, dass Jannings tatsächlich nichts mit dem Mord zu tun hat. Baker hingegen …«
»Glaubst du, dass sie jemanden beauftragt haben könnte?«
»Ausschließen lässt es sich nicht.«
»Shit. Also ist der Kreis der Verdächtigen nicht kleiner geworden.«
»Yap«, bestätigte er.
»Und, wie gefällt euch der Wagen?«, fragte Johnny, als Fulton ihm den Schlüssel auf den Tresen legte.
Maddox war bereits voraus ins Büro gegangen, um sich mit Masons Notizbuch zu beschäftigen.
»Gutes Ding«, erwiderte sie. »Fährt ziemlich ruhig, und die Handschaltung macht wirklich Spaß.«
»Ist halt doch ein Unterschied zu den amerikanischen Autos.«
»Definitiv. Denkst du, du kannst uns den Wagen freihalten? Kann sein, dass wir ihn in nächster Zeit noch öfter brauchen werden.«
»Klar«, bestätigte er.
»Danke. Wir sehen uns«, sagte die Agentin und wandte sich ebenfalls zum Aufzug.
In ihrem Stockwerk angekommen, empfing sie das gedämpfte Geräusch des konzentrierten Arbeitens. Das Großraumbüro war für zwanzig Mitarbeiter ausgelegt, aber selten waren alle Plätze belegt. Normalerweise befand sich der Großteil der Kollegen bei Ermittlungen im Feld. Das war der Fachausdruck dafür, wenn man außerhalb des Büros arbeitete, zum Beispiel, um einen Tatort zu untersuchen oder Zeugen zu vernehmen. Heute waren zusammen mit Maddox und Fulton nur drei weitere FBI-Mitarbeiter zugegen, und diese waren momentan damit beschäftigt, entweder Berichte zu tippen oder in den digitalen Akten für ihre Fälle zu recherchieren. Inzwischen war der größte Teil der Aufzeichnungen des FBI von zahllosen Mitarbeitern digitalisiert worden. Selbst Unterlagen, die noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stammten, befanden sich inzwischen auf den FBI-Servern und konnten von allen Dienststellen mit wenigen Klicks mühelos eingesehen werden. Sie erinnerte sich noch lebhaft daran, wie es war, bevor das FBI das Internet für sich entdeckt hatte. Wenn man etwas hatte wissen wollen, dann hatte man einen Antrag stellen müssen, der für sich bereits einem Marathonlauf geähnelt hatte. Wenn dann endlich die angefragten Unterlagen per Kurier eingetroffen waren, hatte man meist feststellen müssen, dass diese nicht vollständig waren. Dann hatte man erneut einen Antrag stellen müssen, und bis man wirklich alles hatte, was man brauchte, war der Fall schon kalt geworden und der Täter über alle Berge gewesen.
Kein Wunder, dass das Federal Bureau of Investigation lange Zeit als bürokratische und ineffektive Deppenbude gegolten hatte, dachte sie, während sie zu ihrem Platz ging und sich gegenüber ihrem Partner niederließ. Dort fand sie eine Tasse heißen Kaffees vor.
»Danke«, sagte sie zu Maddox.
»Kein Ding«, antwortete er, ohne seinen Blick von dem Notizbuch zu heben.
»Was Interessantes?«, fragte sie und wies auf das Büchlein.
»Wie man es nimmt«, sagte er und strich sich über das Kinn. »Das Ding ähnelt eher einem Tagebuch als einem Adressverzeichnis. Ziemlich viel belangloser Kram da drin.«
»Irgendetwas, was uns weiterhilft?«
»Nur, dass er hin und wieder über schöne Frauen schreibt, die ihm aufgefallen sind, und was er gerne mit ihnen tun würde.«
»Das wäre doch ein guter Beweis für seine Schuld gewesen«, meinte Fulton. »Mir ist absolut schleierhaft, warum es nicht vor Gericht verwendet wurde.«
»Vielleicht, weil es bei der Hausdurchsuchung nicht gefunden wurde. Ich glaube nicht, dass Mrs. Mason das Buch einfach so aus der Schublade geholt hat. Ich glaube, sie hatte es gezielt versteckt.«
»Aber warum hat sie es uns dann einfach so überreicht?«
»Keine Ahnung«, gab Maddox zu. »Vielleicht, weil ihr Mann bereits tot ist und sie denkt, dass es jetzt auch egal ist. Möglicherweise möchte sie uns helfen, die Wahrheit herauszufinden. Es könnte aber natürlich sein, dass sie gar nicht weiß, dass außer diversen Adressen noch andere Dinge darin stehen.«
»Konzentrieren wir uns zunächst auf die Anschriften seiner Freunde«, beschloss sie. »Gibt es da etwas?«
Anstatt zu antworten, blätterte ihr Partner einige Seiten weiter, bis er abrupt innehielt. »Hier«, sagte er.
»Lass mal sehen«, verlangte Fulton.
Ihr Partner schob ihr das Notizbuch über den Tisch und ließ sie einige Minuten in Ruhe den Eintrag lesen. Er wusste, dass Fulton die Begabung hatte, Texte schnell zu erfassen, zu analysieren und zu filtern. Das war eine der Fähigkeiten, die er so sehr an ihr schätzte.
»Okay«, meinte sie schließlich und blickte auf. »Soweit ich sehen kann, gibt es sechs Adressen, die für uns primär interessant sind. Die anderen wohnen alle über die Staaten verteilt. Natürlich kann es sein, dass sie sich momentan hier in New York aufhalten. Ich denke, während wir uns seine hiesigen Freunde vornehmen, sollten wir die lokalen Kollegen um Unterstützung bitten.«
»Einverstanden«, meinte Maddox.
»Wollen wir seinen New Yorker Freundeskreis besuchen, oder lassen wir die Burschen zu uns kommen?«
»Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, ständig durch die Gegend zu fahren.«
»Magst du etwa meinen Fahrstil nicht?«, fragte Fulton und schob gespielt beleidigt ihre Unterlippe vor.
»Du fährst so gut wie ich … wenn ich betrunken bin«, antwortete er augenzwinkernd.
»Ich erinnere mich, wie einer von uns beiden beim letzten Mal einen Mülllaster demoliert hat, weil dieser ganz plötzlich aus einer Seitenstraße kam, und diese Person war nicht ich.«
Maddox grinste. »Touché. Wie auch immer, ich denke, dass es uns mehr nützt, wenn wir Masons Freunde in einer ungewohnten Umgebung befragen.«
»Keine schlechte Idee. Vielleicht kriegen wir dann mehr aus ihnen heraus«, pflichtete ihm Fulton bei. »Schau doch mal bitte, ob die Kerle irgendwelche Einträge haben.«
Maddox tippte die Namen nacheinander in die Suchmaske der FBI-Datenbank ein und ließ das System dann alle verfügbaren Daten finden. Als das Programm nur wenige Sekunden später die Fertigstellung vermeldete, pfiff der Agent leise durch die Zähne.
»Wow«, sagte er. »Da sind ja ein paar Kaliber dabei.«
Er drehte seinen Bildschirm so, dass seine Partnerin ihn von ihrem Platz aus gut sehen konnte.
Fulton kniff die Augen zusammen, während sie den Bildschirm studierte. »Tätlicher Angriff, Raub … einer hat wegen Totschlags einige Jahre gesessen. Nette Freunde hat er da. So viel zur ungewohnten Umgebung. Die kennen sich wahrscheinlich auf Polizeistationen besser aus als in ihrem eigenen Zuhause.«
»Lass uns diese Vorzeigebürger trotzdem vorladen. Am besten gleich für morgen früh.«
»Ich mache das. Informiere du die Kollegen in den anderen Städten, dass wir ihre Unterstützung brauchen.«
»Jawohl, Sir«, gab Maddox zurück und salutierte stramm.
Die nächste Stunde verbrachten sie beide schweigend damit, ihren jeweiligen Tätigkeiten nachzugehen. Gerade, als sie fertig waren, trat ihr Vorgesetzter Frank Lauders zu ihnen.
»Und, wie kommen Sie voran?«, wollte er wissen.
»So weit so gut«, erklärte Maddox vage. »Wir stehen noch am Anfang der Ermittlungen.«
»Das heißt im Klartext, Sie haben noch keine heiße Spur.«
»Nein«, gab der Agent zu. »Aber das hatten wir auch nicht erwartet, und Sie auch nicht, wenn Sie ehrlich sind.«
Lauders lächelte leicht. »Als ich mitbekommen habe, dass Mason tot ist, habe ich mir bereits gedacht, dass es nicht so einfach sein wird, seinen Mörder zu finden. Was haben Sie denn bisher?«
»Wir haben seine Frau besucht und von ihr bereits einiges erfahren. Zum Beispiel wissen wir, mit wem Mason befreundet war, und morgen werden wir diese Freunde durch die Mangel nehmen.«
»Gut«, befand der Abteilungsleiter. »Noch etwas?«
»Frank, warum fragen Sie?«, schaltete sich Fulton ein. »Ich dachte, Sie wollen uns freie Hand lassen.«
»Das tue ich auch«, erklärte er. »Ich möchte nur auf dem aktuellsten Stand sein, sollte die Presse herausbekommen, wer der Tote tatsächlich ist. Also?«
»Wir waren bei Ellen Jannings, einem von Masons Opfern. Auch von ihr haben wir einiges erfahren, aber noch nichts, was uns einen Hinweis auf seinen Mörder geben könnte.«
»Okay, das ist alles, was ich wissen muss. Was haben Sie heute noch vor?«
»Wir wollten nachher zur Pathologie fahren, um zu schauen, ob es dort schon etwas Verwertbares gibt. Und wir warten auf den Bericht der Spurensicherung.«
»Wenn Sie wollen, werde ich dort etwas Dampf machen«, bot Lauders an. »Manchmal brauchen die Jungs und Mädels ein wenig Ansporn.«
»Das wäre wunderbar«, sagte die Agentin.
»Ich fürchte allerdings, dass Sie Ihren Besuch bei der Pathologie etwas verschieben werden müssen, denn vor wenigen Minuten habe ich erfahren, dass es noch ein Mordopfer gibt.«
»Wen?«
»Sein Name ist Peter Wright, ein junger Kerl Ende Zwanzig. Wurde tot in seinem Appartement aufgefunden.«
»Bei dem Namen klingelt etwas bei mir«, erklärte Maddox.
»Sollte es auch«, erwiderte Lauders. »Denn er war Masons Anwalt.«
»Ach du Kacke.«
»Das können Sie laut sagen. Ich möchte, dass Sie beide dorthin fahren und die Sache untersuchen. Irgendetwas sagt mir, dass es kein Zufall ist, dass der Typ zur gleichen Zeit wie sein Mandant verstirbt.«
»Wir fahren sofort los.«
Das Appartement des Anwalts befand sich in einem vielstöckigen Haus inmitten der Innenstadt und bestand vor allem aus großen Glasfassaden, die verspiegelt waren und die Nachmittagssonne in schillernden Farben wiedergaben.
»Blendend«, kommentierte Maddox und setzte seine Sonnenbrille auf.
Fulton hingegen hielt eine Hand an ihre Stirn und schirmte damit die Sonnenstrahlen so gut wie möglich ab.
»Weißt du, was es kostet, hier zu wohnen?«, fragte sie ihren Kollegen.
»Nein, aber ich schätze mal, eine Monatsmiete ist höher als mein Jahreseinkommen.«
»Mehrfach höher. Wie alt war Wright noch mal?«
»Laut seiner Geburtsurkunde hat er vor zwei Wochen seinen achtundzwanzigsten Geburtstag gefeiert.«
»Scheint in seinem Beruf ziemlich erfolgreich gewesen zu sein.«
»Er hat für eine große Kanzlei gearbeitet, und seine Erfolgsquote vor Gericht ist sehr hoch. Soweit mir bekannt ist, hat er bisher nur zwei Fälle verloren.«
»Hilft ihm jetzt auch nichts mehr«, sagte sie abschätzig. »Lass uns schauen, was Sache ist.«
Die weite Flügeltür wurde von einem Mann in Livrée bewacht. Als er die beiden Beamten auf sich zukommen sah, zog er eine Seite der Tür auf und ließ sie eintreten, während er sich dezent verneigte. Die Eingangshalle war gediegen eingerichtet und verfügte über einen Boden aus marmorierten Fliesen. Die Luft war angenehm kühl und leicht zugig, was eine Wohltat im Vergleich zu den draußen herrschenden Temperaturen war. Am zehn Meter entfernten anderen Ende der Halle befand sich ein breiter Empfangsschalter, hinter dem ein weiterer Mann saß, der ebenfalls in Livrée gekleidet war und mit irgendetwas beschäftigt war, was die FBI-Agenten von ihrem Blickwinkel aus nicht sehen konnten.
»Guten Tag«, grüßte sie der Angestellte und setzte eine höfliche und gleichzeitig nichtssagende Miene auf.
»Guten Tag«, erwiderte Maddox den Gruß und stellte sich und seine Partnerin vor. »Wir untersuchen den kürzlich erfolgten Todesfall in Ihrem Haus.«
»Ihre Dienststelle hat uns bereits über Ihr Kommen unterrichtet«, erwiderte der Mann, dessen Namensschild ihn als Francis auswies.
Er zog ein Blatt Papier hervor und legte es auf den Tresen. »Ihre Besuchsausweise sind bereits ausgefüllt. Bitte quittieren Sie den Empfang hier und hier«, erklärte er und zeigte auf zwei gestrichelte Linien unterhalb eines langen, kleingedruckten Texts.
»Besuchsausweise?«, fragte Fulton.
»Jeder, der hier nicht wohnt, ist angehalten, sich jederzeit identifizieren zu können. So ist es für den Sicherheitsdienst leichter, festzustellen, ob sich jemand unbefugt in diesem Gebäude aufhält.«
»Schon klar«, antwortete Maddox und unterschrieb seinen Teil des Formulars, bevor er sich den laminierten Ausweis gut sichtbar ans Revers hängte. »In welcher Etage dürfen wir uns einfinden?«
»Etage Fünfzehn. Das Appartement hat die Nummer Drei.«
»Vielen Dank.«
Gemeinsam gingen Maddox und Fulton zum Aufzug, dessen metallene Tür blankpoliert war und sich lautlos vor ihnen öffnete.
»Bewegungsmelder«, flüsterte die Agentin. »So spart man sich die Grabbelfinger.«
In der Kabine befanden sich keinerlei Knöpfe, und an den Seiten waren nur schaumstoffumhüllte Haltegriffe sichtbar.
»Und jetzt?«
»Bitte nennen Sie Ihr Ziel«, bat sie eine wohlmodulierte Computerstimme scheinbar aus dem Nirgendwo.
»Das ist ja cool«, kommentierte der Agent und nannte die gewünschte Etage.
Kaum merklich setzte sich die Kabine in Bewegung und kam bereits nach wenigen Sekunden wieder zum Stehen.
»Etage Fünfzehn«, verkündete die Geisterstimme feierlich.
Die Tür öffnete sich und gab den Weg in einen mit ebenso dicken wie teuren Teppichen ausgestatteten Flur frei. Die beiden Agenten orientierten sich kurz und wandten sich dann nach links und den Gang entlang. Kurz bevor dieser eine Biegung machte, fanden sie die Tür zu Wrights Appartement. Selbst, wenn dort nicht die Ziffer Drei geprangt hätte, hätten sie sofort gewusst, dass dies ihr Ziel war, denn auf Taillenhöhe war ein schwarz-gelbes Absperrband angebracht, welches immer dann verwendet wurde, wenn ein Tatort abgesichert werden musste. Direkt dahinter stand ein Uniformierter mit vor dem flachen Bauch gefalteten Händen.
»Maddox und Fulton, FBI«, sagte der Agent und zeigte seine Dienstmarke vor.
Der Polizist hob das Absperrband, damit die beiden Beamten darunter durchtauchen konnten.
»Sam!«, rief Fulton.
»Hey Nici, das ist ja eine Überraschung.«
»Was machst du denn hier?«
»Warten, bis die Erwachsenen übernehmen«, antwortete der Detective lächelnd. »Hätte ich gewusst, dass ihr beide kommt, hätte ich hier aufgeräumt.«
»Untersteh dich«, schalt ihn die Agentin gespielt, um dann wieder ernst zu werden. »Also, was ist hier los?«
»Vor einer Stunde wurde der bekannte und geschätzte Anwalt Peter Wright von der Putzfrau aufgefunden. Er hing an einem Kronleuchter, erhängt mit seiner eigenen Krawatte.«
»Autsch«, kommentierte Maddox.
»Und was das Interessanteste ist: Genau wie eine gewisse andere Person hatte er sein Geschlechtsteil im Mund.«
»Noch mal autsch.«
»Sie sagen es, Carl. Ich denke, ihr beide wisst schon Bescheid, dass er Mason vor Gericht vertreten hat, oder?«
»Ja, das ist uns bekannt«, bestätigte Fulton. »Schöner Mist.«
»Übernehmt ihr?«
»Auf jeden Fall. Carl, ich glaube, wir haben ein Problem.«
»Wenn du damit meinst, dass unser Freund aus dem Park auch hierfür verantwortlich ist, dann bin ich voll und ganz deiner Meinung. Pass auf, du schaust, was du hier machen kannst, und ich spreche mal mit dem Empfangsmitarbeiter. Der müsste ja herausfinden können, wer Zugang zu diesem Gebäude hatte.«
»Okay, wir treffen uns dann unten.«
»Ich will doch nur wissen, wer seit gestern Abend dieses Gebäude betreten hat«, sagte Maddox nicht zum ersten Mal.
»Diese Daten würde ich Ihnen wirklich gerne geben«, antwortete Francis entschuldigend, »aber leider bin ich dazu nicht befugt, solange Sie keine schriftliche Anweisung eines Richters vorlegen können.«
»Warum sind Sie eigentlich so stur?«
»Weil ich diesen Beruf nicht meiner laschen Haltung zu geltenden Gesetzen zu verdanken habe. Verstehen Sie bitte, dass es einfach nicht möglich ist, ohne …«
»Ja, ich habe schon verstanden. Ihnen ist aber hoffentlich klar, dass Sie polizeiliche Ermittlungen behindern, indem Sie auf Ihre Haltung bestehen.«
»Ich handele nach bestem Wissen und Gewissen.«
»Was ist los?«, wollte Fulton wissen.
Sie war vor wenigen Sekunden aus dem Fahrstuhl getreten und hatte die lebhafte Diskussion mitangehört.
»Der Pinguin will nicht damit herausrücken, wer sich in den vergangenen Stunden hier aufgehalten hat.«
»Ich darf es nicht«, erwiderte Francis in sachlichem Tonfall. »Es verstößt gegen das Gesetz, wenn kein schriftlicher Durchsuchungsbeschluss vorliegt.«
»Carl, du gehst jetzt raus und schnappst frische Luft«, beschied Fulton. »Ich komme gleich nach.«
Wütend, aber ohne Widerworte, stapfte Maddox nach draußen und setzte sich auf eine nahe stehende Steinbank. Durch die Glastür, die im Gegensatz zum Rest des Gebäudes nicht verspiegelt war, konnte er sehen, wie sich die Agentin mit dem Empfangsangestellten unterhielt. Natürlich konnte er kein Wort verstehen, und auch des Lippenlesens war er nicht mächtig, aber den sanften Gestiken seiner Partnerin nach zu urteilen, schien es ein nettes Gespräch zu sein. Schließlich wandte sich Fulton um und ging zur Eingangstür, wo sie sich noch einmal umdrehte und dem Mitarbeiter zuwinkte.
Die Agentin kam zu der Steinbank, setzte sich neben ihren Partner und blickte versonnen in den Himmel.
»Und?«, wollte Maddox wissen.
»Er ist gerade dabei, die Besucherdaten der letzten vierundzwanzig Stunden zusammenzustellen und sie auf einen USB-Stick zu ziehen.«
»Wie hast du ihn herumgekriegt?«
»Das ist ein Geheimnis«, erwiderte sie keck.
»Ich bin jetzt gerade echt nicht in der Stimmung für Spielchen.«
»Tut mir leid, so war es nicht gemeint. Aber es ist wirklich ein Geheimnis. Ich habe ihm versprochen, dass es unter uns bleibt.«
»Ooookay«, antwortete der Agent gedehnt. »Oben was rausgefunden?«
»Selbstmord war das auf keinen Fall, wie du dir sicher denken kannst. Danach zu urteilen, dass Wright seinen eigenen Dödel im Rachen hatte, ist es ziemlich klar, dass es sich um denselben Täter wie bei Mason handelt.«
»Definitiv. Also ein Doppelmörder. Der Fall wird interessanter, als ich dachte.«
»Francis meinte übrigens, dass er die Daten in wenigen Minuten fertig hat. Lass uns darauf warten, und dann ab in die Pathologie.«
Zum Glück für die beiden Agenten befand sich die New Yorker Pathologie nur einige Hundert Meter von ihrem Büro entfernt. Die Sonne schien, aber es war trotzdem nicht zu heiß, was in den Straßenschluchten Manhattans eine deutliche Erleichterung war.
»Wollen wir laufen?«, fragte Maddox, der trotz der Temperaturen sein Sakko trug.
»Gern«, erwiderte seine Partnerin. »Etwas frische Luft ist immer gut.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob man in New York wirklich von frischer Luft sprechen kann. Aber Bewegung schadet nie.«
»Dir sowieso nicht«, stellte sie mit einem Blick auf den kleinen Bauchansatz ihres Partners fest.
»Hör mal«, sagte er in gespielter Entrüstung und strich sich liebevoll über den Bauch. »Das sind alles Muskeln.«
»In welchem Aggregatszustand?«
»Schlummernd. Wenn ich sie wecke, werden sie aber stahlhart.«
»Das kannst du deinem Freund erzählen.«
»Könnte ich, wenn ich einen hätte, aber du weißt ja, dass das FBI meine einzige Liebe ist.«
Fulton winkte ab und wandte sich nach rechts. Direkt am westlichen Ende des rund einhundertneunundsiebzig Meter hohen Gebäudes, in dem sich ihr Büro befand, führte der Broadway vorbei, der für seine unterschiedlichsten Theater, Musicals und andere Shows weltweit berühmt war. In dieser Gegend allerdings versprühte er nicht den Glamour wie weiter nördlich am Times Square, denn hier war er nur eine Straße unter vielen. Wie immer zu dieser Tageszeit waren die Gehsteige voll von Menschen, die scheinbar unkoordiniert herumwogten.
»Warum lassen sich die Leute eigentlich freiwillig auf so einen engen Raum pferchen?«, fragte Fulton ihren Kollegen, während sie sich ihren Weg durch die Menschenmasse bahnten.
»Ob das wirklich freiwillig ist, kann ich nicht sagen«, antwortete Maddox. »Ich denke, das hat irgendwie mit dem angeborenen Herdentrieb zu tun.«
»Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich mir vor zwanzig Jahren nichts sehnlicher gewünscht habe, als in einer Menschenmasse unterzugehen und nicht wahrgenommen zu werden, aber jetzt ist das irgendwie anders. Nun denke ich immer öfter daran, aufs Land zu ziehen.«
»Du bist in Kansas aufgewachsen«, erinnerte Maddox sie. »Da gab es nichts anderes als leere Gegenden. Kein Wunder, dass du da weg und in die Großstadt wolltest, wo etwas los war. Seit wann wohnst du hier?«
»Inzwischen zehn Jahre.«
»Vielleicht ist das einfach genug für dich. Du kennst das weite Land, und jetzt kennst du auch die enge Stadt. Vielleicht will dir dein Unterbewusstsein mitteilen, dass es Zeit ist, zurückzukehren.«
»Nach Kansas bringen mich keine zehn Pferde mehr zurück«, erklärte sie fest.
»Dir steht die Welt offen. Falls dein Konto aber nicht so gut gefüllt ist, kannst du immer noch innerhalb der Vereinigten Staaten umziehen. Ich bin mir sicher, dass Lauders kein Problem damit hätte, wenn du dich versetzen lassen willst.«
»So einfach ist das nicht. Ich würde dich schließlich im Stich lassen«, erklärte sie ernst.
»Okay, das ist natürlich ein schwerwiegender Punkt«, gab er zu. »Ich würde dich natürlich sehr vermissen, Nici. Aber wenn du wirklich woandershin willst, dann tu es.«
»Was ist mit dir?«, fragte sie. »Du bist doch auch in einer ländlichen Umgebung aufgewachsen.«
»Und mir gefiel es dort, aber es gefällt mir auch hier. Es ist dieser Gegensatz, der New York für mich so attraktiv macht. Und wenn es mir hier doch zu laut oder zu eng wird, kann ich immer noch bei meinen Eltern Urlaub machen. Du weißt ja, wie ruhig es dort auf der Ranch ist.«
»Oh ja, da ist es wirklich sehr schön.«
»Meine Mom hat übrigens gefragt, wann du mal wieder zu Besuch kommst. Sie hat schon länger nichts mehr von dir gehört.«
»Tut mir leid, ich wollte sie immer mal wieder anrufen, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen.«
»Kein Problem, sie ist dir nicht böse, du kennst sie ja.«
»Vielleicht, wenn wir diesen Fall abgeschlossen haben.«
»Dann halten wir uns mal ran, damit wir bald Urlaub machen können«, stimmte Maddox lächelnd zu.
Fulton erwiderte das Lächeln nicht, denn in diesem Moment dachte sie an ihre eigenen Eltern.
Heute feierte Nici ihren vierzehnten Geburtstag. Vor einigen Tagen hatten ihre Eltern während des Frühstücks den Vorschlag gemacht, die Feier im eigenen Haus zu veranstalten und all ihre Freunde einzuladen. Nici hatte lautstark protestiert, denn ihrer Meinung nach würden ihre Freunde denken, dass sie noch ein von ihren Eltern abhängiges Kleinkind war, wenn die Feier bei ihr zu Hause stattfinden würde. Vor allem, wenn ihre Mutter und ihr Vater ebenfalls im Haus wären und als Aufpasser fungieren würden. Ihr Vater hatte gelächelt und ihr versprochen, dass weder er noch ihre Mutter anwesend sein würden. Das Mädchen musste nach längerem Nachdenken zugeben, dass es eine gute Idee war, zu Hause zu feiern. Man musste nirgendwo hin, man musste seine Eltern nicht nachts anrufen und sie bitten, abgeholt zu werden, um am nächsten Tag dafür ausgeschimpft und unter Hausarrest gestellt zu werden. Entsprechend hatte sie sich mit diesem großzügigen Vorschlag einverstanden erklärt.
»Viel Spaß beim Feiern«, sagte ihr Vater, Edward, als gerade die ersten Gäste eintrudelten.
Er umarmte seine Tochter kurz und kräftig und machte mit ihr noch ein High-Five, bevor er zum Wagen ging. Ihre Mutter, Amanda, war nicht so kurz angebunden, sondern hielt Nici noch eine gefühlte Ewigkeit in den Armen, und erst, als sich Edward vernehmlich räusperte, ließ sie ihre Tochter schließlich los und wandte sich schnell ab, damit diese die Tränen in ihren Augenwinkeln nicht sah.
»Mom, du tust ja gerade so, als würden wir uns nie wiedersehen«, frotzelte Nici. »Sind doch nur ein paar Stunden.«
»Ich weiß, mein Schatz. Es ist nur … ach, noch vor wenigen Jahren wolltest du nirgendwo hin, wenn wir nicht dabei waren, und jetzt bist du schon so groß und kannst auf dich selbst aufpassen.«
»Amanda, kommst du?«, rief Edward vom Auto herüber.
»Lass Dad nicht warten«, sagte Nici. »Du weißt doch, wie er ist, wenn er ungeduldig wird.«
»Pass auf dich auf, okay?«, bat Amanda sie.
»Natürlich. Bis morgen!«
Als die beiden Erwachsenen eingestiegen waren und rückwärts die Einfahrt herunterrollten, winkte Nici ihren Eltern noch einmal zum Abschied zu und atmete dann tief durch. Endlich waren sie aus dem Haus. Jetzt konnte die Feier losgehen!
»Vorsicht!«, rief Maddox und hielt seine Partnerin gerade noch rechtzeitig am Ärmel fest.
Nur einen halben Meter vor ihr rauschte ein Lastwagen hupend an ihr vorbei.
»Was zum …«, schrie sie dem Fahrer hinterher. »Bist du blind?«
»Das könnte ich dich auch fragen«, sagte Maddox. »Du wolltest bei einer roten Ampel einfach weitergehen.«
»Ehrlich?«
»Ja«, bestätigte er.
»Tut mir leid«, antwortete sie. Ob sie damit ihren Kollegen oder den Lastwagenfahrer meinte, blieb sie schuldig.
»Ist etwas mit dir?«, fragte er.
»Nein, alles okay. Ich war nur in Gedanken.«
Maddox sah sie noch für einige Augenblicke an und beschloss dann, es dabei zu belassen. »Komm, wir sind gleich da.«
Hinter der Ampel, die inzwischen auf Grün geschaltet hatte, befand sich die Pathologie, wo der Leichnam von Jacob Mason untersucht wurde. Die Agenten traten durch die dunkle Eingangstür und gingen zum Empfangsschalter hinüber.
»Sie wünschen?«, fragte ein dunkelhäutiger Mann in grauer Uniform, der hinter dem Tresen saß. Sein Namensschild wies ihn als Michael Walker aus.
»Special Agents Maddox und Fulton. Wir möchten jemanden im Keller besuchen.«
»Wollen wir das nicht alle?«, scherzte Walker.
Als er bemerkte, dass die Agenten nicht auf seinen Witz reagierten, setzte er wieder eine gelangweilte Miene auf. »Sorry. Bitte tragen Sie sich hier ein«, sagte er und schob ein Klemmbrett mit angehängtem Stift zu ihnen rüber.
Die beiden Agenten füllten das Formular aus und nahmen dann ihre nummerierten Besucherausweise entgegen, die sie an ihre Revers hefteten. Mithilfe des Aufzugs im Tiefgeschoss angekommen, wandten sie sich zielstrebig nach links und gelangten nach wenigen Schritten zu einer dicken Metalltür, an deren rechter Seite ein quadratischer Schalter mit einer Kantenlänge von zehn Zentimetern in die Wand eingelassen war.
Fulton betätigte den Schalter, woraufhin innen ein gedämpftes Summen ertönte. Sie mussten geschlagene drei Minuten warten, bis sich die Tür seitlich öffnete.
»Nici, Carl, mit euch habe ich heute schon gerechnet«, sagte der kahlköpfige Mittvierziger, der ihnen lächelnd entgegenblickte.
»Steve«, begrüßten Maddox und Fulton den Pathologen mit einem ebenso breiten Lächeln.
»Kommt rein«, erklärte der Pathologe und machte eine einladende Handbewegung.
In den Heiligen Hallen, wie Steve sie gerne nannte, war es sehr kühl. Das musste es auch sein, denn hier waren die Leichen untergebracht, bei denen eine Obduktion angeordnet worden war. Während sich die meisten der anwesenden Toten in einer der Kühlkammern befanden, die an der linken Zimmerwand aufgereiht waren, lag auf einem am Boden verschraubten Stahltisch der Leichnam von Jacob Mason.
»Ich habe mir erlaubt, unseren neuesten Kunden vorzuziehen«, sagte Steve zu den beiden Agenten gewandt.
»Ich dachte, es wäre sowieso geregelt, dass bei einer Mordermittlung alles andere hinten anzustellen ist«, warf Fulton ein.
»Ist auch so«, bestätigte der Pathologe. »Allerdings habe ich zurzeit noch ein zweites Mordopfer. Der arme Teufel kam gestern Mittag rein und wäre eigentlich als Erstes dran. Ihr wisst schon: Wer zuerst kommt, wird zuerst bedient. Aber ich dachte mir Pfeif drauf.«
»Danke dir«, sagte Maddox ehrlich. »Was hast du denn bisher herausfinden können?«
»Wie ihr sicher selbst schon wisst, handelt es sich bei dem Toten um Jacob Joseph Mason, weiß, männlich, dreiundvierzig Jahre alt. Er starb in der vergangenen Nacht zwischen dreiundzwanzig Uhr und drei Uhr morgens durch die Durchtrennung seiner Halsschlagader, beziehungsweise durch den dadurch erlittenen Blutverlust.«
»Was ist mit der Tatwaffe?«, fragte der Agent.
»Hier möchte ich mich nicht hundertprozentig festlegen, aber der Schnitt erfolgte meines Erachtens nach mit einem Fleischermesser.«
»Wie kommst du darauf?«
»Für ein Jagdmesser ist der Schnitt zu sauber«, erklärte der Pathologe. »Ein handelsübliches Jagdmesser verfügt nämlich über eine gezackte Klinge. Die Haut ist aber so sauber durchgeschnitten wie ein Blatt Papier mit einer Schere.«
»Könnte es dann nicht auch eine Schere gewesen sein?«, warf Fulton ein.
»Diese passt nicht zur Einstichstelle. Seht ihr, mit einer Schere hätte man stark zudrücken müssen, um die Haut zu durchtrennen. Mit einem gut geschliffenen Messer muss man nur ansetzen, und schon ist man drin.«
»Könnte es auch ein Skalpell gewesen sein?«
»Das ist natürlich auch möglich«, gab Steve zu. »Aber der Schnitt ist eigentlich zu breit dafür.«
»Okay. Fällt dir was dazu ein, dass er sein eigenes Geschlechtsteil im Mund hatte, als er gefunden wurde?«
»Ich schätze mal, hier hat sich jemand einen Scherz erlaubt«, antwortete der Pathologe. »Einen ziemlich makabren obendrein, wenn ihr mich fragt. Wenn ihr wissen wollt, ob er sein Gemächt bereits im Mund hatte, bevor ihm die Kehle durchgeschnitten wurde, kann ich das weder bestätigen, noch verneinen.«
Maddox nickte. »Denkst du, dass seine Genitalien mit demselben Werkzeug entfernt wurden, mit dem auch sein Hals durchtrennt wurde?«
»Sieht für mich ganz so aus. Die Schnitte wirken verdammt ähnlich auf mich.«
»Gibt es noch etwas, was wir wissen sollten?«
»Das ist bisher alles«, antwortete der andere Mann. »Wenn ich noch etwas herausfinde, schicke ich euch eine Mail.«
»Alles klar. Übrigens, in Kürze wird noch ein Kunde kommen.«
»Ich habe genug Kammern zur Verfügung«, erklärte Steve und zeigte mit der ausgestreckten Hand auf die zahlreichen Schubladen an den Wänden.
»Denkst du, dass du ihn auch vorziehen kannst? Sein Name ist Peter Wright.«
»Geht klar, der andere Kollege im Eisfach kann noch etwas warten, der läuft ja nicht weg.«
»Danke dir für deine Zeit.«
Der Pathologe breitete die Arme mit den Handflächen nach oben aus, als wollte er sagen Dafür werde ich bezahlt und verabschiedete die beiden Agenten dann.
Als sie ihre Besucherausweise am Empfang im Erdgeschoss zurückgegeben hatten und nach draußen traten, hatte sich das Wetter geändert. An die Stelle der vorhin noch scheinenden Sonne war eine fast geschlossene Wolkendecke getreten, und in der Luft lag der Geruch von baldigem Regen.
»Wow, das ging schnell«, kommentierte Maddox und sah nach oben. »Lass uns zurück ins Büro und schauen, ob es schon etwas Neues von der Spurensicherung gibt«, schlug er vor.
»In Ordnung«, erklärte sich Fulton einverstanden und warf einen Blick auf ihre Armbanduhr.
Es war später Nachmittag.
»Und falls noch nichts da ist, machen wir Feierabend«, erriet der Agent ihre Gedanken.
Fulton grinste, denn er kannte sie so gut, dass er oftmals bereits im Voraus wusste, was sie dachte, und er hatte die Fähigkeit, sie aufzumuntern, wenn es ihr nicht gut ging.
»Aber dieses Mal rennst du nicht über rote Ampeln«, fügte er mit mahnend erhobenem Zeigefinger hinzu.
Fulton musste unwillkürlich lächeln. Ja, es tat gut, so einen Menschen um sich zu haben.
»Und?«, fragte Fulton.
»Nichts«, erwiderte Maddox.
»Ich schätze, dass die Jungs heute keinen Bericht mehr abliefern werden.«
»Dann lassen wir es für heute gut sein und gehen nach Hause. Hast du eigentlich schon etwas gegessen?«
»Heute noch gar nicht«, erklärte die Agentin.
»Nici, du musst unbedingt mehr essen«, schalt ihr Partner sie.
»Ich weiß, aber ich habe einfach keinen Hunger.«
»Weißt du was, ich lade dich ein.«
»Danke, aber ich möchte eigentlich lieber nach Hause. Da werde ich auch was essen.«
Maddox warf ihr einen skeptischen Blick zu.
»Ich verspreche es«, sagte sie feierlich und legte eine Hand auf ihre Brust.
»Na gut. Was machst du denn heute sonst noch?«, fragte Maddox.
»Nichts«, erklärte sie.
»Das ist aber reichlich wenig.«
»Ich möchte ein wenig entspannen und dann früh schlafen gehen, damit ich morgen für die Befragungen fit bin. Und du?«
Ihr Kollege fuhr sich durch die Haare. »Ich werde mich noch um die Angehörigen der Opfer kümmern. Nachsehen, wo sie sich aufhalten und einen Plan entwickeln, wie und wann wir sie uns vornehmen können.«
»Die hatte ich tatsächlich ganz vergessen«, sagte Fulton entschuldigend. »Kann ich dir dabei irgendwie helfen?«
»Nein, ist schon gut, ehrlich. Das wird nicht lange dauern, und dann werde ich auch nach Hause gehen. Nach der gestrigen Nacht bin ich froh, etwas Ruhe zu bekommen.«
»Wann ist denn der erste Termin morgen?«, wollte sie wissen.
»Um neun Uhr«, antwortete ihr Partner nach einem kurzen Blick auf seinen Terminkalender.
»Okay, dann treffen wir uns um Acht hier, dann haben wir noch etwas Zeit, uns vorzubereiten.«
»Einverstanden.«
Fulton stand auf und warf sich ihre Jacke über.
»Nici?«, fragte Maddox.
»Was denn?«
»Gute Nacht.«
»Dir auch.«
Da Fulton keinen eigenen Wagen hatte – in New York City brauchte sie schlicht keinen –, nahm sie die U-Bahn, um nach Hause zu gelangen. In der zu dieser Tageszeit gerammelt vollen Metro fand sie keinen Sitzplatz, darum ging sie so weit wie möglich an die Seite und hielt sich an einem der von der Decke baumelnden Haltegriffe fest. Dies war auch bitter nötig, denn bei der Fahrt schaukelten die Waggons oft stark hin und her, und sie wollte es unbedingt vermeiden, gegen einen anderen Fahrgast zu stolpern. Ihr Magen meldete sich zu Wort und gab ein lautstarkes Grummeln von sich. Sanft strich sie über ihren Bauch und flüsterte: »Alles ist gut.«
Eine alte Dame, die vor ihr auf einem Sitz saß, lächelte wissend.
»Schwangerschaft ist etwas Schönes«, sagte sie.
Die Agentin lächelte. »Ich bin nicht schwanger, ich habe nur Hunger.«
»Oh«, meinte die Ältere. »Tut mir leid.«
»Ist schon in Ordnung, machen Sie sich keine Sorgen.«
»Haben Sie denn Kinder?«
»Nein«, antwortete Fulton. »Und Sie?«
»Zwei Söhne. Sie wohnen drüben in Los Angeles. Ich sehe sie leider nur sehr selten. Ich bin zu alt, als dass ich lange Reisen schaffen würde, und meine Jungs haben immer viel zu tun.«
»Das ist sehr schade.«
»Finde ich auch«, erwiderte die alte Dame mit trauriger Miene. »Ich würde sie gerne mal wieder sehen. Auch meine Enkel vermisse ich sehr.«
»Telefonieren Sie wenigstens regelmäßig miteinander?«
»Leider nicht. Meine Söhne sagen, dass sie viel Arbeit haben.«
Typisch, dachte Fulton. Scheren sich nicht um ihre Mutter und warten darauf, dass sie endlich das Zeitliche segnet, um dann das Erbe abkassieren zu können.
Der Zug wurde langsamer und fuhr in die nächste Station ein.
»Ich muss jetzt leider aussteigen«, erklärte die Agentin entschuldigend.
»Ist schon in Ordnung. Schönen Abend«, wünschte ihr die Frau.
»Ihnen auch, danke.«
Die Agentin zwängte sich zwischen zwei breit gebauten Männern hindurch und stieg aus der U-Bahn. Auf dem kurzen Fußweg machte sie noch einen Abstecher zu ihrem Lieblings-Italiener, der nur zweihundert Meter von ihrem Zuhause entfernt war. Der Laden war wie immer voll, denn hier wurde nachweislich die beste Pizza des gesamten Stadtteils gemacht.
»Nici, schön, dich zu sehen«, begrüßte sie der Inhaber der kleinen Pizzeria ebenso laut wie fröhlich mit breitem italienischem Akzent.
»Pietro, wie geht es dir?«, fragte sie ihn.
»Gut, gut. Meine Bambina gedeiht prächtig!«
»Freut mich sehr. Wie geht es Angelina?«
»Sie erholt sich ebenfalls gut. Wie immer für dich?«
»Yap.«
Fulton setzte sich auf den linken der beiden Hocker, die fest am Tresen verschraubt waren.
Die kleine Allegra war vor etwas mehr als vier Monaten geboren worden. Während der Entbindung hatte es schwere Komplikationen gegeben, sodass die Mutter, Angelina, einige Tage auf der Intensivstation hatte bleiben müssen. Pietro hatte Tag und Nacht im Krankenhaus verbracht und seine Zeit zwischen der Neugeborenen und seiner Frau aufgeteilt. Umso größer war die Feier gewesen, als alle schließlich gesund nach Hause hatten gehen dürfen. Fulton war ebenfalls zu den Feierlichkeiten eingeladen gewesen, obwohl sie nicht zur Familie gehörte. Sie erinnerte sich daran, wie selbstverständlich alle anderen Familienmitglieder sie in ihrer Mitte begrüßt und sich um sie gekümmert hatten, allen voran Pietros Mutter. Sie war inzwischen weit über achtzig, aber immer noch fest im Leben stehend und so herzlich, wie es nur eine italienische Mutter sein konnte.
»Was gibt es Neues aus der Welt des Verbrechens?«, wollte Pietro wissen, während er ein Pizzablech einfettete, den Teig ausrollte und die Zutaten auflegte.
»Wie immer«, erwiderte die Agentin. »Die Bösen tun Böses, und die Guten fangen sie und sperren sie ein. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los.«
»Ja, das kommt mir bekannt vor. Bei uns in Italien ist die Mafia noch immer ganz groß. Egal, was die Polizei tut, es kommen immer neue Übeltäter nach.«
Bei dem Ausdruck bei uns in Italien musste Fulton unwillkürlich lächeln, denn sie wusste, dass Pietro, genau wie seine Eltern, in den USA geboren war. Ebenso war ihr bekannt, dass er seinen italienischen Akzent nur vorgab. Für die Touristen, hatte er ihr einmal zugeflüstert, als sie ihn dabei ertappt hatte, mit einem einwandfreien New Yorker Akzent zu sprechen. Der schwarze Schnauzbart, der seine Oberlippe vollständig bedeckte und ihn ein wenig, wie eine bekannte Videospielfigur aussehen ließ, war im Übrigen genauso falsch wie die italienische Aussprache.
»Wie geht es dem jungen Mann, der kürzlich mit dir hier war?«, wollte Pietro wissen.
»Du meinst Carl? Dem geht es gut.«
»Arbeitet ihr zusammen?«
»Ja, wir sind Partner.«
»Und … ist da vielleicht noch etwas mehr zwischen euch?«, fragte der Italiener mit unschuldigem Gesichtsausdruck.
»Nein, ganz bestimmt nicht«, antwortete Fulton und winkte ab. »Beruflich arbeiten wir sehr gut zusammen, und privat sind wir Freunde, aber da sind keine romantischen Gefühle. Weder von seiner noch von meiner Seite aus.«
»Und du bist dir ganz sicher, dass er nicht vielleicht mehr für dich empfindet?«
»Absolut sicher«, bestätigte die Agentin.
»Was macht dich denn so sicher?«
»Er ist homosexuell.«
»Oh«, meinte der Pizzabäcker. »Das habe ich nicht gewusst.«
»Woher hättest du das auch wissen sollen? Es ist ja nicht so, als würde Carl mit einem Schild um den Hals herumlaufen, auf dem steht Ich bin schwul. Die Zeiten sind vorbei, wo man sich für seine sexuelle Ausrichtung rechtfertigen musste.«
»Hier vielleicht. Zu Hause in Bella Italia ist das noch ein wenig anders.«
»Dann können wir ja froh sein, dass wir in den aufgeklärten USA sind.«
Pietro nickte bestätigend und wandte sich dann dem Pizza-Ofen zu.
Fulton nutzte die Gelegenheit, um auf ihr Handy zu schauen, ob eine neue Nachricht für sie eingetroffen war. Doch weder in den diversen Messenger-Diensten, die sie nutzte, noch in ihrem SMS-Ordner befand sich auch nur eine ungelesene Mitteilung.
Die nächsten zehn Minuten verbrachte sie damit, das chaotische Muster auf dem Tresen zu betrachten, welches sich aus jahrelanger Benutzung dort gebildet hatte.
»Fertig«, verkündete Pietro schließlich feierlich und überreichte Fulton eine Pizzaschachtel, die so groß war, dass ein Autoreifen hineingepasst hätte. »Manchmal frage ich mich, ob du das wirklich alles allein isst.«
»Glaub mir, ich verdrücke das Ding komplett selbst.«
»Und nimmst dabei kein Gramm zu.«
»Ich bin viel an der frischen Luft, das hält fit.«
»Vielleicht sollte ich das auch einmal probieren«, antwortete Pietro und tätschelte in einer Mischung aus Liebe und Abscheu seinen Bauch.
»Ich gehe jetzt nach Hause. Danke für die Pizza. Grüße bitte Angelina und Allegra von mir.«
»Mache ich«, antwortete der andere.
Bis zu ihrem Appartement waren es nur drei Minuten. Entsprechend war die Pizza noch warm, als die Agentin die Wohnungstür hinter sich zufallen ließ und sich die Schuhe abstreifte.
»Home Sweet Home«, sagte sie in die Leere des Zimmers, welches sich in der Aufteilung nur unwesentlich von demjenigen unterschied, in dem Ellen Jannings lebte. Sie legte die Pizza auf dem Küchentisch ab und ging zurück zum Eingang, um ihre Jacke aufzuhängen und die Wohnungstür von innen abzuschließen. Als sie sich wieder umdrehte, sah sie, wie sich etwas Haariges an ihrem Essen zu schaffen machte.
»Spot!«, rief Fulton. »Nimm sofort deine Nase da raus!«
Die kleine, schwarz-weiß gefleckte Katze hielt nicht einmal für einen Moment inne, um wenigstens so zu tun, als würde sie interessieren, was ihre Besitzerin sagte. Stattdessen versuchte sie ungeniert weiter, irgendwie an den köstlich duftenden Inhalt des Kartons zu gelangen.
»Du bekommst ja deinen Anteil«, verkündete die Agentin. »Aber nur, wenn du dich jetzt brav geduldest.«
Während sie mit weiten Schritten den Raum durchmaß, nahm sie im Vorbeigehen ein scharfes Messer von der Wand und setzte sich dann aufs Sofa. Um das Tier nicht zu verletzen, hob sie es hoch und setzte es behutsam neben sich. Die Katze begann unverzüglich, zu schnurren, ob nun aus dem Grund, dass sie sich wohlfühlte, oder um ihr Frauchen milde zu stimmen, wusste Fulton nicht. Sie öffnete den Pizzakarton, riss den Deckel ab und schnitt dann ein großzügiges Stück des Essens ab. Dann drapierte sie Spots Anteil auf dem Pappdeckel und zerkleinerte das Pizzastück in mundgerechte Happen.
»Aber nicht alles auf einmal essen«, sagte sie ruhig. »Ist noch heiß, also gut pusten.«
Die Katze machte sich unverzüglich daran, ihr Mahl zu vertilgen, während Fulton weitere Teile für sich selbst abschnitt. Als sie fertig war, nahm sie eines der Stücke, welches doppelt so groß wie ihre Hand war, und biss herzhaft hinein. Sie kaute langsam und gründlich, um auch wirklich alle Nuancen des Geschmacks in sich aufzunehmen. Spot, die seit heute früh nichts mehr gegessen hatte, aß ihr Stück innerhalb kürzester Zeit auf und verlangte mit klagendem Blick mehr. Natürlich erfüllte Fulton ihr diesen Wunsch, und gemeinsam benötigten sie weniger als zehn Minuten, bis sie die Pizza von der Größe eines Wagenrads vollständig aufgegessen hatten. Die Agentin tupfte sich den Mund mit einem Küchentuch ab und ließ sich dann schwer nach hinten sacken. Spot bewertete dies offenbar als Einladung, kletterte behände auf den Bauch ihrer Besitzerin und begann, mit ihren Pfoten sanfte Pumpbewegungen auszuführen.
»Du weißt, was ich brauche«, sagte Fulton sanft und streichelte den Rücken des Tieres, das unermüdlich pumpte und dabei schnurrte wie ein Traktor.
Eigentlich hatte Fulton vorgehabt, ihr Buch – einen Liebesroman, der im Zweiten Weltkrieg spielte und von der unmöglichen Beziehung zwischen einem deutschen Soldaten und einer jüdischen Zivilistin handelte – zu lesen, aber ein Blick auf den dicken Wälzer reichte aus, um diesem Vorhaben zumindest für heute einen Riegel vorzuschieben. Stattdessen lehnte sie sich noch weiter zurück und legte den Kopf in den Nacken. Sie bemerkte gar nicht, wie ihr die Augen zufielen.
Die Party war in vollem Gange, und ihre Gäste amüsierten sich prächtig. All ihre Freunde waren gekommen, um mit ihr zu feiern. Glücklicherweise war bisher noch nichts zu Bruch gegangen, und Nici hoffte, dass das auch so blieb. Sie wollte ihren Eltern später nicht beichten müssen, dass das in sie gesetzte Vertrauen ungerechtfertigt gewesen war.
Im Verlauf des Abends hatte Mike, ein Bekannter aus der Schule und ihr heimlicher Schwarm, mehrfach mit ihr Augenkontakt aufgenommen, sich dann aber immer wieder anderen Leuten zugewandt. Sie wusste nicht, was sie davon halten sollte, ebenso wenig wie von dem Gefühl in ihrem Bauch, als würden tausend Schmetterlinge gleichzeitig mit den Flügeln schlagen. Schließlich hatte es ihre beste Freundin Clara nicht mehr ertragen, war zu dem Jungen hinüber gegangen und hatte ihm etwas ins Ohr geflüstert. Das Ergebnis war gewesen, dass der Junge mit zwei randvoll gefüllten Gläsern Rotwein zu ihr gekommen war und ein Gespräch mit ihr begonnen hatte. Jetzt lagen sie im dunklen Garten unter einer hohen Eiche und knutschten. Er war zwei Jahre älter als sie und schien viel Erfahrung im Küssen zu haben, denn er war manchmal sehr sanft, beinahe zurückhaltend, während er im nächsten Moment fordernd die Zunge aus seinem Mund heraus- und in ihren hineinschob. Auch wusste er genau, was er mit seinen Händen anstellen musste. In einem abgelegenen Winkel ihres Gehirns flüsterte eine mahnende Stimme, dass sie aufpassen sollte, was sie tat. Aber diese Stimme wurde immer mehr von ihrem Verlangen in den Hintergrund gedrängt. Ja, sie war bereit, sich diesem Jungen hinzugeben. Er schien dies zu spüren und fuhr immer öfter sanft über ihre Oberschenkel, und jedes Mal wanderte die Hand ein wenig höher, sodass sie inzwischen schon beinahe ihren Schritt erreicht hatte. Gerade, als sie ihn dazu auffordern wollte, ihre Hose zu öffnen, wurden sie unsanft unterbrochen.
»Nici«, rief Clara von der Terrasse aus in die Dunkelheit.
Das Mädchen wollte sich aus der Umarmung befreien, aber Mike hielt sie fest.
»Lass sie rufen«, flüsterte er und schob seine Hand noch ein bisschen höher.
»Nici!«, schrie ihre Freundin noch einmal, dieses Mal drängender.
»Warte kurz, ich will wissen, was Clara will«, sagte Nici.
»Soll sie doch warten. Wir haben schließlich etwas vor.«
»Nein«, widersprach sie ihm jetzt vehement und drückte den Jungen von sich weg, auch wenn es ihr schier das Herz brach.
»Echt jetzt?«, fragte er unwirsch. »Du willst diesen Moment ruinieren, indem du deine Freundin mir vorziehst?«
Mit einem Mal waren die Schmetterlinge in ihrem Bauch verschwunden, und auch das Verlangen nach diesem Jungen löste sich in Millisekunden in Luft auf.
»Clara ist meine beste Freundin. Es hat sicher einen guten Grund, dass sie nach mir ruft«, sagte Nici kühl.
Zumindest hoffe ich es, sonst drehe ich ihr den Hals um, fügte sie in Gedanken hinzu.
Das junge Mädchen löste sich vollends aus Mikes Umarmung, stand auf, klopfte sich das Gras von der Kleidung und ging dann zurück zum Haus.
»Erwarte nicht, dass ich noch hier bin, wenn du zurückkommst«, rief ihr der Junge hinterher.
Nici ignorierte ihn und trat auf ihre Freundin zu. »Was willst du?«, fragte sie mürrisch.
»Tut mir wirklich leid, dass ich euch gestört habe, aber die Polizei steht vor der Tür und will mit dir reden.«
»Bist du sicher, dass es die Polizei ist?«, fragte das Mädchen zweifelnd.
»Ihre Marken und ihre Uniformen sehen jedenfalls verdammt echt aus«, erklärte Clara.
»Als ob du das beurteilen könntest.«
»Mein Papa ist selbst Polizist, vergiss das nicht. Ich weiß, wie Polizisten aussehen.«
»Ist ja schon gut«, sagte Nici entschuldigend. »Komm. Mal sehen, was die wollen.«
Gefolgt von ihrer Freundin, ging das junge Mädchen zur Haustür, wo zwei Männer in Uniform und eine Frau in dunklem Hosenanzug auf sie warteten.
»Guten Abend«, sagte sie höflich zu den Beamten.
»Guten Abend«, grüßte die Frau. »Bist du Nicole Fulton?«
»Ja, die bin ich. Wer sind Sie?«
»Mein Name ist Detective Muller. Gibt es einen Ort, wo wir ungestört reden können?«
Nici erinnerte sich daran, dass ihre Eltern sie mehrfach ermahnt hatten, mit keinem fremden Erwachsenen allein zu sein.
»Lassen Sie uns hier reden. Geht es um die Party? Sind wir zu laut? Meine Eltern haben gesagt, sie hätten alle Nachbarn informiert, und keiner hätte ein Problem damit gehabt.«
»Nein, es geht nicht um die Lautstärke deiner Feier«, erklärte die Beamtin. »Es geht um deine Eltern.«
»Was ist mit ihnen?«, fragte Nici alarmiert. »Ist irgendwas passiert?«
»Nicole, es tut mir sehr leid, dir dies mitteilen zu müssen, aber … sie hatten einen Unfall.«
»Geht es ihnen gut? Nun reden Sie schon!«, verlangte Nici, die ahnte, dass es ihren Eltern nicht gut gehen konnte, wenn die Polizei mit drei Leuten hierherkam.
»Sie sind mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und einen Abhang hinabgestürzt. Nicole, deine Eltern sind tot. Es tut mir sehr leid.«
Das Mädchen spürte, wie ihr die Beine versagten, und wäre ihre Freundin Clara nicht da gewesen, um sie zu halten, wäre sie wie ein nasser Sack zu Boden gefallen. Auch Detective Muller griff geistesgegenwärtig zu und schaffte es, das Mädchen langsam zu Boden gleiten zu lassen.
»Nein …«, flüsterte Nici. »Neinneinnein …« Sie schüttelte so heftig den Kopf, dass ihr schwindlig wurde.
Die Polizistin sagte nichts, sondern hielt das Mädchen einfach nur fest. Auch Clara sagte kein Wort, legte stattdessen die Arme um ihre Freundin und versuchte, den eintretenden Schmerz so weit wie möglich zu lindern.
Fulton schlug die Augen auf und versuchte, sich zu orientieren. Die Straßenlaternen waren zwar die gesamte Nacht über eingeschaltet, aber eines der ersten Dinge, die sie sich nach ihrem Einzug vor vielen Jahren geleistet hatte, waren schwere blickdichte Vorhänge gewesen. Entsprechend war es in ihrem Wohnzimmer dunkel, und von draußen drang nur wenig Licht zu ihr herein. Die Kehle der Agentin war trocken. Langsam setzte sie sich auf und fuhr sich durch die verschwitzten Haare, bevor sie schwerfällig aufstand und zur Küchenzeile tapste, um sich ein Glas Leitungswasser einzuschenken. Sie nahm mehrere kleine Schlucke und behielt sie lange im Mund, um ihren Hals wenigstens etwas feuchter zu machen. Schließlich gewöhnten sich ihre Augen an das Halbdunkel, und im Zwielicht erkannte sie, dass Spot sie vom Fußende der Couch aus kritisch beäugte.
»Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe«, flüsterte Fulton und strich sanft über den Kopf des Tieres.
Die Katze schnaufte einmal vernehmlich und drehte sich dann um, als ob sie ihr mitteilen wollte, dass sie die Störung zwar nicht guthieß, der Agentin in ihrer allmächtigen Güte aber verzieh. Fulton überlegte, ob sie versuchen sollte, wieder einzuschlafen, aber sie war von ihrem Traum zu aufgekratzt. Sie hatte schon lange nicht mehr von dem schrecklichen Ereignis vor nunmehr dreiundzwanzig Jahren geträumt. Umso mehr war sie nun davon mitgenommen. Da an Schlaf jetzt nicht mehr zu denken war, entschied sie sich, den Tag zu beginnen. Als Erstes dehnte sie ihre Muskeln, streckte den Rücken durch und ließ langsam die Hüfte kreisen. Dann streckte sie die Arme nach oben und beugte sich langsam vor, während sie sich abwechselnd auf das linke und das rechte Bein lehnte. Spot sah sich dies an und beschloss, dass jetzt offenbar der geeignete Augenblick war, um sich der eigenen Hygiene zu widmen. Als die Agentin fertig war, warf sie einen Blick auf ihr Handy, um die Uhrzeit abzulesen. Es war halb vier Uhr morgens. Schulterzuckend ging sie erneut zur Küchenzeile und erweckte die Kaffeemaschine mit einem Knopfdruck zum Leben. Erst vor wenigen Monaten hatte sie eine Gehaltserhöhung bekommen, und von der ersten Zahlung hatte sie sich einen Vollautomaten geleistet. Das Gerät war teuer gewesen, aber sie bereute die Anschaffung nicht, denn so sparte sie wertvolle Zeit. Während der Kaffee durchlief, ging sie in das Badezimmer, welches so beengt war, dass kaum eine Person hineinpasste. Sie drehte den Wasserhahn auf und ließ das kühle Nass über ihre Hände und Arme fließen, bevor sie sich eine Handvoll Wasser ins Gesicht schaufelte. Dies alles tat sie, ohne einen Lichtschalter zu betätigen, denn sie fühlte, dass sie das grelle künstliche Licht jetzt nicht ertragen könnte. Zurück in der Küche nahm sie eine Tasse aus der Spüle, wusch sie kurz aus, stellte sie dann in die dafür vorgesehene Nische der Kaffeemaschine, drückte einen Knopf und ließ das heiße Gebräu in den Keramikbehälter laufen. Als die Tasse voll war, hielt Fulton sie unter ihre Nase und atmete den Duft tief ein. Dann nahm sie einen Schluck und fühlte, wie die Flüssigkeit zuerst in ihrem Mund und dann in ihrem restlichen Körper ein wohltuendes Gefühl der Wärme verströmte. Um die Zeit bis zum Beginn des heutigen Arbeitstags zu nutzen, beschloss sie, sich anzuziehen und eine Runde um den Block zu joggen. Sie schätzte kurz die Zeit ab und entschied, dass sie es schaffen würde, danach noch ausgiebig zu duschen und anschließend ins Büro zu fahren. Die Agentin schlüpfte in ihre graue Jogginghose, streifte sich ein passendes Shirt über und stülpte dann ihre Laufschuhe über die Füße.
»Bis später«, sagte sie zu ihrer Katze, die noch immer auf der Couch lag und bereits wieder schlief.